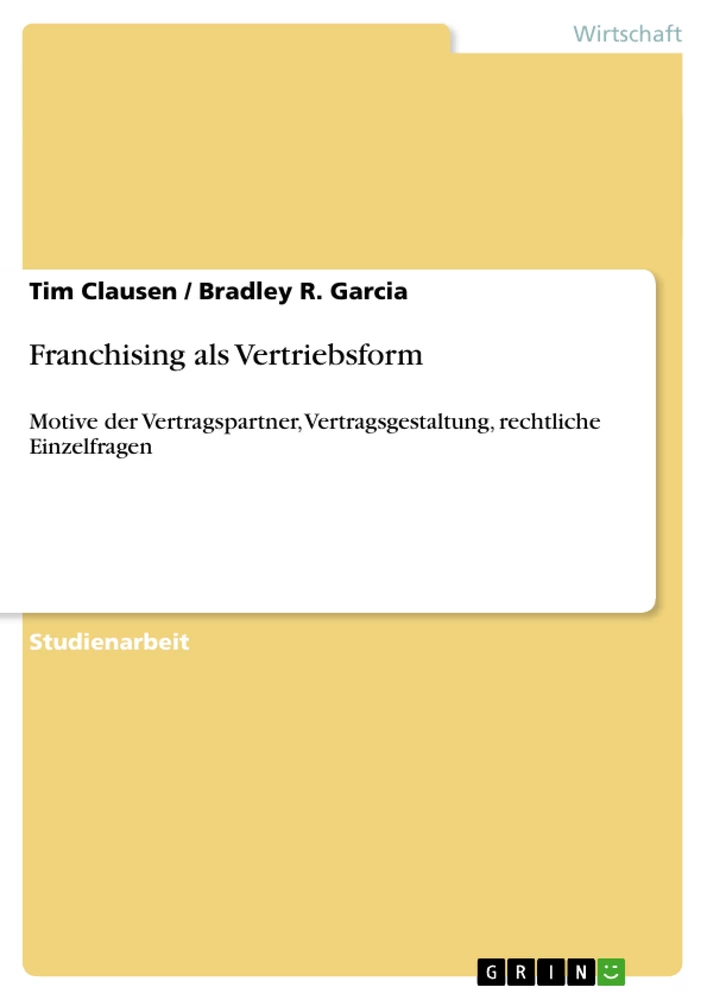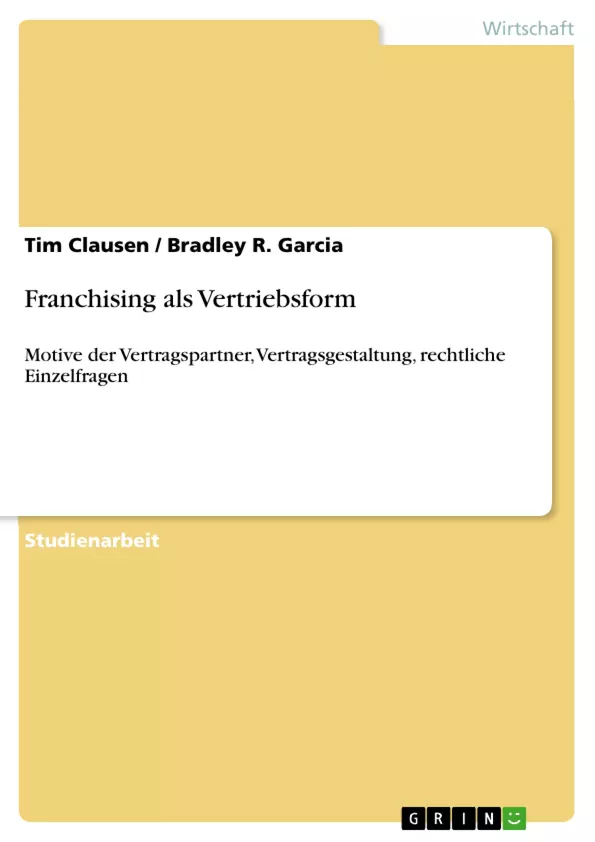In der BRD ist das Franchising (F) noch ein junges Vertriebssystem, welches dennoch kontinuierlich positive Wachstumszahlen aufweisen kann. Die Bedeutung des F nimmt konsequenterweise in der heutigen Zeit immer mehr zu.
Diese Arbeit soll Ursachen für den Erfolg des F beleuchten, die Systematik der F-Verträge darstellen und Gründe dafür aufzeigen, warum die Nachfrage potenzieller FN nach etablierten Systemen immer mehr zunimmt. Ein Grund hierfür ist die Prob-lematik junger Unternehmen, sich Zugang zu Ressourcen und -Gebern zu verschaf-fen- oftmals aufgrund mangelnder Erfahrung und fehlender Kompetenzen. Mit Hilfe eines Franchise-Gebers (FG) können die potenziellen Entrepreneure als Franchise-Nehmer (FN) dieses Problem größtenteils umgehen. Der FN erhält durch den FG ein erprobtes und durchdachtes, durch Schulungen vermitteltes Geschäftskonzept und ihm wird dadurch der Start in die Selbständigkeit deutlich erleichtert. Auch der FG profitiert von dieser Art der Partnerschaft. FN sind in den meisten Fällen hoch motivierte, engagierte selbständige Agenten, die im Auftrag des FG Waren oder Dienst-leistungen anbieten. Der FG profitiert zusätzlich vom Kapitaleinsatz des FN und von den durch ihn gesammelten Informationen, die er dem FG zur Verfügung stellen muss. Eine kritische Betrachtung der weiteren Vor- und Nachteile des F bildet den Abschluss der beiden einleitenden Teile dieser Arbeit.
Den Hauptteil dieser Arbeit bilden die rechtlichen Aspekte des F, wobei insbesondere auf den F-Vertrag eingegangen wird. Dieser stellt das zentrale Fundament der Part-nerschaft zwischen FG und FN dar. Im deutschen Rechtssystem existiert kein ein-heitliches F-Gesetz, sondern das F-Recht setzt sich aus einer Anzahl verschiedener Gesetzesregelungen zusammen. Ferner beschäftigt sich diese Seminararbeit mit den beim F häufig auftretenden Problemen. Das F wird in diesem Zusammenhang mit Hilfe des Prinzipal-Agenten-Theorem und der damit verbundenen Moral Hazard Problematik interpretiert. Diese kann durch eine geschickte Vertragsgestaltung ge-mindert und/oder sogar beseitigt werden. Die wesentlichen Bestandteile des F-Vertrags, die diese Thematik teilweise aufgreifen, werden hierbei explizit dargestellt und erläutert.
Abschließend wird sich kritisch mit der Vertriebsform F auseinandergesetzt und es werden Implikationen für das Management sowie weitere potenzielle Forschungsbe-reiche und -möglichkeiten aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Definition und Grundstruktur des Franchising
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Know-how
- 2.1.3 Ziele
- 2.1.4 Geschichtliche Entwicklung des Franchising
- 2.1.5 Ökonomische Relevanz und Aktualität des Franchising
- 2.1.6 Typologie des Franchising
- 2.2 Abgrenzung zu ausgewählten Betriebsformen
- 2.2.1 Filialsysteme
- 2.2.2 Lizenzsysteme
- 2.2.3 Handelsvertreter
- 2.2.4 Vertragshändler
- 2.3 Motive der Vertragspartner
- 2.3.1 Motive des Franchisegebers
- 2.3.2 Motive des Franchisenehmers
- 3. Vor- und Nachteile des Franchising
- 3.1 Vorteile des Franchising
- 3.1.1 Vorteile für den Franchisegeber
- 3.1.2 Vorteile für den Franchisenehmer
- 3.2 Nachteile des Franchising
- 3.2.1 Nachteile für den Franchisegeber
- 3.2.2 Nachteile für den Franchisenehmer
- 3.3 Zwischenfazit
- 4. Rechtliche Aspekte des Franchising
- 4.1 Besonderheiten des Franchisevertrags
- 4.1.1 Vorvertragliche Aufklärungspflicht des Franchisegebers gegenüber dem Franchisenehmer
- 4.1.2 Kartellrechtlich relevante Aspekte des Franchising
- 4.1.3 Weisungsrechte des Franchisegebers
- 4.1.4 Prinzipal-Agenten-Ansatz beim Franchising
- 4.1.5 Komplementäre Elemente des Franchisevertrags
- 4.2 Zentrale Bestandteile des Franchisevertrags
- 4.2.1 Leistungen des Franchisegebers
- 4.2.2 Leistungen des Franchisenehmers
- 4.2.3 Informationsaustausch
- 4.2.4 Franchisegebühren
- 4.2.5 Ausschließlichkeitsbindungen des Franchisenehmers
- 4.2.6 Gebietsschutz
- 4.2.7 Werbekooperation
- 4.2.8 Vertragsbeendigung
- 5. Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Franchising als Vertriebsform. Ziel ist es, die Motive der Vertragspartner (Franchisegeber und Franchisenehmer), die Gestaltung des Franchisevertrags und relevante rechtliche Einzelfragen zu beleuchten.
- Definition und Grundstruktur des Franchising
- Motive der Franchisegeber und Franchisenehmer
- Vor- und Nachteile des Franchising für beide Vertragspartner
- Rechtliche Aspekte des Franchisevertrags
- Zentrale Bestandteile des Franchisevertrags
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses einführende Kapitel legt wahrscheinlich den Fokus auf die Bedeutung des Franchising im modernen Wirtschaftskontext und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der gesamten Arbeit. Es wird voraussichtlich eine kurze Übersicht über die folgenden Kapitel geben und die Forschungsfrage(n) der Arbeit definieren.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel bietet eine fundierte Einführung in das Franchising. Es definiert den Begriff, beschreibt die Grundstruktur eines Franchisesystems, beleuchtet die historische Entwicklung und die ökonomische Relevanz. Zudem werden verschiedene Franchisingtypen vorgestellt und eine Abgrenzung zu ähnlichen Vertriebsformen wie Filialsystemen, Lizenzsystemen, Handelsvertreter- und Vertragshändlermodellen vorgenommen. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der theoretischen Grundlagen des Franchising.
3. Vor- und Nachteile des Franchising: Hier werden die Vor- und Nachteile des Franchising sowohl aus der Perspektive des Franchisegebers als auch des Franchisenehmers detailliert analysiert. Es werden sowohl ökonomische als auch rechtliche Aspekte berücksichtigt, um ein umfassendes Bild der Vor- und Nachteile zu zeichnen. Der Vergleich ermöglicht eine fundierte Bewertung der Attraktivität des Franchising als Vertriebsform.
4. Rechtliche Aspekte des Franchising: Dieser Kapitelteil befasst sich intensiv mit den rechtlichen Besonderheiten des Franchisevertrags. Es werden die vorvertraglichen Aufklärungspflichten des Franchisegebers, kartellrechtliche Aspekte und die Weisungsrechte des Franchisegebers untersucht. Der Prinzipal-Agenten-Ansatz wird im Kontext des Franchising analysiert, und es werden die zentralen Bestandteile des Franchisevertrags, wie Leistungen beider Seiten, Informationsaustausch, Gebühren, Ausschließlichkeitsbindungen, Gebietsschutz, Werbekooperation und Vertragsbeendigung, detailliert erläutert. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Absicherung und den potenziellen rechtlichen Fallstricken.
Schlüsselwörter
Franchising, Franchisegeber, Franchisenehmer, Vertriebsform, Vertragsgestaltung, rechtliche Aspekte, Franchisevertrag, Motive, Vor- und Nachteile, Kartellrecht, Prinzipal-Agenten-Ansatz, Gebietsschutz, Ausschließlichkeitsbindung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Franchising: Eine umfassende Übersicht"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht zum Thema Franchising. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Motive der Vertragspartner (Franchisegeber und Franchisenehmer), der Gestaltung des Franchisevertrags und der relevanten rechtlichen Aspekte.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung, 2. Grundlagen (Definition, Abgrenzung zu anderen Betriebsformen, Motive der Vertragspartner), 3. Vor- und Nachteile des Franchising, 4. Rechtliche Aspekte des Franchising (Franchisevertrag, Aufklärungspflichten, Kartellrecht, Weisungsrechte, Prinzipal-Agenten-Ansatz), und 5. Schlussfolgerungen und Ausblick.
Was wird im Kapitel "Grundlagen" behandelt?
Kapitel 2 ("Grundlagen") definiert den Begriff Franchising, beschreibt die Grundstruktur eines Franchisesystems, beleuchtet die historische Entwicklung und ökonomische Relevanz. Es werden verschiedene Franchisingtypen vorgestellt und eine Abgrenzung zu ähnlichen Vertriebsformen (Filialsysteme, Lizenzsysteme, Handelsvertreter, Vertragshändler) vorgenommen. Die Darstellung der theoretischen Grundlagen steht im Vordergrund.
Welche Vor- und Nachteile des Franchising werden diskutiert?
Kapitel 3 analysiert detailliert die Vor- und Nachteile des Franchising aus der Perspektive sowohl des Franchisegebers als auch des Franchisenehmers. Ökonomische und rechtliche Aspekte werden berücksichtigt, um eine umfassende Bewertung der Attraktivität des Franchising zu ermöglichen.
Welche rechtlichen Aspekte werden im Dokument behandelt?
Kapitel 4 befasst sich intensiv mit den rechtlichen Besonderheiten des Franchisevertrags. Es werden die vorvertraglichen Aufklärungspflichten des Franchisegebers, kartellrechtliche Aspekte, die Weisungsrechte des Franchisegebers und der Prinzipal-Agenten-Ansatz untersucht. Die zentralen Bestandteile des Franchisevertrags (Leistungen beider Seiten, Informationsaustausch, Gebühren, Ausschließlichkeitsbindungen, Gebietsschutz, Werbekooperation und Vertragsbeendigung) werden detailliert erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen: Franchising, Franchisegeber, Franchisenehmer, Vertriebsform, Vertragsgestaltung, rechtliche Aspekte, Franchisevertrag, Motive, Vor- und Nachteile, Kartellrecht, Prinzipal-Agenten-Ansatz, Gebietsschutz, Ausschließlichkeitsbindung.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Die Seminararbeit untersucht das Franchising als Vertriebsform. Ziel ist es, die Motive der Vertragspartner (Franchisegeber und Franchisenehmer), die Gestaltung des Franchisevertrags und relevante rechtliche Einzelfragen zu beleuchten.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und alle, die sich umfassend mit dem Thema Franchising auseinandersetzen möchten. Es bietet eine strukturierte und professionelle Analyse des Themas.
- Quote paper
- Tim Clausen (Author), Bradley R. Garcia (Author), 2008, Franchising als Vertriebsform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150523