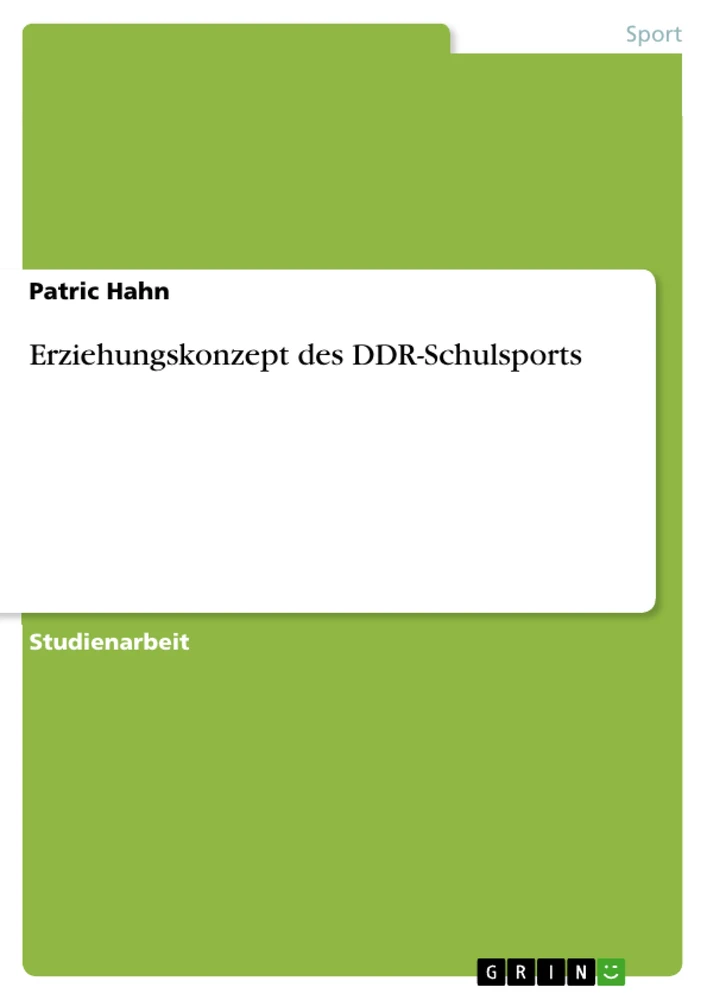Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8.Mai 1945 und dem damit einhergehenden Zusammenbruch des NS-Regimes, teilten die alliierten Siegermächte (USA, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion) Deutschland in vier Besatzungszonen auf und erhielten durch das Einsetzen eines Alliierten Kontrollrates offiziell die Regierungsgewalt. Im Juli/August 1945 wurden auf der Potsdamer Konferenz u.a. neue Inhalte, Richtlinien und Zielen für das zukünftige Erziehungs- und Bildungssystem Deutschlands formuliert. Trotz der gemeinsamen Überzeugung, dass „die nazistischen und militaristischen Lehren völlig ausgemerzt“ (Peiffer, 2001, S. 372) werden müssen, sollte es nicht sehr lange dauern bis die Zusammenarbeit der Alliierten erste Risse bekam. So konnte keine Einigkeit über die Art und Weise der weiteren Behandlung Deutschlands erzielt werden. Dies lag nicht nur daran,
„dass das Demokratieverständnis der sowjetischen Besatzungsmacht sich grundlegend unterschied von dem der westlichen Alliierten“ (Peiffer, 2001, S. 372).
Auch wirtschaftliche Vorstellungen ragten weit auseinander. So schlossen sich die USA und Großbritannien zur ‚Bizone‘, einer Vereinigung auf wirtschaftlicher Basis, zusammen. Die Antwort der Sowjetunion auf diese von ihnen missbilligte Vereinigung, war die ‚Deutsche Wirtschaftskommission‘, welche die Umwandlung zur Planwirtschaft darstellte. Diese unüberbrückbaren Konflikte der politischen Systeme ließen die, anfangs nur für eine kurze Übergangszeit geplanten, Grenzen der Besatzungszonen weiter anschwellen und sie im Laufe der Zeit zu unüberwindbaren Hürden zwischen Ost und West anwachsen. 1949 kommt es schließlich zur Gründung zweier deutscher Staaten. Am 24.Mai 1949 wird die Bundesrepublik Deutschland (BRD) gegründet, am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Die Entwicklung beider Staaten verlief nun vollkommen getrennt voneinander.
Durch die starke Prägung der Sowjetunion kam es in der DDR nicht zu einer sich eigenständig entwickelnden parlamentarischen deutschen Republik....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die marxistisch-sozialistische Pädagogik
- Erziehungs- und Bildungsziele
- Bildungssystem der DDR
- Körperkultur
- Sport
- Körpererziehung
- Erziehung im und durch Sport
- Körpererziehung im Vorschulalter
- Lehrpläne des Sportunterrichts an der Oberschule
- Der außerunterrichtliche und außerschulische Sport
- Wehrerziehung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Erziehungskonzept des DDR-Schulsports und beleuchtet dessen Einbettung in die marxistisch-sozialistische Pädagogik. Die Analyse fokussiert auf die Erziehungs- und Bildungsziele, die Rolle des Sports im Bildungssystem der DDR und die Umsetzung dieser Konzepte in der Praxis.
- Die marxistisch-sozialistische Pädagogik als Grundlage des DDR-Schulsports
- Die Erziehungs- und Bildungsziele der DDR und deren Einfluss auf den Sportunterricht
- Die Bedeutung des Sports für die politische Indoktrination und die Vorbereitung auf den „Klassenkampf“
- Die Rolle des Schulsports in der körperlichen und ideologischen Erziehung der Jugend
- Der außerunterrichtliche und außerschulische Sport im Kontext des DDR-Erziehungskonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext nach dem Zweiten Weltkrieg, die Teilung Deutschlands und die Gründung der DDR. Sie erläutert die unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Systeme in Ost und West und führt in die Thematik des Erziehungskonzepts der DDR ein, welches im Fokus dieser Arbeit steht.
Die marxistisch-sozialistische Pädagogik: Dieses Kapitel behandelt die marxistisch-leninistische Ideologie als Grundlage des DDR-Schulsystems. Es werden die Erziehungs- und Bildungsziele der DDR erläutert, die auf die Unterordnung des Individuums unter die Ziele der Gemeinschaft abzielen. Die SED bestimmte Inhalte und Methoden, wobei dem persönlichen Erziehungsziel keine Bedeutung beigemessen wurde. Die sozialistische Erziehung war stark von patriotischen Merkmalen geprägt, wie die „Zehn Gebote der sozialistischen Moral“ veranschaulichen. Der „Klassenkampf“ und der Weg zur klassenlosen Gesellschaft wurden als zentrale Elemente der Ideologie vermittelt. Marx’ Lehren, insbesondere die Forderung nach der Vereinigung von Erziehung und materieller Produktion, fanden in der polytechnischen Oberschule ihre praktische Umsetzung.
Körperkultur: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Sport und Körpererziehung im DDR-Erziehungssystem. Es werden die verschiedenen Ebenen des Sports, vom Vorschulalter bis zum außerschulischen Bereich, beleuchtet. Die Lehrpläne des Sportunterrichts an der Oberschule werden ebenso thematisiert wie die Bedeutung des Sports für die körperliche Ertüchtigung und die politische Indoktrination. Besonderes Augenmerk liegt auf der Wehrerziehung als integraler Bestandteil des DDR-Schulsports.
Schlüsselwörter
DDR, Schulsport, Erziehungskonzept, marxistisch-sozialistische Pädagogik, Erziehungsziele, Körpererziehung, Sportunterricht, Ideologie, politische Indoktrination, Wehrerziehung, Klassenkampf, Sozialismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur DDR-Schulsportanalyse
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Erziehungskonzept des DDR-Schulsports und dessen Einbettung in die marxistisch-sozialistische Pädagogik. Der Fokus liegt auf den Erziehungs- und Bildungsziele, der Rolle des Sports im Bildungssystem der DDR und der praktischen Umsetzung dieser Konzepte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die marxistisch-sozialistische Pädagogik als Grundlage des DDR-Schulsports, die Erziehungs- und Bildungsziele der DDR und deren Einfluss auf den Sportunterricht, die Bedeutung des Sports für politische Indoktrination und die Vorbereitung auf den „Klassenkampf“, die Rolle des Schulsports in der körperlichen und ideologischen Erziehung der Jugend sowie den außerunterrichtlichen und außerschulischen Sport im Kontext des DDR-Erziehungskonzepts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur marxistisch-sozialistischen Pädagogik, ein Kapitel zur Körperkultur (inkl. Sportunterricht, Körpererziehung und Wehrerziehung in verschiedenen Altersstufen und Kontexten) und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselbegriffe.
Was wird unter „marxistisch-sozialistischer Pädagogik“ im Kontext der Arbeit verstanden?
Die Arbeit beschreibt die marxistisch-leninistische Ideologie als Grundlage des DDR-Schulsystems. Es werden die Erziehungs- und Bildungsziele der DDR erläutert, die auf die Unterordnung des Individuums unter die Ziele der Gemeinschaft abzielten. Die SED bestimmte Inhalte und Methoden; persönliche Erziehungsziele spielten keine Rolle. Patriotische Elemente und der „Klassenkampf“ wurden als zentrale Elemente vermittelt.
Welche Rolle spielte der Sport im DDR-Erziehungssystem?
Das Kapitel „Körperkultur“ analysiert die Rolle von Sport und Körpererziehung im DDR-Erziehungssystem von der Vorschule bis zum außerschulischen Bereich. Es werden Lehrpläne des Sportunterrichts, körperliche Ertüchtigung und politische Indoktrination beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit erhält die Wehrerziehung als integraler Bestandteil des DDR-Schulsports.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: DDR, Schulsport, Erziehungskonzept, marxistisch-sozialistische Pädagogik, Erziehungsziele, Körpererziehung, Sportunterricht, Ideologie, politische Indoktrination, Wehrerziehung, Klassenkampf, Sozialismus.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet (implizit)?
Die Arbeit stützt sich implizit auf historische Dokumente, Lehrpläne und möglicherweise wissenschaftliche Literatur zum Thema DDR-Schulsystem und -Pädagogik. Konkrete Quellenangaben fehlen im gegebenen Auszug.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit richtet sich an Leser, die sich für die Geschichte des DDR-Bildungssystems, insbesondere den Schulsport, und dessen ideologische Einbettung interessieren. Sie eignet sich für akademische Zwecke und die Analyse von Erziehungskonzepten im Kontext historischer Systeme.
- Citar trabajo
- Patric Hahn (Autor), 2009, Erziehungskonzept des DDR-Schulsports, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150535