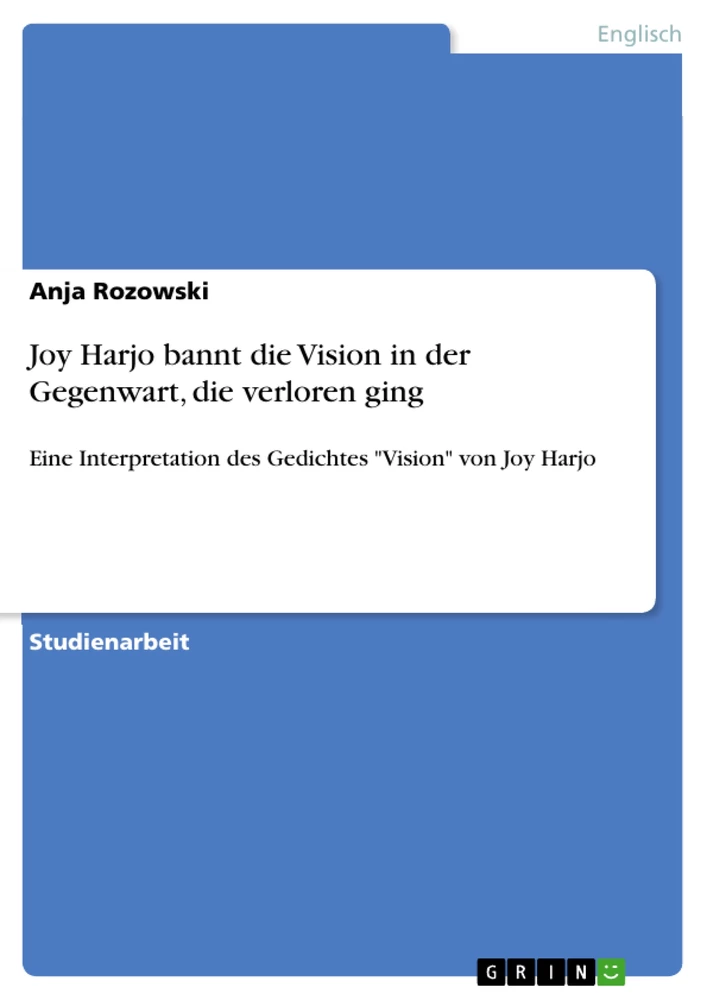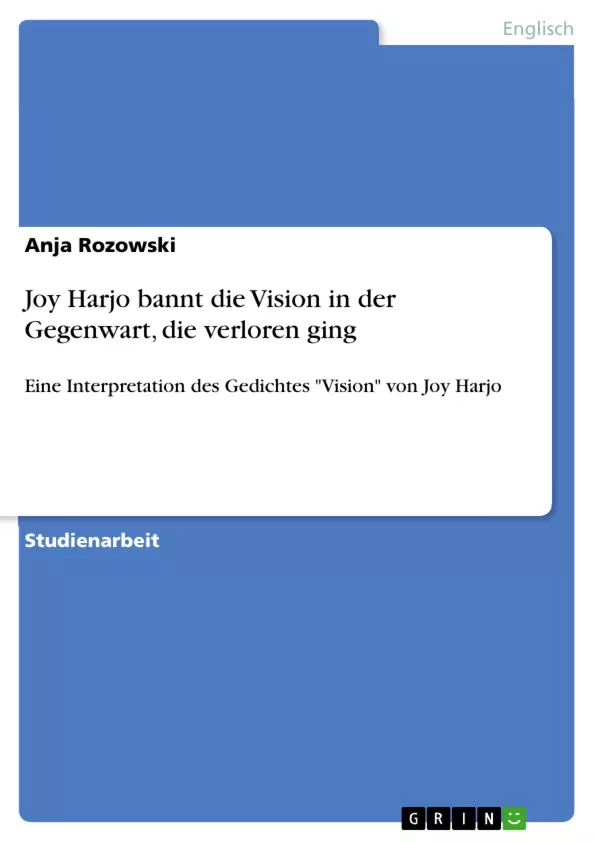Joy Harjo’s Gedicht „Vision“ ist entstanden im Kontext der modernen „westlichen Welt“ - einer säkularisierten Umgebung, in welcher der Antrieb vor allem auf den Erwerb materieller Güter zielt und das Leben bestimmt wird durch die freie Marktwirtschaft. Trotz des damit erreichten Wohlstands und der außergewöhnlich guten Versorgung und scheinbarer denkerischer Freiheit, ergeben sich Mangelerscheinungen und Identitätskrisen.
Gleichzeitig ist Joy Harjo Mitglied der Creek Indianer, denn ihr Vater war creek und ihre Mutter teilweise cherokee, französisch und irisch. Harjo ist also Teil einer extremen multikulturellen Verschmelzung und im Speziellen geprägt durch ihre indianischen sozio-anthropologischen Wurzeln. Mit letzteren hat sie sich gezielt im Studium am Institute of American Indian Arts in Santa Fe beschäftigt.
Joy Harjo beschäftigt sich in „Vision“ mit dem Verlust und der Wiederentdeckung eines Gutes, das ihrer indianischen Kultur vertraut war und vielen verloren ging.
Sie findet einen Ausdruck für eine spirituelle Verbundenheit mit der Welt und hat die Fähigkeit, Visionen zu empfinden, die den Menschen fremd geworden sind, obwohl sie nach Harjo‘s Verständnis zu unserer Natur gehören und Seelenheil spenden.
Die Form, in der sie dies illustriert, ist von wenigen, kräftigen Bildern geprägt und folgt der Tradition oraler Überlieferung.
Um “Vision” zu verstehen, ist es notwendig, die Kulturausprägungen, die auf Harjo gewirkt haben, in ihrer Einzigartigkeit auf den Text zu beziehen. Vorallem ihre Teilhabe an indianischer Religiosität und Weltanschauung lässt sie den Worten ihres Gedichts weitergehendere Bedeutungen verleihen als bloß solche westlicher Lexikalität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Quellenlage
- Zur Wahl der Form
- Besonderheiten der Form
- Zur Konstruktion des Inhalts und der Perspektive mit Begriffsklärungen
- Zur Besonderheit der Perspektive, Wahrnehmungsweise und Ausdrucksform
- Bildklärung und Signifikanz der Wortwahl
- Zu Harjos persönlicher Suche nach einer erfüllenden Weltsicht
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse des Gedichts „Vision“ von Joy Harjo zielt darauf ab, die Verbindung zwischen Harjos indianischer Kultur und ihrer poetischen Ausdrucksweise zu untersuchen. Das Gedicht wird als Ausdruck einer spirituellen Verbundenheit interpretiert, die in der modernen Welt verloren gegangen ist.
- Die Bedeutung von Visionen in indianischen Kulturen
- Die Verbindung zwischen Sprache und spiritueller Praxis
- Der Einfluss der modernen Welt auf indianische Traditionen
- Die Suche nach einer erfüllenden Weltsicht in einer multikulturellen Gesellschaft
- Die Bedeutung von oraler Tradition in der modernen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Gedicht „Vision“ und Joy Harjos kulturellen Hintergrund vor. Sie erläutert die Bedeutung von Visionen und die damit verbundenen Herausforderungen in der modernen Welt. Das Kapitel „Zur Quellenlage“ beleuchtet die Verfügbarkeit von Informationen über indianische Kulturen im Internet und die Bedeutung dieses Mediums für die Verbreitung und Dokumentation der Kultur. Das Kapitel „Zur Wahl der Form“ befasst sich mit Harjos Entscheidung, eine westliche Ausdrucksform für ihre Gedichte zu wählen, um ein breites Publikum zu erreichen. Es beleuchtet auch den Unterschied zwischen westlichem und indianischem Sprachgebrauch. Das Kapitel „Besonderheiten der Form“ analysiert die formalen Merkmale des Gedichts, insbesondere die Satzbrechungen und den rhythmischen Aufbau, die an die Tradition oraler Überlieferung erinnern.
Schlüsselwörter
Indianische Kultur, Visionen, spirituelle Verbundenheit, orale Tradition, moderne Welt, multikulturelle Gesellschaft, Sprache, Gedichtanalyse, Joy Harjo.
Häufig gestellte Fragen
Wovon handelt Joy Harjos Gedicht „Vision“?
Das Gedicht thematisiert den Verlust und die Wiederentdeckung spiritueller Verbundenheit mit der Welt, die in der modernen, materiell orientierten Gesellschaft oft verloren geht.
Welchen kulturellen Hintergrund hat Joy Harjo?
Joy Harjo ist Mitglied der Creek (Muscogee) Nation und hat cherokee, französische und irische Wurzeln, was ihre multikulturelle Perspektive prägt.
Was bedeutet „orale Tradition“ in Harjos Lyrik?
Harjo nutzt kräftige Bilder und rhythmische Strukturen (wie Satzbrechungen), die an die mündliche Überlieferung indianischer Kulturen erinnern, auch wenn sie in englischer Sprache schreibt.
Warum nutzt Harjo westliche Ausdrucksformen?
Sie wählt diese Formen, um ein breites Publikum in der säkularisierten westlichen Welt zu erreichen und ihnen indianische Religiosität und Weltanschauung näherzubringen.
Welche Kritik äußert das Gedicht an der modernen Welt?
Es weist auf Mangelerscheinungen und Identitätskrisen hin, die trotz materiellen Wohlstands entstehen, wenn die spirituelle Dimension des Lebens vernachlässigt wird.
- Quote paper
- Mag. Anja Rozowski (Author), 2004, Joy Harjo bannt die Vision in der Gegenwart, die verloren ging, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150592