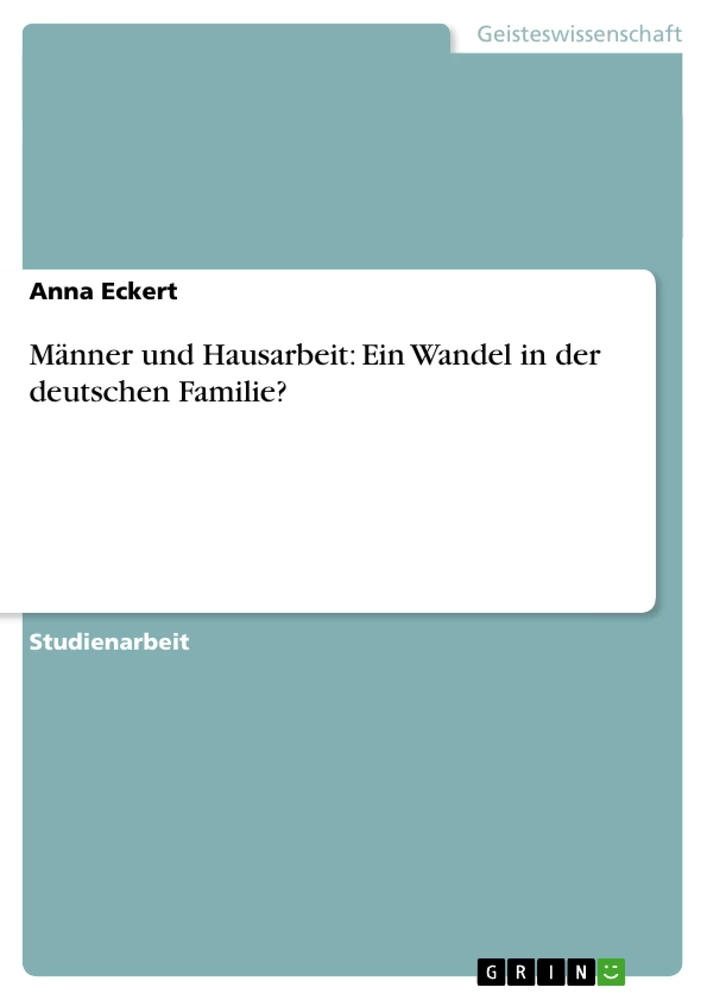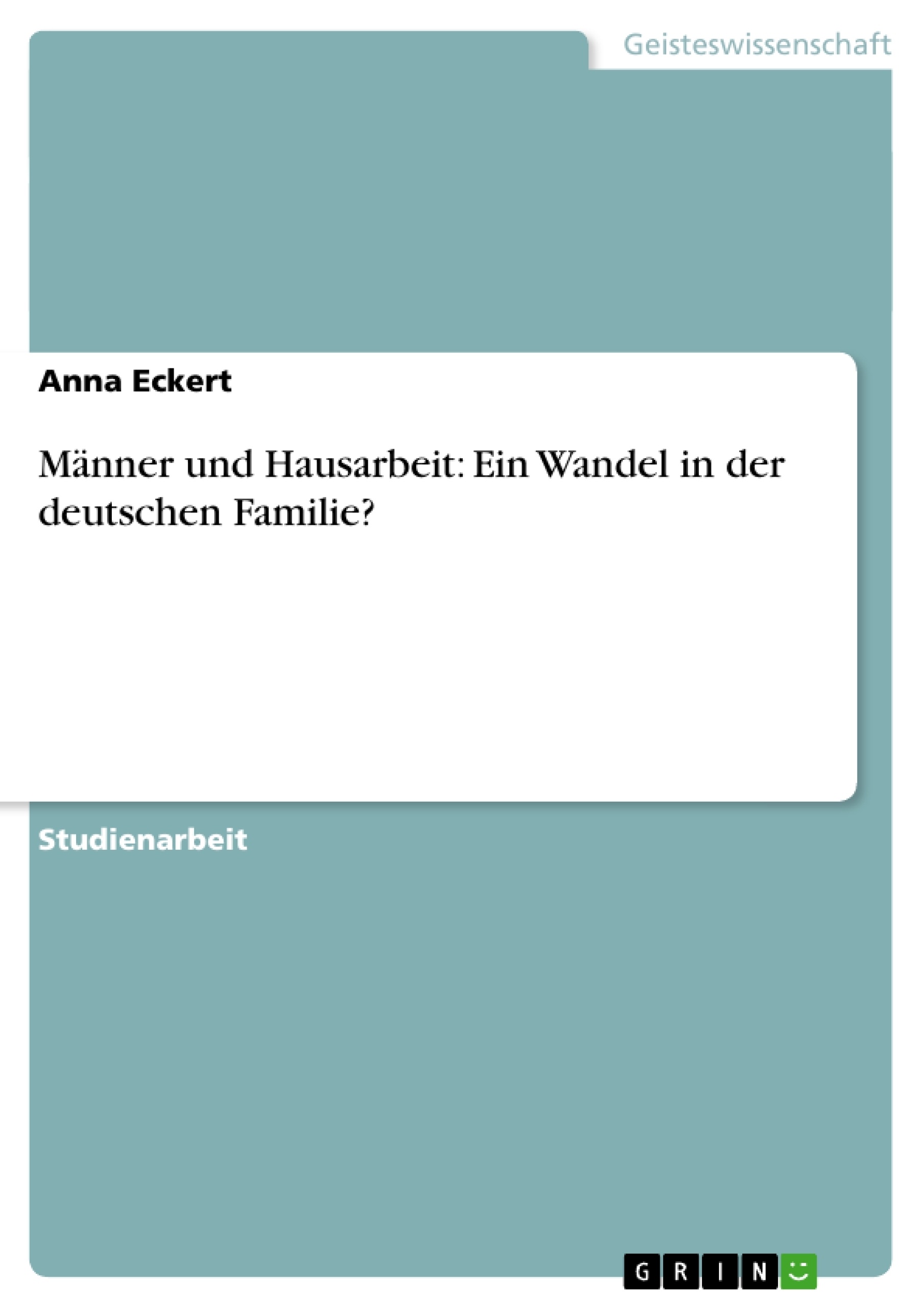Die Orientierungen für Männer sind schwieriger geworden. Hielt man in Vergangenheit am traditionellen Vorbild des Vaters und Großvaters fest, stehen Männern heute unterschiedliche Orientierungsmuster zur Verfügung. Das führt mitunter dazu, dass der moderne Mann eine bessere Vorstellung von der gesellschaftlichen Rolle einer Frau hat, als von seiner eigenen.
Männer versuchen erst seit kurzem beide Lebens- und Arbeitsbereiche miteinander zu verbinden. Heutzutage wollen immer weniger Frauen zwischen Beruf oder Familie entscheiden und erheben Anspruch auf beides. Strebt die Frau danach, Kind und Karriere zu verbinden, ist er an der Reihe alle privaten Arbeiten mit ihr zu teilen und sie somit zu entlasten. Vom modernen Mann wird mehr gefordert. Die Doppelbelastung der Frau ist dabei nichts Neues mehr.
Soviel zur Idealvorstellung. Doch inwieweit decken sich Vollkommenheit und Realität? Wie verhalten sich beide Geschlechter in der neuen Situation tatsächlich? Ist die private Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter gefährdet, da sie vom Mann übernommen wird oder ist alles noch beim Alten? Und wie steht es überhaupt um die häuslichen Fähigkeiten der Männer? Womit hängen unsere Einstellungen über die geschlechtlichen Rollenzuweisungen eigentlich zusammen?
Im Folgenden wird auf die Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und familiärer Sozialisation eingegangen. Ausgehend von der These, dass gesellschaftliche Umstände die Erziehung bedingen und umgekehrt, wird die bisherige, historisch geprägte Struktur in Haushalt und Familie beschrieben. Anschließend findet eine Auseinandersetzung mit der geschlechtsspezifischen Sozialisation statt, die Themen, wie die Entstehung von Geschlechtsidentität und die Bedeutung, der Eltern als Rollenmodelle, behandelt. In einem weiteren Punkt stehen die Geschlechter-Arrangements, gemeint ist hier die tatsächliche Aufgabenverteilung zwischen Frau und Mann innerhalb Haushalt und Familie, im Fokus der Betrachtungen. Zum Schluss bleibt zu klären, ob eine Neubewertung von Erwerbs- und Hausarbeit den Wegfall verfestigter Rollenzuweisungen ermöglicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und familiärer Sozialisation. Früher und heute
- 2.1. Die bisherige Struktur in Haushalt und Familie
- 2.2. Geschlechtspezifische Sozialisation
- 3. Geschlechter-Arrangements
- 3.1. Männer und Hausarbeit
- 4. Brauchen wir eine neue Bewertung von Arbeit?
- 5. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Wandel in der deutschen Familie im Hinblick auf die Hausarbeit von Männern in den letzten Jahrzehnten. Sie analysiert, inwieweit Männer die traditionellen Rollen der Frauen übernehmen und ob sich die Geschlechterrollen in diesem Bereich verändert haben. Die Arbeit basiert auf der Theorie von Pfau-Effinger zum Wandel in den Geschlechterbeziehungen, konzentriert sich aber auf die Mikroebene der Geschlechter-Arrangements.
- Wandel der Geschlechterrollen in der Familie
- Einfluss der gesellschaftlichen Umstände auf die Erziehung und die Arbeitsteilung
- Männer und ihre Beteiligung an der Hausarbeit
- Analyse von Geschlechter-Arrangements und deren Einfluss auf den sozialen Wandel
- Bewertung der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass gesellschaftliche Umstände die Erziehung bedingen und umgekehrt, wobei die männliche Sozialisation eine zentrale Rolle spielt. Sie führt in die Thematik ein und erläutert den Fokus auf die Mikroebene der Geschlechter-Arrangements nach Pfau-Effinger. Die Autorin argumentiert, dass sich die Orientierungen für Männer verändert haben und dass Frauen bereits lange mit dem Spagat zwischen Beruf und Familie umgehen, während Männer dies erst seit Kurzem tun. Die Abhängigkeit der Gesellschaft von beiden Arbeitsformen, der privaten und der marktvermittelten, wird hervorgehoben. Die zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit Männer Frauen in der Hausarbeit unterstützen und ob ein Wandel in den Geschlechterrollen stattgefunden hat.
2. Die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und familiärer Sozialisation. Früher und heute: Dieses Kapitel untersucht die historische und aktuelle Struktur von Haushalt und Familie sowie die geschlechtsspezifische Sozialisation. Es beleuchtet die traditionelle Arbeitsteilung und wie diese durch gesellschaftliche Veränderungen in Frage gestellt wird. Das Kapitel analysiert die unterschiedlichen Sozialisationsprozesse von Männern und Frauen und deren Auswirkungen auf die heutige Rollenverteilung. Es wird diskutiert, wie die gesellschaftlichen Erwartungen an Männer und Frauen die Arbeitsteilung in der Familie prägen. Die Bedeutung der "Gleichheit" als "distributive" Gerechtigkeit im Kontext egalitärer Geschlechterstrukturen wird anhand von Pfau-Effingers Theorie erläutert.
3. Geschlechter-Arrangements: Das Kapitel fokussiert sich auf das Konzept der Geschlechter-Arrangements und untersucht, wie sich diese im Laufe der Zeit verändert haben und welche Faktoren diese Veränderungen beeinflussen. Es analysiert den Einfluss der Frauenbewegung auf den Wandel der Geschlechterrollen und die zunehmende Beteiligung von Männern an der Hausarbeit. Die Autorin beleuchtet den Aushandlungsprozess zwischen sozialen Akteuren mit unterschiedlichen Interessen und Machtpositionen innerhalb der Geschlechter-Arrangements. Die zunehmende Verbreitung egalitärer Strukturen in der Gesellschaft wird diskutiert.
4. Brauchen wir eine neue Bewertung von Arbeit?: Dieses Kapitel hinterfragt die traditionelle Bewertung von Arbeit und wirft die Frage auf, ob eine neue Perspektive auf die Hausarbeit notwendig ist, um die veränderte Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen besser zu erfassen. Es diskutiert die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in Bezug auf die Aufgabenverteilung innerhalb der Familie und die gesellschaftliche Anerkennung verschiedener Arbeitsformen. Die Bedeutung einer gerechteren Verteilung der Hausarbeit wird betont. Der Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Wertschätzung von Arbeit und der Geschlechterrolle wird untersucht.
Schlüsselwörter
Geschlechterrollen, Hausarbeit, Männer, Familie, Sozialisation, Geschlechter-Arrangements, gesellschaftlicher Wandel, Arbeitsteilung, Egalität, Pfau-Effinger.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Wandel der Geschlechterrollen in der Familie
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Wandel in der deutschen Familie im Hinblick auf die Hausarbeit von Männern in den letzten Jahrzehnten. Sie analysiert, inwieweit Männer die traditionellen Rollen der Frauen übernehmen und ob sich die Geschlechterrollen in diesem Bereich verändert haben. Der Fokus liegt auf der Mikroebene der Geschlechter-Arrangements nach Pfau-Effinger.
Welche zentralen Fragen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel der Geschlechterrollen in der Familie, dem Einfluss gesellschaftlicher Umstände auf Erziehung und Arbeitsteilung, der Beteiligung von Männern an der Hausarbeit, der Analyse von Geschlechter-Arrangements und deren Einfluss auf den sozialen Wandel sowie der Bewertung der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern.
Welche theoretische Grundlage verwendet die Hausarbeit?
Die Hausarbeit basiert auf der Theorie von Pfau-Effinger zum Wandel in den Geschlechterbeziehungen, konzentriert sich aber auf die Mikroebene der Geschlechter-Arrangements.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und familiärer Sozialisation (früher und heute), ein Kapitel zu Geschlechter-Arrangements, ein Kapitel zur Frage nach einer neuen Bewertung von Arbeit und abschließende Schlussbetrachtungen.
Was wird im Kapitel "Die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und familiärer Sozialisation. Früher und heute" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die historische und aktuelle Struktur von Haushalt und Familie sowie die geschlechtsspezifische Sozialisation. Es beleuchtet die traditionelle Arbeitsteilung und wie diese durch gesellschaftliche Veränderungen in Frage gestellt wird und analysiert die unterschiedlichen Sozialisationsprozesse von Männern und Frauen und deren Auswirkungen auf die heutige Rollenverteilung.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Geschlechter-Arrangements"?
Das Kapitel fokussiert sich auf das Konzept der Geschlechter-Arrangements und untersucht, wie sich diese im Laufe der Zeit verändert haben und welche Faktoren diese Veränderungen beeinflussen. Es analysiert den Einfluss der Frauenbewegung und den Aushandlungsprozess zwischen sozialen Akteuren.
Was ist die zentrale These der Einleitung?
Die Einleitung stellt die These auf, dass gesellschaftliche Umstände die Erziehung bedingen und umgekehrt, wobei die männliche Sozialisation eine zentrale Rolle spielt. Die Autorin argumentiert, dass sich die Orientierungen für Männer verändert haben und dass Frauen bereits lange mit dem Spagat zwischen Beruf und Familie umgehen, während Männer dies erst seit Kurzem tun.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Schlussfolgerungen werden in den Schlussbetrachtungen gezogen und detailliert in den Kapitelzusammenfassungen erläutert. Es geht um die veränderte Rollenverteilung, die Notwendigkeit einer neuen Bewertung von Arbeit und die Herausforderungen und Veränderungen im Kontext der Geschlechterrollen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind Geschlechterrollen, Hausarbeit, Männer, Familie, Sozialisation, Geschlechter-Arrangements, gesellschaftlicher Wandel, Arbeitsteilung, Egalität und Pfau-Effinger.
- Quote paper
- Anna Eckert (Author), 2002, Männer und Hausarbeit: Ein Wandel in der deutschen Familie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15060