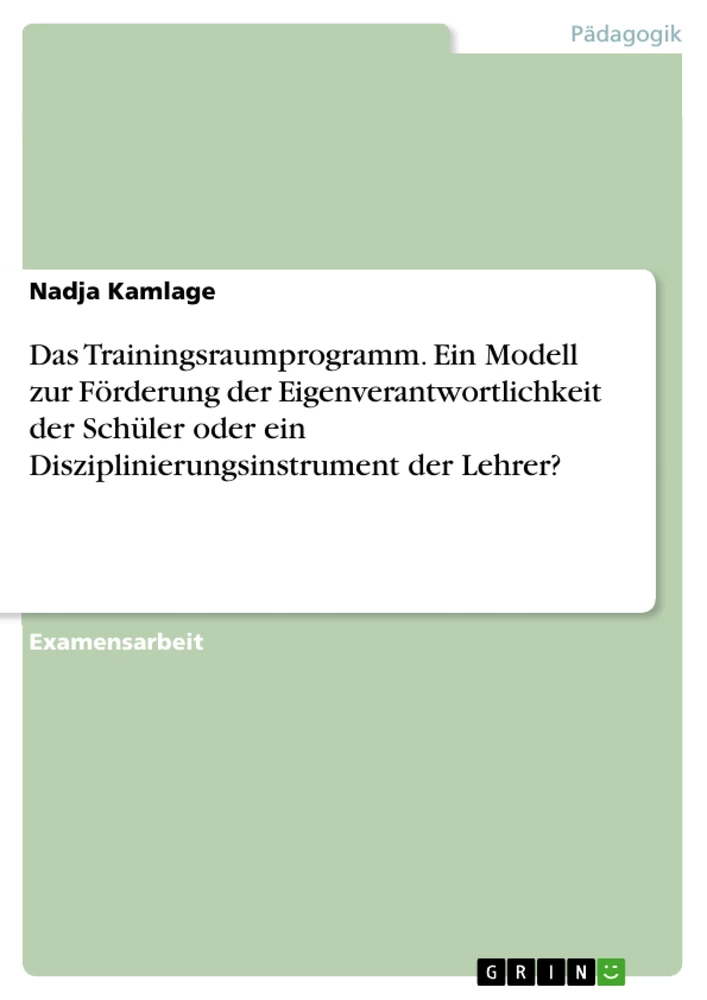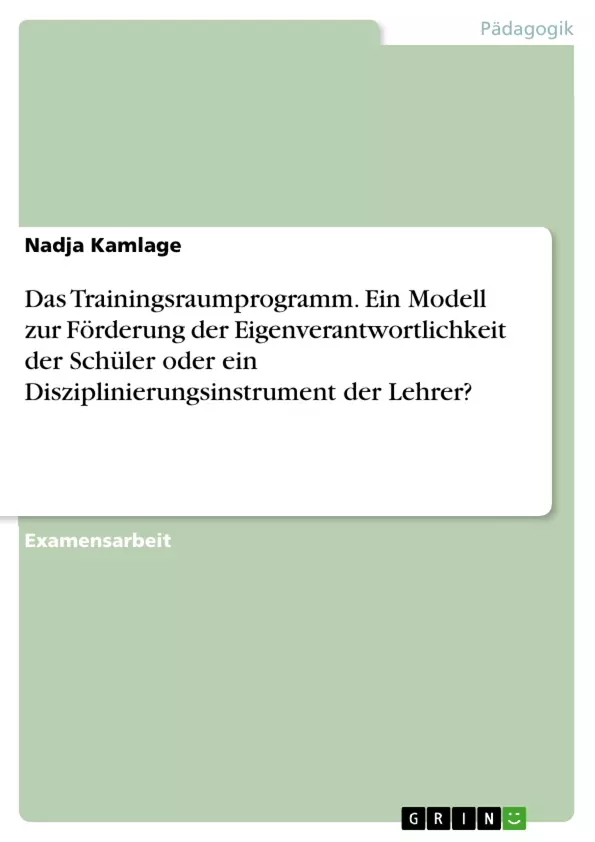Das Trainingsraumprogramm ist ein Konzept für Schulen, das den Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplinproblemen erleichtern will und die Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt zu mehr Eigenverantwortung und Respekt gegenüber anderen bringen soll. Dieses Konzept findet in deutschen Schulen immer mehr Anhänger, sodass mittlerweile deutschlandweit über 100 Schulen mit diesem Programm arbeiten und ein Ende dieses Trends nicht absehbar ist.
In der hier vorliegenden Arbeit möchte ich mich der kontrovers geführten Diskussion um das Trainingsraumprogramm zuwenden. Zuerst werde ich die für die Debatte um das Trainingsraumprogramm grundlegenden Begriffe Eigenverantwortung und Disziplin erläutern. Im dritten Kapitel werde ich auf die amerikanischen Wurzeln des Konzepts eingehen, um dann im nächsten Kapitel den Blick auf Deutschland zu richten. Hier geht es um die Konzepte von Stefan Balke und Heidrun Bründel und Erika Simon, mit denen an deutschen Schulen hauptsächlich gearbeitet wird. In diesem vierten Teil möchte ich auch die Ergebnisse empirischer Studien zum Trainingsraum darstellen, um einen Einblick in die Wirksamkeit dieses Programms zu geben. Im fünften Kapitel werden die möglichen Chancen und Stolpersteine des Trainingsraumprogramms fokussiert. Die leitenden Fragen hier sind:
Inwieweit ist das Trainingsraumprogramm geeignet, um eigenverantwortliches Denken und Handeln zu fördern?
Oder: Ist das Trainingsraumprogramm nur ein Disziplinierungsinstrument, das die Schüler zu Anpassung und Gehorsam zwingt, um damit den Lehrern den Schulalltag zu erleichtern?
Im empirischen Teil der Arbeit möchte ich von der Theorie zur Praxis, indem ich mir den Trainingsraum an zwei Schulen anschaue und mit Schülern und Lehrern dieser Schulen über das Programm und dessen Umsetzung spreche. Das Hauptaugenmerk liegt hier in der Erforschung der Einstellungen von Schülern zu diesem Programm. Um dies zu erreichen, werde ich in Gruppendiskussionen einige Schüler zu Wort kommen lassen, die Erfahrungen mit diesem Programm an ihrer Schule sammeln konnten. Die Ergebnisse dieser qualitativen Interviews sind nicht repräsentativ, sie stellen vielmehr mögliche Sichtweisen der Adressaten dieses Programms dar, die bisher zu wenig zu Wort gekommen sind und die der Diskussion um das Trainingsraumprogramm neue Impulse geben könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definitionen
- 2.1 Eigenverantwortung
- 2.2 Disziplin
- 3 Die Grundlagen des Trainingsraumkonzepts
- 3.1 Die „Perceptual Control Theory“ nach William T. Powers
- 3.2 Das „Responsible Thinking Program“ nach Edward E. Ford
- 4 Das Trainingsraumprogramm in Deutschland
- 4.1 Das Trainingsraumprogramm nach Stefan Balke
- 4.1.1 Die Problemlage: Unterrichtstörungen und Disziplinprobleme
- 4.1.2 Ziele und Prinzipien
- 4.1.3 Ablauf
- 4.2 Die Trainingsraum-Methode nach Heidrun Bründel und Erika Simon
- 4.2.1 Grundgedanken
- 4.2.2 Ablauf
- 4.3 Kritische Vergleich
- 4.4 Ergebnisse empirischer Untersuchungen
- 5 Geeignetes Mittel zur Förderung von Eigenverantwortung oder Disziplinierungsinstrument? Zur aktuellen Diskussion über das Trainingsraumprogramms
- 5.1 Die Förderung von eigenverantwortlichem Denken und Handeln
- 5.2 Das Trainingsraumprogramm als Disziplinierungsinstrument
- 5.3 Zwischenfazit
- 6 Empirische Untersuchung: Das Trainingsraumprogramm im Schülerurteil
- 6.1 Die Vorgehensweise bei der Datenerhebung
- 6.2 Die Interviews an einer Gesamtschule
- 6.3 Die Interviews an einer Haupt- und Realschule
- 6.4 Vergleich und Diskussion der Ergebnisse
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Trainingsraumprogramm an deutschen Schulen. Ziel ist es, die kontroverse Diskussion um seine Funktion als Förderinstrument für Eigenverantwortung oder als Disziplinierungsmaßnahme zu beleuchten. Die Arbeit analysiert theoretische Grundlagen und integriert empirische Schülerperspektiven, um ein differenziertes Bild zu zeichnen.
- Das Trainingsraumprogramm: Förderung von Eigenverantwortung oder Disziplinierung?
- Theoretische Grundlagen des Trainingsraumkonzepts (Perceptual Control Theory, Responsible Thinking Program)
- Vergleich verschiedener Trainingsraum-Modelle in Deutschland (Balke, Bründel/Simon)
- Auswertung empirischer Studien zur Wirksamkeit des Programms
- Schülerperspektiven auf das Trainingsraumprogramm
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Trainingsraumprogramms ein, stellt die kontroverse Debatte zwischen Befürwortern und Kritikern dar und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie beleuchtet die zunehmende Verbreitung des Programms in deutschen Schulen und die gegensätzlichen Interpretationen seiner Wirkung auf Schüler und das Schulklima. Die Autorin kündigt an, sowohl theoretische Ansätze zu diskutieren als auch die Perspektive der Schüler durch empirische Forschung zu integrieren, um dem Mangel an Schülersicht in bisherigen Evaluationen entgegenzuwirken.
2 Definitionen: Dieses Kapitel widmet sich der Klärung der zentralen Begriffe "Eigenverantwortung" und "Disziplin". Da eine einheitliche Definition in der Literatur fehlt, werden die Auffassungen von Balke und Bründel/Simon herangezogen und miteinander verglichen. Der Begriff der Eigenverantwortung wird im Kontext der Selbsterziehung diskutiert, um ein umfassenderes Verständnis zu ermöglichen.
3 Die Grundlagen des Trainingsraumkonzepts: Dieses Kapitel erörtert die amerikanischen Wurzeln des Trainingsraumprogramms. Es werden die "Perceptual Control Theory" von William T. Powers und das "Responsible Thinking Program" von Edward E. Ford als grundlegende theoretische Ansätze vorgestellt und ihre Relevanz für das Verständnis des Trainingsraumkonzepts herausgearbeitet. Die Kapitel analysiert die theoretischen Grundlagen des Programms, um den Lesern ein tiefgreifendes Verständnis seiner Konzeption zu vermitteln.
4 Das Trainingsraumprogramm in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Modelle des Trainingsraumprogramms in Deutschland, insbesondere die Ansätze von Stefan Balke und Heidrun Bründel/Erika Simon. Es werden die jeweiligen Problemlagen, Ziele, Prinzipien und Abläufe detailliert dargestellt und kritisch verglichen. Zusätzlich werden Ergebnisse empirischer Studien zur Wirksamkeit des Programms präsentiert, um die Diskussion um seine Effektivität zu beleuchten.
5 Geeignetes Mittel zur Förderung von Eigenverantwortung oder Disziplinierungsinstrument?: In diesem Kapitel wird die zentrale Forschungsfrage der Arbeit diskutiert: Ist das Trainingsraumprogramm ein geeignetes Mittel zur Förderung von Eigenverantwortung oder dient es lediglich als Disziplinierungsinstrument? Die Autorin beleuchtet die Argumente beider Seiten und analysiert die Förderung eigenverantwortlichen Denkens und Handelns ebenso wie die Kritik an Anpassungs- und Konformitätsdruck. Es wird ein Zwischenfazit gezogen, das die Komplexität der Thematik hervorhebt.
6 Empirische Untersuchung: Das Trainingsraumprogramm im Schülerurteil: Das Kapitel beschreibt eine empirische Untersuchung, die die Schülerperspektive auf das Trainingsraumprogramm erfasst. Die Vorgehensweise bei der Datenerhebung (Gruppendiskussionen an verschiedenen Schulformen) wird detailliert erläutert. Die Ergebnisse der Interviews werden präsentiert und diskutiert, um Einblicke in die unterschiedlichen Schülererfahrungen und -meinungen zu geben.
Häufig gestellte Fragen zum Trainingsraumprogramm an deutschen Schulen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Trainingsraumprogramm an deutschen Schulen und beleuchtet die kontroverse Diskussion um seine Funktion: Fördert es Eigenverantwortung oder dient es primär als Disziplinierungsmaßnahme? Die Analyse umfasst theoretische Grundlagen, vergleicht verschiedene Modelle des Programms und integriert empirische Schülerperspektiven.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die "Perceptual Control Theory" von William T. Powers und das "Responsible Thinking Program" von Edward E. Ford als theoretische Grundlagen des Trainingsraumkonzepts. Diese amerikanischen Ansätze werden im Kontext der deutschen Implementierung des Programms erläutert.
Welche Modelle des Trainingsraumprogramms werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ansätze von Stefan Balke und Heidrun Bründel/Erika Simon. Die jeweiligen Problemlagen, Ziele, Prinzipien und Abläufe der Programme werden detailliert dargestellt und kritisch gegenübergestellt.
Welche empirischen Daten werden verwendet?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse empirischer Studien zur Wirksamkeit des Trainingsraumprogramms. Darüber hinaus werden eigene empirische Daten aus Schülerinterviews an einer Gesamtschule und einer Haupt- und Realschule vorgestellt und analysiert, um die Schülerperspektive zu beleuchten.
Wie wird die Schülerperspektive berücksichtigt?
Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die Einbeziehung der Schülerperspektive. Durch Gruppendiskussionen an verschiedenen Schulformen werden Schülermeinungen und -erfahrungen mit dem Trainingsraumprogramm erfasst und analysiert. Dies dient dazu, die bisherige Forschungslage, die oft wenig Schülerperspektiven berücksichtigte, zu ergänzen.
Welche zentrale Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ist das Trainingsraumprogramm ein geeignetes Mittel zur Förderung von Eigenverantwortung oder dient es lediglich als Disziplinierungsinstrument? Die Arbeit untersucht die Argumente beider Seiten und beleuchtet die Komplexität dieser Thematik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definitionen (Eigenverantwortung und Disziplin), Grundlagen des Trainingsraumkonzepts, Das Trainingsraumprogramm in Deutschland (mit Vergleich der Modelle Balke und Bründel/Simon und Auswertung empirischer Studien), Das Trainingsraumprogramm: Förderung von Eigenverantwortung oder Disziplinierungsinstrument?, Empirische Untersuchung (Schülerinterviews), Fazit.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse der theoretischen Analyse und der empirischen Untersuchung zusammen und gibt eine umfassende Einschätzung des Trainingsraumprogramms, seiner Stärken und Schwächen, sowie seiner Wirkung auf Schüler und Schulklima.
- Citar trabajo
- Nadja Kamlage (Autor), 2008, Das Trainingsraumprogramm. Ein Modell zur Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Schüler oder ein Disziplinierungsinstrument der Lehrer?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150639