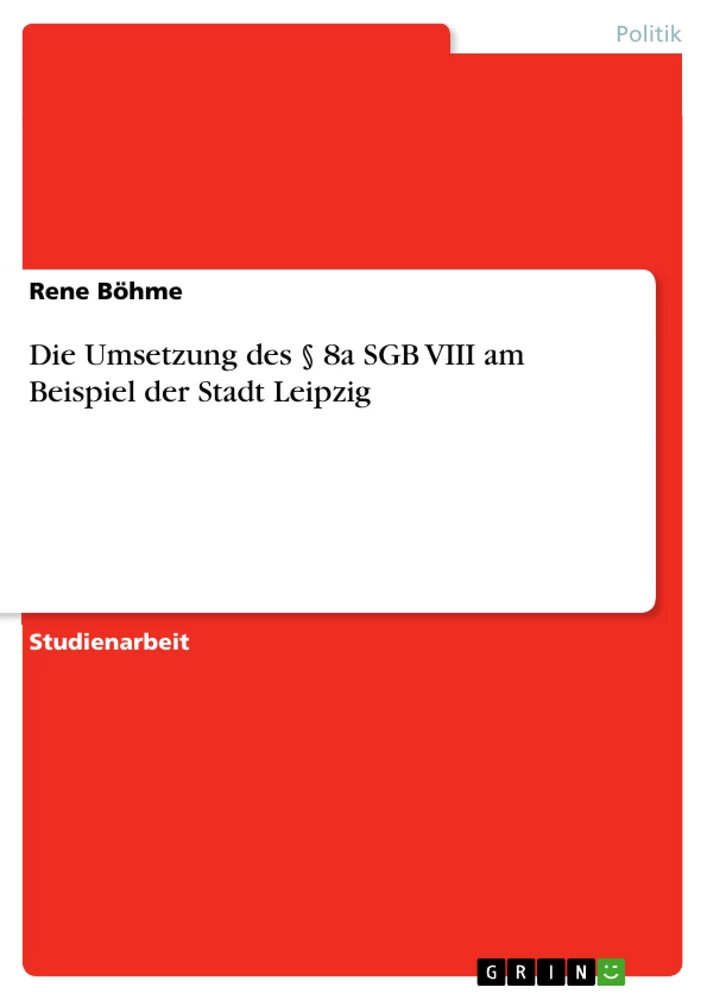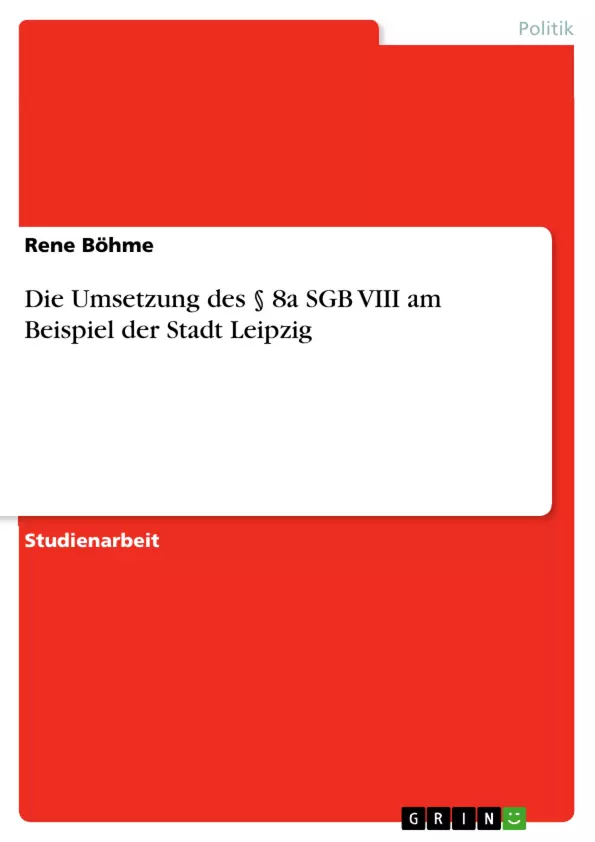Die Hausarbeit erläutert die Vorgaben des neu eingeführten §8a SGB VIII (Kinderschutzparagraf) und untersucht dessen Umsetzung in Leipzig.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- 3. Rahmenbedingungen des § 8a SGB VIII
- 3.1 Anlass und Zielsetzung
- 3.2 Bedeutung und Kritik
- 3.3 Komplexität des Schutzauftrags
- 4. Kerninhalte des § 8a SGB VIII
- 4.1 Standardisierung des Verfahrens zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos
- 4.1.1 Informationsgewinnung
- 4.1.2 Einschätzung zur Kindeswohlgefährdung im Fachteam
- 4.1.3 Mitwirkung und Beteiligung
- 4.1.4 Hilfeangebot
- 4.2 Vereinbarungen mit Trägern der freien Jugendhilfe
- 4.2.1 Inhalte und Auswirkungen vertraglicher Regelungen
- 4.2.2 Herausforderungen und Chancen erfolgreicher Kooperationen
- 4.2.3 Datenschutz
- 4.1 Standardisierung des Verfahrens zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos
- 5. Umsetzungsanalyse am Beispiel Leipzigs
- 5.1 Analysefragen
- 5.2 Beispiel Leipzig: Umsetzung, Vergleich und Bewertung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Umsetzung des § 8a SGB VIII im Bereich des Kinderschutzes. Der Fokus liegt auf der Standardisierung des Verfahrens zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos sowie auf der Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe. Die Arbeit untersucht, wie die neuen Regelungen in der Praxis umgesetzt werden und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus ergeben.
- Standardisierung des Verfahrens zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe
- Umsetzungsanalyse am Beispiel der Stadt Leipzig
- Herausforderungen und Chancen der Umsetzung
- Rechtliche Rahmenbedingungen des § 8a SGB VIII
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert den Hintergrund des § 8a SGB VIII. Kapitel zwei behandelt das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) und seine Bedeutung für den Kinderschutz. Kapitel drei analysiert die Rahmenbedingungen des § 8a SGB VIII, darunter Anlass, Zielsetzung und Bedeutung des Schutzauftrags. Kapitel vier beleuchtet die Kerninhalte des § 8a SGB VIII, insbesondere die Standardisierung des Verfahrens zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos und die Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe. Kapitel fünf untersucht die Umsetzung des § 8a SGB VIII am Beispiel der Stadt Leipzig. Das sechste Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung, § 8a SGB VIII, Standardisierung, Verfahrensablauf, Kooperation, freie Jugendhilfe, Umsetzung, Analyse, Stadt Leipzig, Jugendamt, Datenschutz, Rechtssystem, Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK), Schutzauftrag.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der § 8a SGB VIII?
Der sogenannte Kinderschutzparagraf regelt den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Er legt fest, wie Jugendämter und freie Träger bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Gefährdung vorgehen müssen.
Wie wird das Gefährdungsrisiko abgeschätzt?
Das Verfahren umfasst die Informationsgewinnung, die Einschätzung im Fachteam unter Einbeziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft sowie die Beteiligung der Sorgeberechtigten und des Kindes.
Wie setzt die Stadt Leipzig den Kinderschutz um?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Abläufe und Kooperationsvereinbarungen in Leipzig und bewertet, wie die gesetzlichen Standards in der lokalen Praxis des Jugendamtes angewendet werden.
Welche Rolle spielen freie Träger der Jugendhilfe?
Freie Träger müssen mit dem öffentlichen Träger (Jugendamt) Vereinbarungen treffen, die sicherstellen, dass sie den Schutzauftrag nach § 8a fachlich und personell erfüllen können.
Was bedeutet „KICK“ im Zusammenhang mit dem SGB VIII?
KICK steht für das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz, durch welches der § 8a SGB VIII eingeführt wurde, um den staatlichen Schutzauftrag zu präzisieren.
- Quote paper
- Dipl. Sozpäd./Sozarb. (FH) Rene Böhme (Author), 2009, Die Umsetzung des § 8a SGB VIII am Beispiel der Stadt Leipzig, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150678