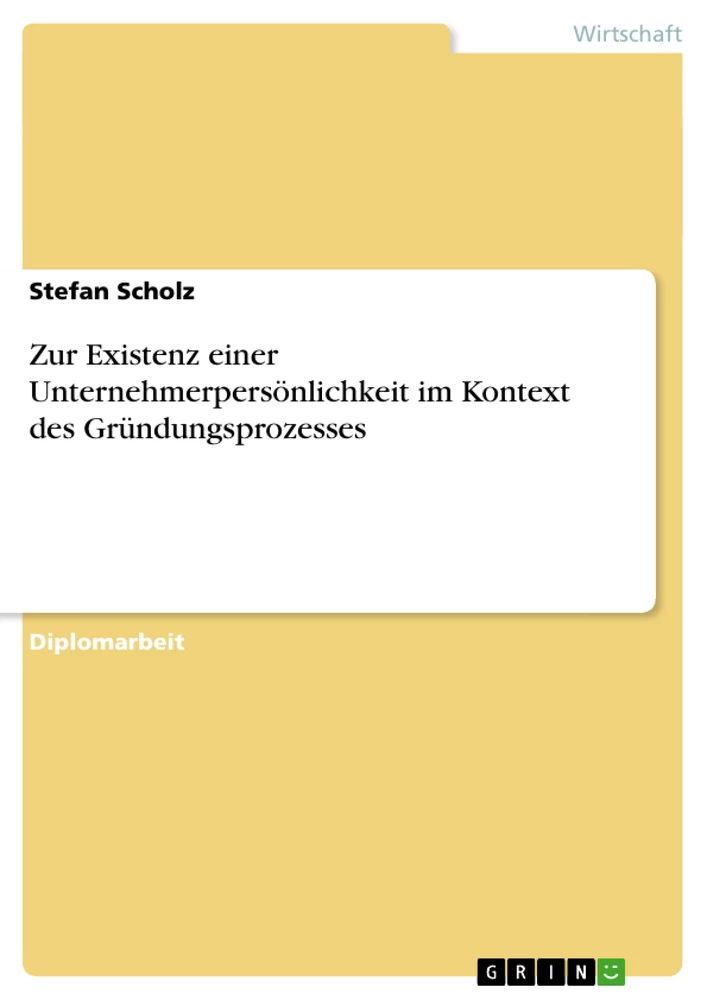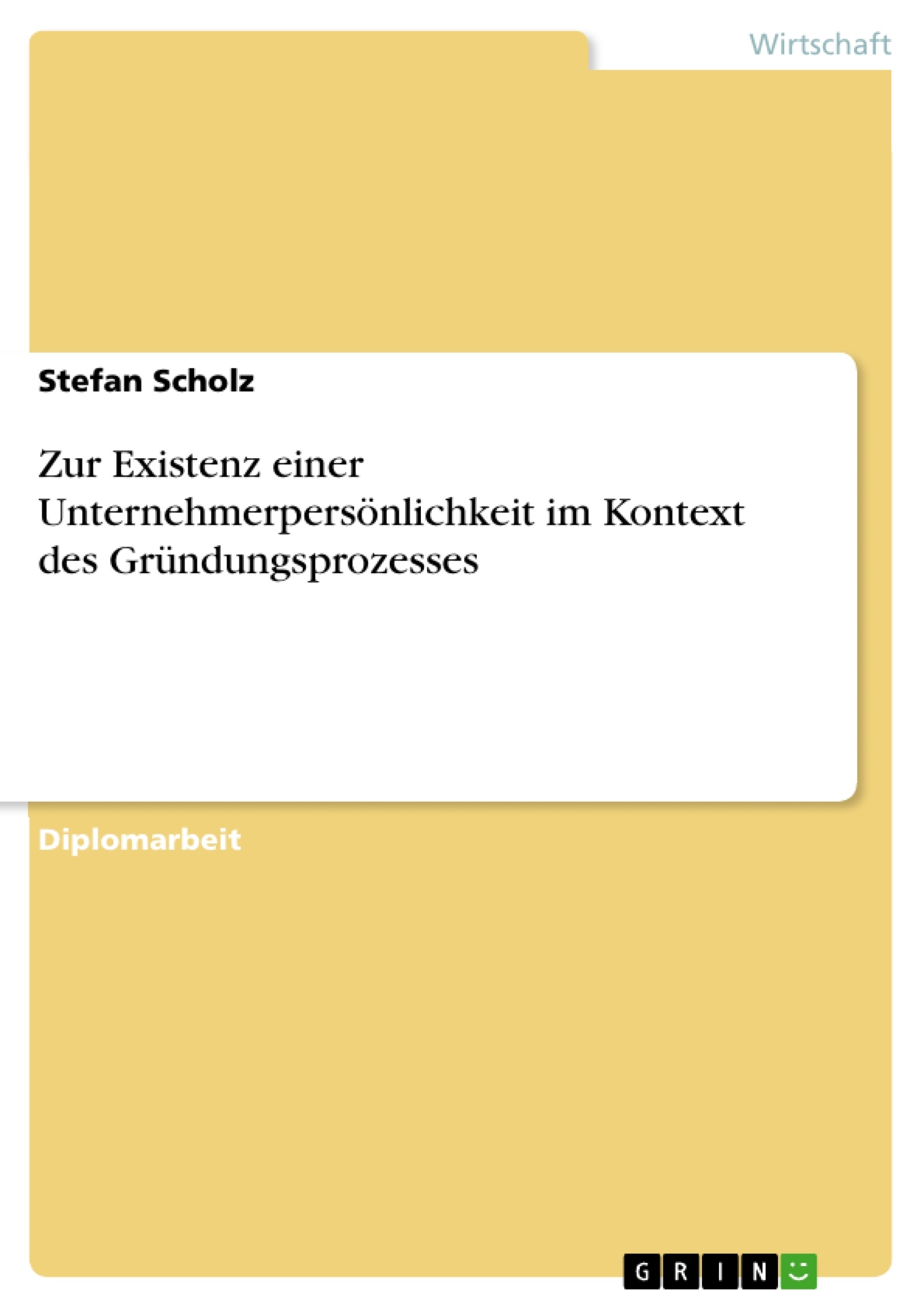Kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) kommt bei Wirtschaftswachstum
und der Schaffung neuer Arbeitsplätze eine besondere Bedeutung zu
(Frese/Chell/Klandt, 2000, S. 3). Dies gilt insbesondere für Unternehmen innovativer
Hochleistungstechnologien (Audretsch, 2002, S. 1221; Licht/Nerlinger, 1997,
S. 203). Insgesamt 99 % aller deutschen Unternehmen zählen zum Kreis des Mittelstandes,
fast 70 % der verfügbaren Arbeitsplätze können diese Unternehmen
auf sich vereinigen (BMWi, 1997, S. 16).
Shane (1996, S. 747) zeigt, dass 80 % aller neu geschaffenen Stellen auf Neugründungen
zurückzuführen sind. Eine direkte Korrelation zwischen Arbeitslosenquote
und unternehmerischer Aktivität wurde zudem in einer multinationalen
Studie direkt nachgewiesen (Bögenhold/Staber, 1990).
Unternehmertum kann somit als eines der zentralen Aspekte zur Lösung der wirtschaftlichen
und sozialen Herausforderungen angesehen werden (Stewart, 1996,
S. 3). Doch wie entsteht Unternehmertum? Welche Voraussetzungen stimulieren
Erfolg versprechende Gründungsaktivitäten? Die Forschung der letzten vierzig Jahre hat gezeigt, dass ein Zusammenspiel psychologischer,
soziologischer, demographischer und wirtschaftlicher Aspekte bei
der Beantwortung beider Fragen zu berücksichtigen ist (u. a. Hisrich, 2000, S. 93;
Stewart, 1996, S. 6; Cunningham/Lischeron, 1991, S. 46; Sexton/Bowman, 1985,
S. 138). Die Gründung eines Unternehmens ist zudem mit hohen finanziellen, gesellschaftlichen
und beruflichen Risiken verbunden (Brockhaus, 1982, S. 46).
Zentrales Element innerhalb dieses Prozesses ist und bleibt deshalb der Unternehmer
selbst (vgl. Cromie/O‘Donaghue,1992, S. 66).
Dies wirft die Frage auf, wie der potentielle Unternehmer agiert, wie er denkt,
letztlich, welche spezifische Persönlichkeitsstruktur er aufweist, und ob diese in
allgemeiner Form überhaupt existiert. Ist es zudem sinnvoll und notwendig, den
Unternehmer zu begreifen, um den Unternehmensgründungsprozess zu verstehen
und zu beeinflussen?
[...]
1 Audretsch (2002, S. 111) ermittelt in eigenen Studien, dass kleine- und mittelständische Hochtechnologiefirmen die
treibende Kraft bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Unternehmerdefinition - eine Abgrenzung
- 3. Theorien zur Unternehmerpersönlichkeit
- 3.1 Erkenntnisse der allgemeinen Persönlichkeitspsychologie
- 3.1.1 Persönlichkeit und Persönlichkeitsmerkmale
- 3.1.2 Konsistenz im Verhalten
- 3.2 Unternehmerbezogene Persönlichkeitsforschung
- 3.2.1 Merkmalsorientierter Forschungsansatz (trait approach)
- 3.2.1.1 Persönlichkeitsmerkmale des Unternehmers - ein Portfolio
- 3.2.1.2 Kritische Bemerkungen und Empfehlungen
- 3.2.1.3 Abschlussbemerkung
- 3.2.2 Dynamisch-prozessualer Ansatz
- 3.2.3 Weitere Forschungsschwerpunkte - eine Auswahl
- 3.2.3.1 Situativ-interaktive Sichtweise des Attitude-Approach
- 3.2.3.2 Typologische Forschungsansätze
- 3.2.3.3 Unternehmerische Orientierung und ihre Beziehung zur Unternehmerpersönlichkeit
- 3.3 Demographische Einflüsse
- 4. Ein integratives Gesamtmodell zur Evidenz der unternehmerischen Persönlichkeit
- 4.1 Der Unternehmer und sein Umfeld
- 4.2 Modell der unternehmerischen Disposition
- 4.2.1 Persönlichkeit
- 4.2.2 Umwelt
- 4.2.3 Situative Wahrnehmung
- 4.2.4 Einflussnahme und Wirkungsbereich
- 4.2.5 Auslösendes Ereignis, Intention und Gründungsaktivität
- 5. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Existenz einer Unternehmerpersönlichkeit im Kontext des Gründungsprozesses. Ziel ist es, verschiedene Theorien und Forschungsansätze zur Unternehmerpersönlichkeit zu analysieren und ein integratives Modell zu entwickeln. Die Arbeit beleuchtet dabei den Einfluss verschiedener Faktoren auf die unternehmerische Persönlichkeit.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Unternehmerpersönlichkeit"
- Analyse verschiedener Theorien und Forschungsansätze zur Unternehmerpersönlichkeit
- Der Einfluss demografischer Faktoren auf die unternehmerische Persönlichkeit
- Entwicklung eines integrativen Modells zur Beschreibung der unternehmerischen Persönlichkeit
- Beziehung zwischen Persönlichkeit, Umfeld und Gründungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Unternehmerpersönlichkeit ein und beschreibt die Motivation und Vorgehensweise der Arbeit. Es legt den Fokus auf die Forschungslücke und die Relevanz des Themas für das Verständnis von Gründungsprozessen.
2. Unternehmerdefinition - eine Abgrenzung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Unternehmerpersönlichkeit" und grenzt ihn von verwandten Konzepten ab. Es analysiert verschiedene Definitionen und diskutiert die Herausforderungen bei der eindeutigen Bestimmung des Begriffs. Es schafft eine solide Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema im Kontext der Arbeit.
3. Theorien zur Unternehmerpersönlichkeit: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Theorien und Forschungsansätze zur Unternehmerpersönlichkeit. Es werden sowohl merkmalsorientierte als auch dynamisch-prozessuale Ansätze diskutiert, inklusive der Berücksichtigung demografischer Einflüsse. Es werden wichtige Persönlichkeitsmerkmale wie Leistungsmotiv, Risikobereitschaft und Ambiguitätstoleranz im Detail behandelt und deren Bedeutung für das unternehmerische Handeln erläutert. Die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Forschungsansätzen und die Einordnung verschiedener Modelle bilden den Kern dieses Kapitels. Es werden Stärken und Schwächen der verschiedenen Modelle aufgezeigt, was zu einem differenzierten Verständnis der Thematik beiträgt. Die Einbeziehung demographischer Faktoren erweitert den Blickwinkel und berücksichtigt die Komplexität des Phänomens.
4. Ein integratives Gesamtmodell zur Evidenz der unternehmerischen Persönlichkeit: Dieses Kapitel präsentiert ein integratives Modell, welches die Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln zusammenführt und versucht, den Einfluss von Persönlichkeit, Umwelt und Situation auf die unternehmerische Aktivität zu erklären. Das Modell berücksichtigt die Interaktion zwischen Persönlichkeitsmerkmalen, dem Umfeld des Unternehmers und der situativen Wahrnehmung, um ein umfassenderes Bild des Gründungsprozesses zu zeichnen. Es werden die einzelnen Komponenten des Modells detailliert erläutert und ihre Zusammenhänge dargestellt, wobei der Fokus auf der Wechselwirkung der Faktoren liegt und nicht nur auf einzelnen Aspekten. Die Bedeutung des auslösenden Ereignisses und der Intention für die Gründungsaktivität wird ebenfalls hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Unternehmerpersönlichkeit, Gründungsprozess, Persönlichkeitspsychologie, Unternehmertum, Leistungsmotiv, Risikobereitschaft, Ambiguitätstoleranz, integratives Modell, demografische Einflüsse, situative Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Unternehmerpersönlichkeit im Gründungsprozess
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Existenz einer Unternehmerpersönlichkeit im Kontext des Gründungsprozesses. Sie analysiert verschiedene Theorien und Forschungsansätze zur Unternehmerpersönlichkeit und entwickelt ein integratives Modell, um den Einfluss verschiedener Faktoren auf die unternehmerische Persönlichkeit zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung des Begriffs "Unternehmerpersönlichkeit", Analyse verschiedener Theorien und Forschungsansätze (merkmalsorientierte und dynamisch-prozessuale Ansätze), den Einfluss demografischer Faktoren, die Entwicklung eines integrativen Modells zur Beschreibung der unternehmerischen Persönlichkeit und die Beziehung zwischen Persönlichkeit, Umfeld und Gründungsprozess.
Welche Theorien und Ansätze zur Unternehmerpersönlichkeit werden analysiert?
Die Arbeit analysiert sowohl merkmalsorientierte (trait approach) als auch dynamisch-prozessuale Ansätze. Im merkmalsorientierten Ansatz werden Persönlichkeitsmerkmale wie Leistungsmotiv, Risikobereitschaft und Ambiguitätstoleranz untersucht. Der dynamisch-prozessuale Ansatz betrachtet die Entwicklung der Persönlichkeit im Laufe des Gründungsprozesses. Zusätzlich werden situativ-interaktive Sichtweisen und typologische Forschungsansätze berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Einleitung (Motivation und Vorgehensweise), Definition und Abgrenzung des Begriffs "Unternehmer", Theorien zur Unternehmerpersönlichkeit (inkl. demografischer Einflüsse), ein integratives Gesamtmodell zur unternehmerischen Persönlichkeit und Schlussbetrachtungen. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse zusammen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines integrativen Modells, das den Einfluss von Persönlichkeit, Umwelt und Situation auf die unternehmerische Aktivität erklärt. Dieses Modell soll ein umfassenderes Verständnis des Gründungsprozesses ermöglichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Unternehmerpersönlichkeit, Gründungsprozess, Persönlichkeitspsychologie, Unternehmertum, Leistungsmotiv, Risikobereitschaft, Ambiguitätstoleranz, integratives Modell, demografische Einflüsse und situative Wahrnehmung.
Welche Forschungslücke wird die Arbeit schließen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die bestehenden Theorien und Ansätze zur Unternehmerpersönlichkeit zu integrieren und ein umfassenderes Modell zu entwickeln, das die Interaktion zwischen Persönlichkeit, Umfeld und Situation berücksichtigt. Dies schließt eine Forschungslücke durch die Entwicklung eines ganzheitlicheren Verständnisses des Gründungsprozesses.
Wie wird das integrative Modell aufgebaut?
Das integrative Modell berücksichtigt die Interaktion zwischen Persönlichkeitsmerkmalen, dem Umfeld des Unternehmers und der situativen Wahrnehmung. Es umfasst Aspekte wie Persönlichkeit, Umwelt, situative Wahrnehmung, Einflussnahme und Wirkungsbereich sowie das auslösende Ereignis, die Intention und die Gründungsaktivität.
- Citation du texte
- Stefan Scholz (Auteur), 2002, Zur Existenz einer Unternehmerpersönlichkeit im Kontext des Gründungsprozesses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15071