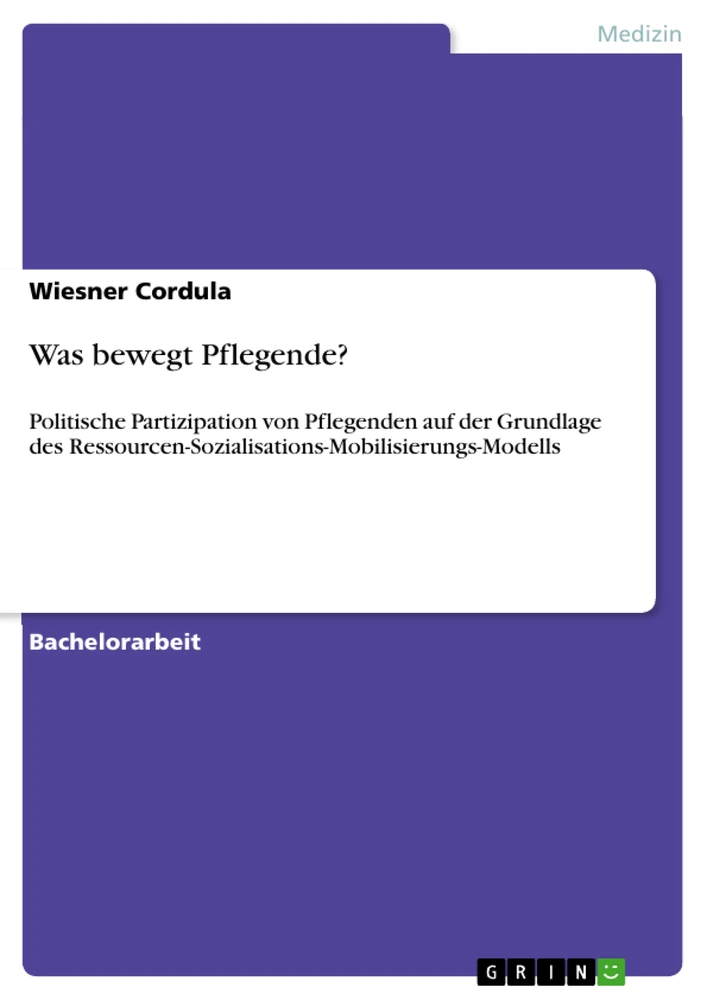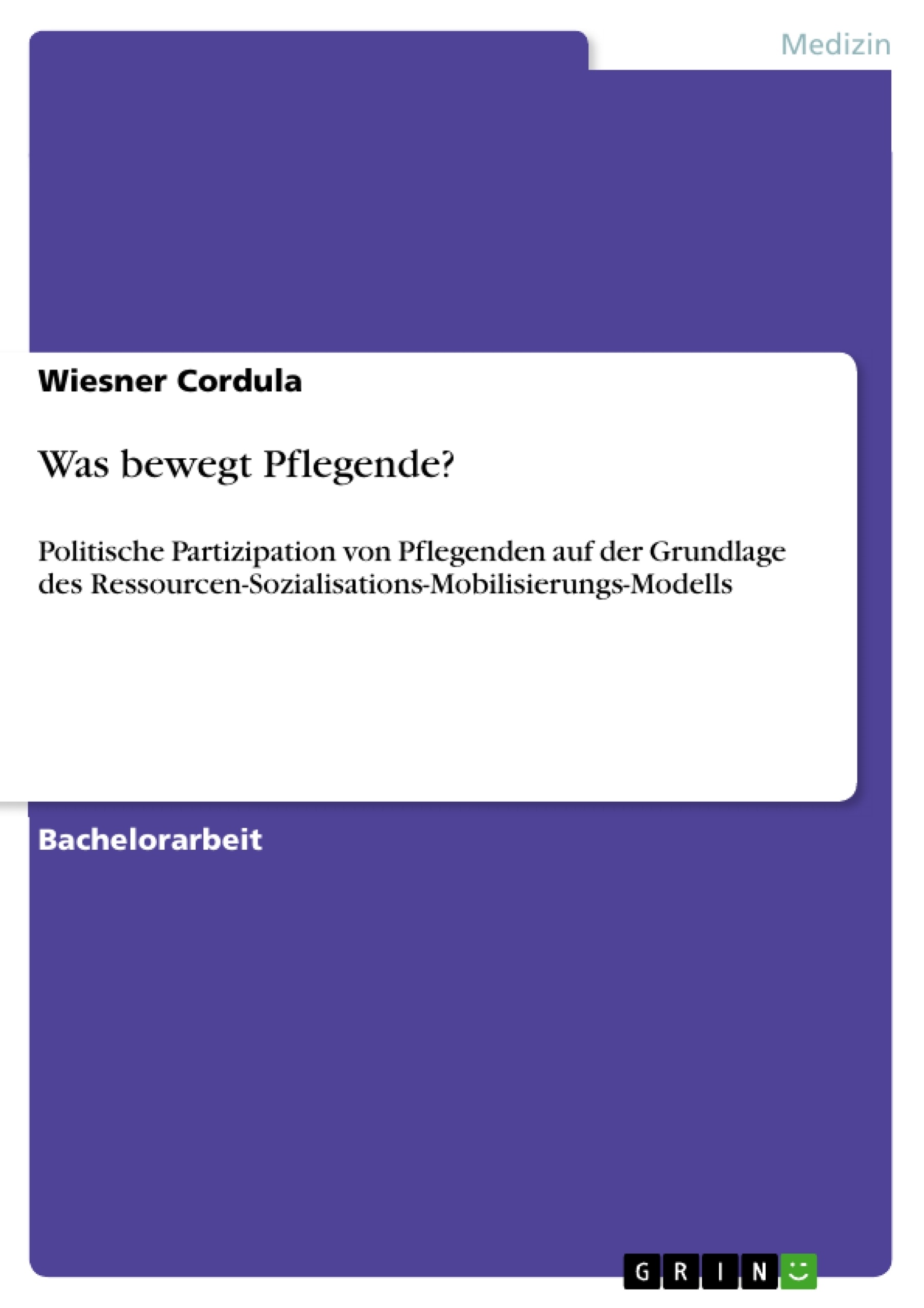Im Rahmen dieser Arbeit sollen zunächst, politische Partizipation definiert und die Faktoren, welche politische Partizipation beeinflussen erörtert werden. Des Weiteren werde ich wissenschaftliche Ansätze zur Erklärung politischer Partizipation
darstellen. Das Ressourcen-Sozialisations-Mobilisierungs-Modell von Verba, Schlozman und Brady (1995) soll mir dabei als Grundlage für die Analyse der politischen Teilhabe von beruflich Pflegenden dienen, mit dem Ziel die politische Partizipation von Pflegenden anhand der bestimmenden Faktoren des Modells zu erläutern und mögliche Handlungsstrategien abzuleiten. Daher folgt der Aufbau meiner Ausführungen der Struktur des verwendeten Modelles und gliedert sich in die Betrachtung der partizipationsbeeinflussenden Determinanten politische Motive, Ressourcen und soziale Netzwerke. Meine Ausführungen beschränken
sich auf die Analyse von Gesundheits- und Krankenpflegern in Abgrenzung zu anderen Pflegeberufen, wie z. B. der Kinderkranken- oder Altenpflege.
Diese Einschränkung erfolgt, aufgrund der formalen Vorgaben zur
Erstellung einer Bachelor-Thesis. Des Weiteren liegen zur Arbeits- und Lebenssituation der Gesundheits- und Krankenpfleger unter der Perspektive der politischen Partizipation umfangreichere und aussagekräftigere Daten vor. Des Weiteren
betrachte ich deutsche Pflegende ohne Migrationshintergrund. Bei
Migrationshintergrund liegen für die politische Partizipation entscheidende veränderte Bedingungen vor (Wissen, Sozialisation), die eine Eigenständige Untersuchung bedürfen.
Die Lebens- und Arbeitssituation, der historische Kontext und die aktuelle berufspolitische Interessenvertretung Pflegender beziehe ich in die Analyse mit ein.
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit werde ich die Faktoren analysieren, welche auf die politische Partizipation von Pflegenden Einfluss nehmen. Im Besonderen betrachte ich die Partizipation innerhalb berufspolitischer institutioneller Interessenvertretungen, wie z. B. die Mitgliedschaft in einem Berufsverband, Im Bewusstsein, das für diese Mitgliedschaft auch Motivationen unpolitischer Art in Frage kommen (Versicherungsschutz, Fachzeitschrift), gehe ich im Folgenden von einer politischen Motivation aus. Diese Annahme gilt es jedoch in einer weiteren Untersuchung zu überprüfen. Des Weiteren lege ich die Annahme zugrunde, dass Pflegende, im Hinblick auf politische Partizipation, sich geschlechtstypisch verhalten. Auch dies gilt es in weiteren Untersuchungen zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Relevanz des Themas
- 1.2. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 1.3. Persönliche Motivation
- 2. Literatur und Methodik der Arbeit.
- 3. Theoretische und begriffliche Grundlagen...
- 3.1. Politische Partizipation
- 3.2. Partizipationsformen..
- 3.3. Determinanten politischer Partizipation.
- 3.4. Erklärungsmodelle zur politischen Partizipation
- 3.4.1. Rational-Choice-Ansatz
- 3.4.2. Behavioralismus......
- 4. Das Ressourcen-Sozialisations-Mobilisierungs-Modell nach Verba,
Schlozman und Brady (1995)......
- 4.1. Ressourcen
- 4.2. Motive...
- 4.3. Netzwerke
- 5. Rahmenbedingungen der politischen Partizipation beruflich Pflegender..
- 5.1. Berufsgeschichte unter der Perspektive der politischen Partizipation
- 5.2. Institutionelle Interessenvertretung und Organisationsgrad...
- 5.3. Lebenslage und Arbeitssituation beruflich Pflegender
- 6. Analyse der politischen Teilhabe von beruflich Pflegenden anhand des Ressourcen-
Sozialisations-Mobilisierungs-Modells nach Verba, Schlozmann und Brady (1995)..
- 6.1. Ressourcen
- 6.1.1. Zeit
- 6.1.2. Einkommen
- 6.1.3. Bürgerliche Fähigkeiten
- 6.2. Motive.....
- 6.2.1. Politisches Interesse
- 6.2.2. Vertrauen in die Wirksamkeit des politischen Handelns.
- 6.2.3. Politisches Wissen
- 6.2.4. Parteiidentifikation...
- 6.2.5. Bürgerliche Einstellungen
- 6.3. Netzwerke
- 6.3.1. Primäre familiäre Netzwerke..
- 6.3.2. Sekundäre öffentliche Netzwerke..
- 6.4. Interpretation der Daten.....
- 6.1. Ressourcen
- 7. Schlussfolgerungen.
- 7.1. Zusammenfassung..
- 7.2. Fazit..
- 8. Evaluation.
- 8.1. Rückblick
- 8.2. Ausblick.
- 9. Literaturverzeichnis..
- 10. Anhang.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert die politische Partizipation von Pflegenden im Kontext des Professionalisierungsprozesses der Pflege. Im Zentrum steht das Ressourcen-Sozialisations-Mobilisierungs-Modell von Verba, Schlozman und Brady (1995), welches die determinierenden Faktoren für politische Partizipation untersucht. Ziel der Arbeit ist es, die politische Teilhabe von Pflegenden anhand dieses Modells zu erläutern und Handlungsstrategien abzuleiten.
- Die Relevanz des Themas liegt in der aktuellen Diskussion über den Professionalisierungsprozess der Pflege, der von einer stärkeren politischen Präsenz der Pflegefachkräfte abhängig ist.
- Die Arbeit erörtert die theoretischen und begrifflichen Grundlagen der politischen Partizipation und stellt verschiedene Erklärungsmodelle vor.
- Es werden die Rahmenbedingungen der politischen Partizipation von Pflegenden unter Berücksichtigung ihrer Berufsgeschichte, Interessenvertretung und Lebenslage untersucht.
- Die Analyse der politischen Teilhabe von Pflegenden anhand des Ressourcen-Sozialisations-Mobilisierungs-Modells beleuchtet die Faktoren Ressourcen, Motive und soziale Netzwerke.
- Die Schlussfolgerungen der Arbeit sollen Handlungsempfehlungen für eine stärkere politische Partizipation von Pflegenden liefern.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der politischen Partizipation von Pflegenden im Kontext des Professionalisierungsprozesses und der aktuellen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen. Die Arbeit beschreibt ihre Zielsetzung und den Aufbau der Ausführungen. Kapitel 2 stellt die verwendeten Forschungsmethoden und die Literaturbasis dar. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den theoretischen und begrifflichen Grundlagen der politischen Partizipation und erläutert verschiedene Erklärungsmodelle wie den Rational-Choice-Ansatz und den Behavioralismus. Kapitel 4 stellt das Ressourcen-Sozialisations-Mobilisierungs-Modell nach Verba, Schlozman und Brady (1995) vor, welches die Analyse der politischen Partizipation von Pflegenden in den folgenden Kapiteln zugrunde liegt. Kapitel 5 untersucht die Rahmenbedingungen der politischen Partizipation von Pflegenden, indem es die Berufsgeschichte, die institutionelle Interessenvertretung und die Lebenslage der Pflegefachkräfte beleuchtet. Kapitel 6 analysiert die politische Teilhabe von Pflegenden anhand der drei Komponenten des Ressourcen-Sozialisations-Mobilisierungs-Modells: Ressourcen, Motive und soziale Netzwerke. Kapitel 7 fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die politische Partizipation von Pflegenden. Kapitel 8 bewertet die Arbeit im Rückblick und gibt einen Ausblick auf mögliche weitere Forschungsschwerpunkte.
Schlüsselwörter
Politische Partizipation, Pflege, Professionalisierung, Ressourcen-Sozialisations-Mobilisierungs-Modell, Interessenvertretung, Berufspolitik, Gesundheitspolitik, Sozialpolitik, Lebenslage, Arbeitssituation, Motivation, Netzwerke, Handlungsstrategien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Bachelorarbeit zur politischen Partizipation von Pflegenden?
Ziel ist es, die politische Teilhabe von beruflich Pflegenden anhand des Ressourcen-Sozialisations-Mobilisierungs-Modells zu analysieren und Handlungsstrategien abzuleiten.
Welches theoretische Modell bildet die Grundlage der Analyse?
Die Arbeit nutzt das Modell von Verba, Schlozman und Brady (1995), das Partizipation durch Ressourcen, Motive und soziale Netzwerke erklärt.
Welche spezifische Gruppe von Pflegenden wird untersucht?
Die Untersuchung beschränkt sich auf deutsche Gesundheits- und Krankenpfleger ohne Migrationshintergrund.
Welche Ressourcen sind für die politische Teilhabe entscheidend?
In der Analyse werden insbesondere die Faktoren Zeit, Einkommen und bürgerliche Fähigkeiten (Civic Skills) betrachtet.
Welche Rolle spielen Berufsverbände in der Arbeit?
Die Mitgliedschaft in Berufsverbänden wird als eine Form der institutionellen Interessenvertretung und als Indikator für politische Motivation untersucht.
- Arbeit zitieren
- Wiesner Cordula (Autor:in), 2009, Was bewegt Pflegende?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150733