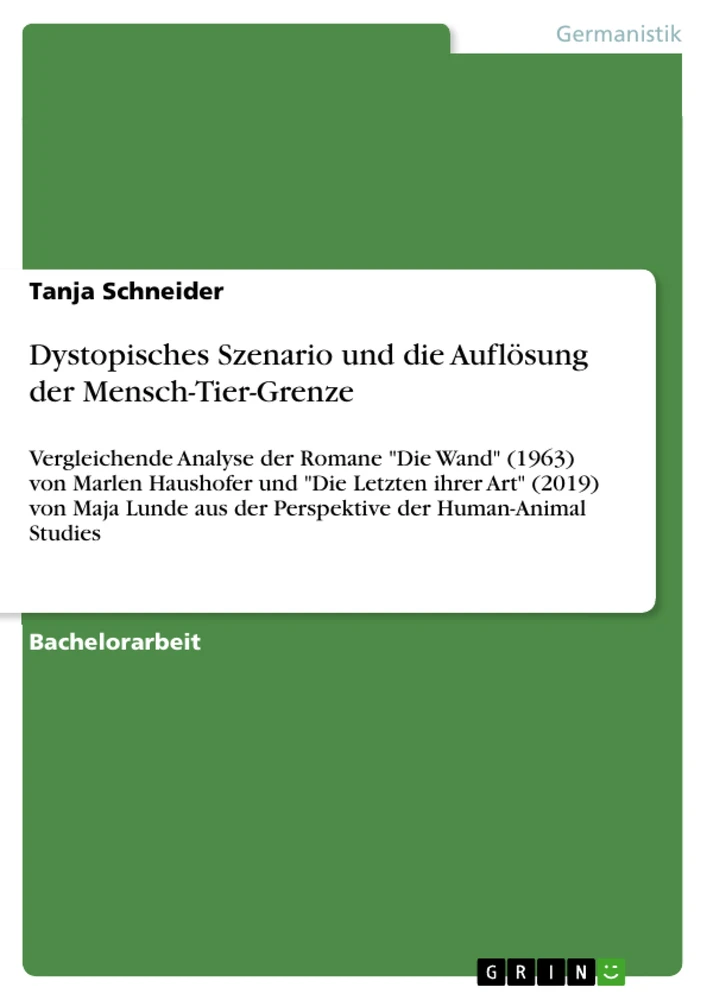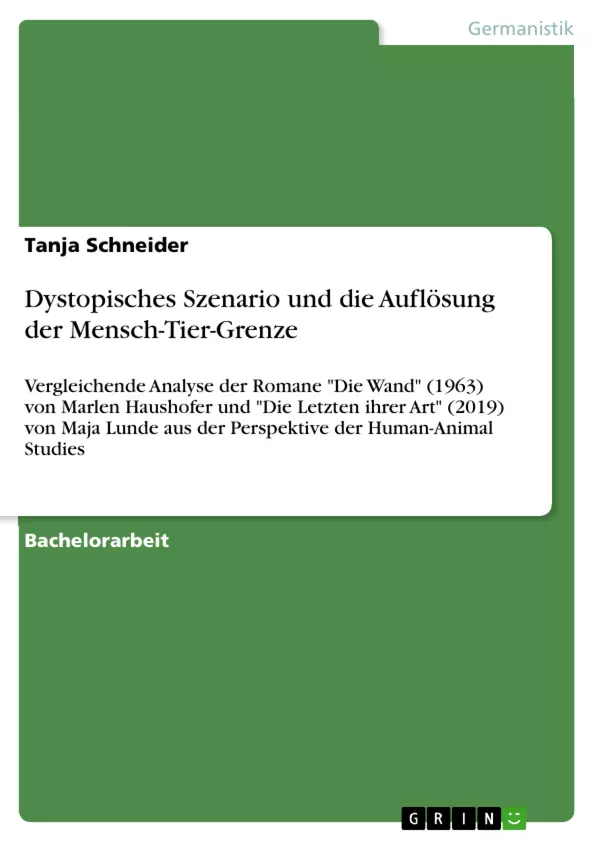Das menschliche Selbstverständnis gründet sich auf eine Abgrenzung von tierlichen Lebewesen und eine Herausstellung genuin menschlicher Eigenschaften. Die Frage nach der menschlichen Identität ist also immer auch eine Frage nach der Art der Beziehung des Menschen zu nicht-menschlichen Lebewesen, die sich unter anderem in der (auch künstlerischen und literarischen) Darstellung jener Lebewesen aus menschlicher Perspektive herauskristallisiert.
Diese für unseren Kulturkreis typische Art nicht-menschliche Tiere zu sehen gründet auf eine philosophische, naturwissenschaftliche und ästhetische Argumentationstradition, in der sich ein "Mechanismus der Selbstaufwertung" realisiert. Erste schriftliche Überlegungen zur Abgrenzung des Menschen von seiner Umwelt finden sich bereits in der Antike bei Aristoteles. Die Herrschaft über die Tiere wurde im christlichen Mittelalter durch den göttlichen Auftrag weiter zementiert und Descartes verstärkte diesen Anspruch durch die Theorie, dass Tiere ähnlich wie Maschinen automatisch funktionierten, bar jeder Vernunft, Eigenständigkeit und Schmerzempfindens.
Allerdings wird der bis heute vorherrschende Anthropozentrismus zunehmend infrage gestellt, was sich an einem gesellschaftlichen "Diskurs über Tiere zu den verschiedenen tierethischen Problemen: Klimawandel, Artensterben, Zoonosen" und einer Wende in den Wissenschaften zeigt. Denn auch in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften – im anglophonen Raum: Humanities - waren nicht-menschliche Tiere passive Objekte. Der im Jahr 2007 verortete Animal Turn steht für eine Wende in diesen Wissenschaften und ist als Ausgangspunkt für die Entstehung der Animal Studies zu sehen, welche die Human-Animal Studies (HAS), die Critical Animal Studies oder auch Cultural Animal Studies, ebenso wie Zooanthropology oder Humanimalia einschließen. Diese Forschungsfelder ermöglichen einen neuen Blickwinkel auf die bislang unsichtbaren Tiere in der Forschung, die nun "die Geschichte des Tier-Übersehens [...] systematisch kritisiert und die neu erreichte Tier-Aufmerksamkeit als eine [...] verunsichernde Herausforderung begreift.“ Dies geht einher mit einem neuen Gegenstandsbereich und einer kritischen Auseinandersetzung mit den bisherigen Begriffen und Methoden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mensch-Tier-Beziehungen
- Die Mensch-Tier-Grenze als Konstrukt
- Anthropozentrismus, Speziesismus und Anthropomorphismus
- Anthropozentrische Kategorisierungen
- Haraways Gefährt*innenspezies
- Tierdarstellungen nach Kate Soper
- Situierung der Romane im historischen Kontext
- Das Anthropozän
- Die Wand von Marlen Haushofer (1963)
- Die Letzten ihrer Art von Maja Lunde (2019)
- Das Tier-Konstrukt
- Die Wand von Marlen Haushofer
- Das menschliche Konzept der Ordnung
- Das Einläuten des dystopischen Ereignisses
- Für den menschlichen Nutzen
- Die Letzten ihrer Art von Maja Lunde
- Norwegen (2064)
- Mongolei (90er Jahre)
- Russland und Mongolei (1881)
- Zwischenfazit
- Die Wand von Marlen Haushofer
- Infragestellen des Konzepts Mensch
- Die Wand von Marlen Haushofer
- Reproduktion und Familie
- Der hungrige Körper
- Über Körpergrenzen hinweg
- Die Letzten ihrer Art von Maja Lunde
- Instinktiver Fortpflanzungsdrang
- Hunger als Obsession
- Berührungen machen die Spezies-Grenzen durchlässig
- Zwischenfazit
- Die Wand von Marlen Haushofer
- Wie weiter nach dem Anthropozän?
- Die Wand von Marlen Haushofer
- Die Alm als gescheiterte Utopie
- Interspezifische Familienutopie?
- Die Frau als Kulturwesen
- Die Letzten ihrer Art von Maja Lunde
- Sich selbst überlassen
- Im Kreis gehen
- Zwischenfazit
- Die Wand von Marlen Haushofer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Mensch-Tier-Beziehungen in den Romanen "Die Wand" von Marlen Haushofer und "Die Letzten ihrer Art" von Maja Lunde im Kontext der Human-Animal Studies. Ziel ist es, die Konstruktion des "Tieres" in beiden Romanen zu analysieren und die daraus resultierende menschliche Selbstwahrnehmung zu beleuchten.
- Die Konstruktion der Mensch-Tier-Grenze und deren Durchlässigkeit.
- Anthropozentrismus und Speziesismus in den Romanen.
- Die Rolle von Tieren in dystopischen Szenarien.
- Die Infragestellung des menschlichen Selbstverständnisses.
- Mögliche Zukunftsvisionen im Kontext des Anthropozäns.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Human-Animal Studies und die Bedeutung der literarischen Darstellung von Tieren ein. Kapitel 2 beleuchtet theoretische Grundlagen zu Mensch-Tier-Beziehungen, Kapitel 3 situiert die ausgewählten Romane historisch im Kontext des Anthropozäns. Die Kapitel 4 und 5 analysieren das "Tier-Konstrukt" und die Infragestellung des Konzepts "Mensch" in beiden Romanen, während Kapitel 6 die Zukunftsvisionen der Romane im Kontext des Anthropozäns beleuchtet.
Schlüsselwörter
Human-Animal Studies, Mensch-Tier-Beziehung, Anthropozän, Dystopie, Speziesismus, Anthropozentrismus, Marlen Haushofer, Maja Lunde, "Die Wand", "Die Letzten ihrer Art", Tierdarstellung, menschliche Identität.
- Arbeit zitieren
- Tanja Schneider (Autor:in), 2023, Dystopisches Szenario und die Auflösung der Mensch-Tier-Grenze, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1507753