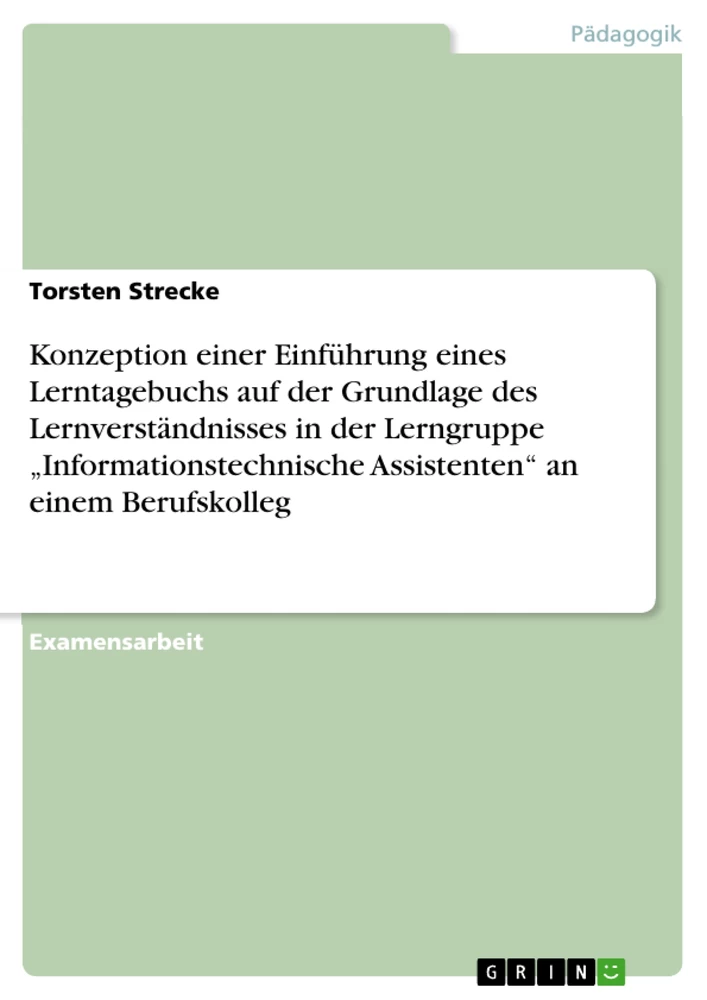Lernen unterliegt gegenwärtig einer starken Veränderung, nachdem der konventionelle Unterricht in „Schieflage“ geraten ist, wie uns die Ergebnisse aus den Bildungsstudien PISA oder TIMSS seit gut zehn Jahren suggerieren. Nicht ein Wissens-, sondern ein Könnensdefizit wurde deutschen Schülern attestiert, wodurch belegt wird, dass reiner Wissensadaption im Sinne traditioneller Lehre die Nachhaltigkeit fehlt. Somit müssen neue Zugänge zum Lernen geschaffen werden, die sich in der Vorgabe nach einer umfassenden Handlungskompetenz seitens der Politik und Berufswelt manifestieren. Das künftige Wissen ist nicht mehr vorhersehbar, weshalb ein dynamisches Modell des Weiter-, Um- und Neulernens entwickelt werden muss. Wesentliche Bedeutung erhält das selbstgesteuerte Lernen. Doch verbirgt sich dahinter eine Gefahr: Wie komme ich als Lehrer mit meinen Schülern auf einen guten Pfad des Lernens, dass sie sich ihrer Lernstrategien bewusst werden und tatsächlich selbstständig arbeiten, um auf das „lebensbegleitende Lernen“ hinzuwirken? Maßnahmen zur Förderung von selbstgesteuertem Lernen müssen bisweilen als Desiderat betrachtet werden.
Wesentlich ist, dass im Kraftzentrum von schulischer Bildung nicht mehr der Inhalt, sondern das Lernen als persönliches Erfahren, Erleben und Interpretieren steht. Das setzt voraus, dass für die Zielverfolgung einer bestimmten Lernproblematik nicht mehr einzig ein allgemeinverbindlicher Weg in einem engen Lernkorridor begehbar ist, weshalb dem Schüler geholfen werden muss, ihm einen individuellen Zugang zu ermöglichen. Dieses Recht wird ihm qua Gesetz zugebilligt, denn jedes Individuum lernt unter identischen Umgebungsvariablen verschieden, da es je durch einen anderen Denk- bzw. Lernstil geprägt ist. Gleichzeitig muss die Verschiedenheit von Schülern nicht als Problem, sondern als Reichtum betrachtet werden – wenn für das Verstehen ein kommunikativer Austausch gewährleistet ist.
Gelingt es dauerhaft, den Schüler mit seiner Biographie zu fokussieren, die von eigenen Vorkenntnissen, Motivationen und intellektuellen Fähigkeiten getragen wird , so kann er sich in einem nächsten Schritt seiner Verantwortung bei seinen Entscheidungen und Handlungen für sich und der Gesellschaft bewusst werden. Um diesem Anspruch zu genügen, müssen Instrumente vorliegen, sodass in der aktuellen Lehr-Lernforschung das Lerntagebuch als probates Mittel diskutiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Problemaufriss
- Veränderte Herausforderungen von schulischer Bildung
- Etwas mehr Metakognition, bitte?! Bestandsaufnahme des eigenen Unterrichts
- Perspektiven meines Vorhabens
- Was sagt die Lernforschung? Selbstgesteuertes Lernen und Konstruktivismus als theoretisches Fundament einer neuen Lernkultur…...
- Der Weg ist das Ziel – Bühne frei für: Das Lerntagebuch
- Die Funktionen von Lerntagebüchern
- Die Arten von Lerntagebüchern
- Meine Möglichkeiten als angehender Lehrer
- Ableitung der Konzeptualisierung....
- Handlungskontext für die Umsetzung meines Vorhabens
- Rechtliche Rahmenbedingungen von Schule
- Wir sind eben noch nicht soweit! Selbstgesteuertes Lernen im Schulalltag
- Ein Meinungsbild zum Lernverständnis in der Lerngruppe „Informationstechnische Assistenten“
- Lehrergespräche: Welche Kollegen setz(t)en Lerntagebücher ein?
- Institutionelle Voraussetzungen
- Schritte zum Einsatz eines Lerntagebuchs
- Einführung vor dem Hintergrund des Meinungsbildes
- Die Erwartungshaltung der Schüler
- Der Mehraufwand für alle Beteiligten
- Noten als Geißel schulischer Bildung
- Aufwertung des Lernprozesses
- Fremd- und Selbstregulation auf dem Kontinuum selbstgesteuerten Lernens ...
- Das Selbstbewusstsein stärken, das Lernen klären
- Kooperativer Austausch über Lernprozesse
- Gelingensbedingungen eines Lerntagebuchs auf einen Blick
- Die Seite 0...
- Kommentare durch den Lehrer
- Lerntagebuch im Web 2.0 – Der Weblog
- Reflexion - Was war, was ist, was wird...
- Erdung der Problemstellung hinsichtlich meiner Funktion als Lehrer..
- Ausblick..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Konzeption einer Einführung eines Lerntagebuchs in der Lerngruppe „Informationstechnische Assistenten" an einem Berufskolleg. Sie analysiert die Herausforderungen von schulischer Bildung im Kontext des selbstgesteuerten Lernens und untersucht die Potenziale von Lerntagebüchern als Instrument zur Förderung von Metakognition und Selbststeuerung.
- Analyse des aktuellen Lernverständnisses in der Lerngruppe „Informationstechnische Assistenten“
- Entwicklung einer Konzeption für die Einführung eines Lerntagebuchs
- Bedeutung von Selbstgesteuertem Lernen (SGL) und Metakognition
- Relevanz von Lerntagebüchern im Kontext der digitalen Bildung
- Herausforderungen und Chancen für die Implementierung von Lerntagebüchern in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die veränderten Herausforderungen von schulischer Bildung im Kontext von Bildungsstudien wie PISA und TIMSS und argumentiert für die Notwendigkeit von neuen Zugängen zum Lernen, die Selbststeuerung und Metakognition fördern. Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Vorhabens, insbesondere das Konzept des selbstgesteuerten Lernens und die Bedeutung von Lerntagebüchern als Instrument zur Förderung von Metakognition und Selbststeuerung. Das dritte Kapitel untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen und den Handlungskontext für die Umsetzung des Vorhabens, wobei die Meinungen und Erfahrungen von Schülern und Lehrkräften im Fokus stehen. Das vierte Kapitel präsentiert konkrete Schritte zur Einführung eines Lerntagebuchs, einschließlich Gelingensbedingungen und Möglichkeiten der digitalen Umsetzung im Web 2.0.
Schlüsselwörter
Selbstgesteuertes Lernen, Metakognition, Lerntagebuch, Web 2.0, digitale Bildung, Informationstechnische Assistenten, Berufskolleg, Handlungskompetenz, Lernkultur, Konstruktivismus, Bildungsstudien (PISA, TIMSS), Lerntagebuch im Weblog, Schülerbeteiligung, Lehrkraft-Schüler-Interaktion, digitale Lernwerkzeuge.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Lerntagebuch?
Ein Lerntagebuch ist ein Instrument, in dem Lernende ihre Lernprozesse, Erfolge und Schwierigkeiten dokumentieren und reflektieren.
Was versteht man unter Metakognition im Unterricht?
Metakognition bedeutet das „Nachdenken über das eigene Denken“ – also die Fähigkeit, eigene Lernstrategien zu erkennen, zu planen und zu bewerten.
Wie kann ein Lerntagebuch digital umgesetzt werden?
Eine moderne Form ist die Nutzung von Weblogs (Blogs), die den kooperativen Austausch und die Nutzung von Web 2.0-Werkzeugen ermöglichen.
Welche Vorteile bietet selbstgesteuertes Lernen (SGL)?
Es bereitet Schüler auf das lebenslange Lernen vor, stärkt die Eigenverantwortung und ermöglicht individuelle Lernwege.
Was sind die Hürden bei der Einführung von Lerntagebüchern?
Herausforderungen sind der zeitliche Mehraufwand für Schüler und Lehrer sowie die Problematik der Benotung von Reflexionsleistungen.
- Citation du texte
- Torsten Strecke (Auteur), 2009, Konzeption einer Einführung eines Lerntagebuchs auf der Grundlage des Lernverständnisses in der Lerngruppe „Informationstechnische Assistenten“ an einem Berufskolleg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150891