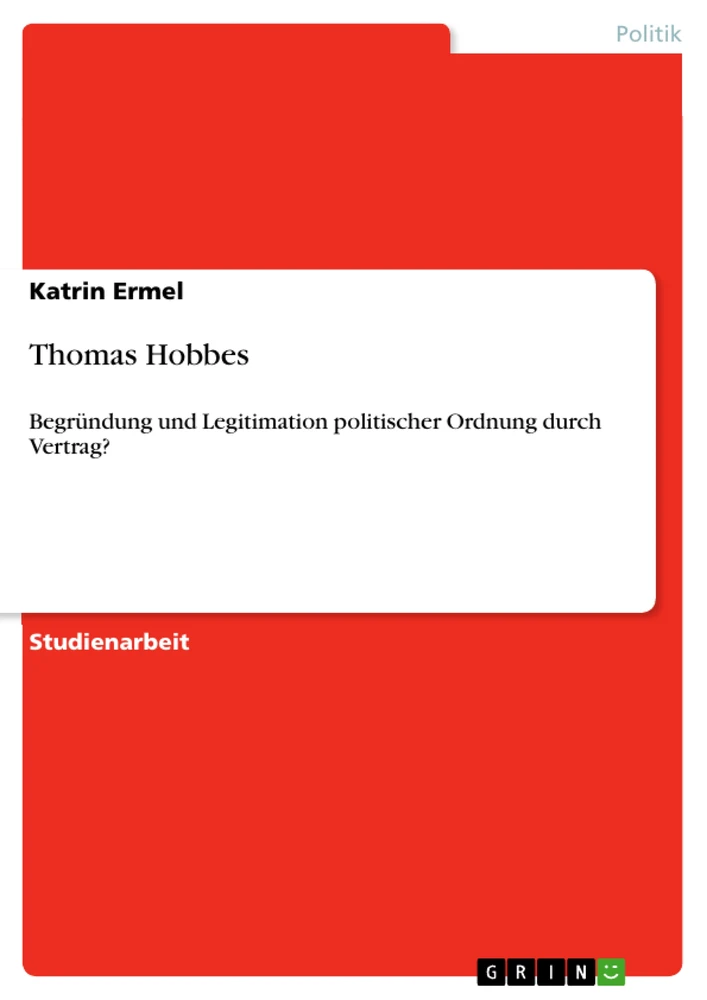[...] Unter den Denkern kristallisierten sich Modelle heraus, welche das Zustandekommen des
Staates durch einen Vertrag beschreiben, die sogenannten Vertragstheorien. Hierbei wird von
einem ungeordneten Urzustand ausgegangen, welcher dadurch überwunden wird, dass die
einzelnen Individuen einen Vertrag schließen und somit den Staat konstituieren. Ein Vertreter
dieser Theorie ist Thomas Hobbes (1588- 1679). Die vorliegende Arbeit wird den
Vertragsgedanken in Hobbes´ Werk „Leviathan“ darstellen und erläutern. In einem zweiten
Teil soll dieser der Kritik von David Hume (1711- 1776) gegenübergestellt werden. Obwohl
Hume in seiner politischen Schrift „Über den ursprünglichen Vertrag“ allgemein diese
Theorie kritisiert, sind seine Argumente wesentlich auf John Locke bezogen, wie der Schluss
des Essays zeigt (Ottow 1997: 443) Locke, ebenfalls Vertragstheoretiker, unterscheidet sich
zu Hobbes im Wesentlichen durch die Aufnahme der Gewaltentrennung, sowie die
Unterstellung des Staates und jeder Herrschaft unter das naturrechtlich begründetet Recht. Im
Gegensatz zu Hobbes hält er den Menschen für gut und sieht den Naturzustand als staats- und
gesetzeslosen Frieden. Hier müssen die Individuen auch nicht ständig um ihr Leben fürchten,
sondern gewinnen aus ihrer Arbeit Eigentum, dessen Sicherung sie zur Staatsgründung
streben lässt (Neumann 1989: 29). John Locke und Thomas Hobbes unterscheiden sich also,
was verschiedene Blickpunkte ihrer Modelle betrifft. Dies ist für meine Arbeit jedoch
unerheblich, da David Humes Kritik nicht die Differenzen hervorhebt, sondern allgemeine
Aspekte betrifft, welche den Vertragstheorien zugrunde liegen und somit auch der von
Thomas Hobbes. Nachdem dies näher betrachtet wurden, werde ich daraus einige Kriterien
für eine grundlegende Kritik der Begründung und Legitimation politischer Ordnung durch die
Vertragstheorie ableiten und vorstellen. Schließlich werde ich mir bestimmte Aspekt
auswählen, sie kritisch beurteilen und Chancen sowie Probleme vertragstheoretischer
Begründungsmodelle betrachten.
Aufgrund der Fülle der vorhandenen Literatur zu diesem Thema beschreitet diese Arbeit kein
philosophisches Neuland, sondern soll vielmehr dem interessierten Laien als Adressaten einen
Einblick in theoretische Denkfiguren der Staatsgründung geben. Durch die Auswahl der
Theorie des Thomas Hobbes soll dies exemplarisch werden, die zentralsten Aspekte des
Kontraktualismus herausgestellt und kritisch betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Thomas Hobbes´ „Leviathan“
- David Humes Kritik an der Vertragstheorie
- Kriterien für eine grundlegende differenzierte Betrachtung der Vertragstheorie
- Vergleich von Hobbes´ und Humes Position nach ausgewählten Gesichtspunkten und abschießende Beurteilung vertragstheoretischer Begründungsmodelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vertragsgedanken in Thomas Hobbes' Werk "Leviathan" und dessen Kritik durch David Hume. Der Fokus liegt auf der Analyse des Naturzustands, dem Gesellschafts- und Herrschaftsvertrag sowie der Rolle des Souveräns. Durch die Gegenüberstellung von Hobbes' und Humes Position sollen grundlegende Kritikpunkte an vertragstheoretischen Begründungsmodellen von politischer Ordnung aufgezeigt werden.
- Der Naturzustand und seine Problematik in Hobbes' Philosophie
- Der Gesellschaftsvertrag als Lösung für die Probleme des Naturzustands
- Die Rolle des Souveräns und die Frage der Legitimation
- Humes Kritik an der Vertragstheorie
- Kriterien für eine differenzierte Betrachtung von vertragstheoretischen Begründungsmodellen
Zusammenfassung der Kapitel
Thomas Hobbes´ „Leviathan“
Das Kapitel behandelt die Entstehung von Thomas Hobbes' Werk „Leviathan“ im Kontext des englischen Bürgerkriegs und beleuchtet Hobbes' naturalistische Staatsauffassung. Der Autor beschreibt den Naturzustand als einen Zustand des „bellum omnium contra omnes“ (Krieg aller gegen alle) und erläutert, wie der Mensch durch den Gesellschaftsvertrag und die Übertragung seiner Rechte an einen Souverän aus dieser prekären Situation herausfindet.
David Humes Kritik an der Vertragstheorie
Dieses Kapitel widmet sich David Humes Kritik an der Vertragstheorie, insbesondere an John Locke. Hume argumentiert, dass der Naturzustand ein rein hypothetisches Konzept ist, das sich nicht empirisch belegen lässt. Er kritisiert auch die Annahme, dass der Staat aus einem freiwilligen Vertrag hervorgegangen ist.
Kriterien für eine grundlegende differenzierte Betrachtung der Vertragstheorie
Das Kapitel leitet aus den vorherigen Kapiteln Kriterien für eine kritische Analyse der Vertragstheorie ab. Hierbei geht es um die Frage, ob sich politische Ordnung tatsächlich durch Verträge begründen lässt, welche Probleme mit dieser Theorie verbunden sind und welche Alternativen es gibt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der politischen Philosophie, wie dem Naturzustand, dem Gesellschaftsvertrag, dem Herrschaftsvertrag, dem Souverän und der Legitimation. Weitere wichtige Begriffe sind: bellum omnium contra omnes, naturalistische Staatsauffassung, empirische Kritik und vertragstheoretische Begründungsmodelle.
Häufig gestellte Fragen
Was beschreibt Thomas Hobbes im "Leviathan"?
Hobbes beschreibt die Gründung eines Staates durch einen Gesellschaftsvertrag, um den chaotischen Naturzustand zu überwinden.
Was versteht Hobbes unter dem "Naturzustand"?
Er definiert ihn als "bellum omnium contra omnes" (Krieg aller gegen alle), in dem das Leben des Menschen einsam, armselig und kurz ist.
Wie unterscheidet sich John Locke von Hobbes?
Locke sieht den Menschen als grundsätzlich gut an und fordert Gewaltentrennung sowie den Schutz des Eigentums durch den Staat.
Was kritisiert David Hume an der Vertragstheorie?
Hume argumentiert, dass der Vertrag ein rein hypothetisches Konzept ist und Staaten historisch meist durch Gewalt oder Gewohnheit entstanden sind.
Welche Rolle spielt der Souverän bei Hobbes?
Der Souverän erhält durch den Vertrag die uneingeschränkte Macht, um Frieden und Sicherheit im Staat zu garantieren.
- Citation du texte
- Katrin Ermel (Auteur), 2007, Thomas Hobbes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150893