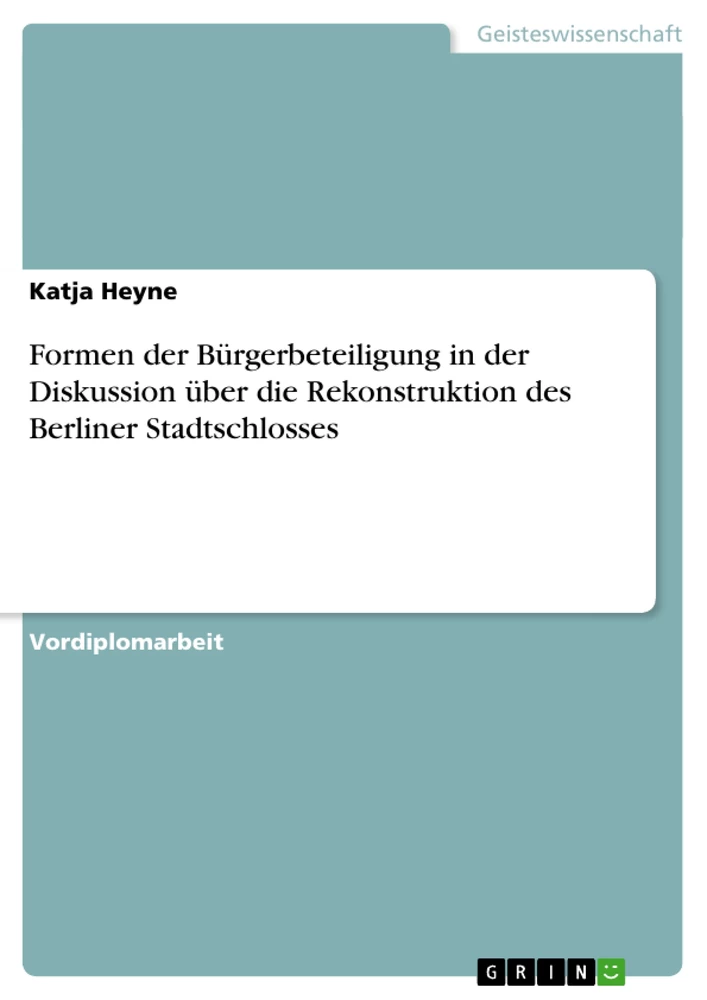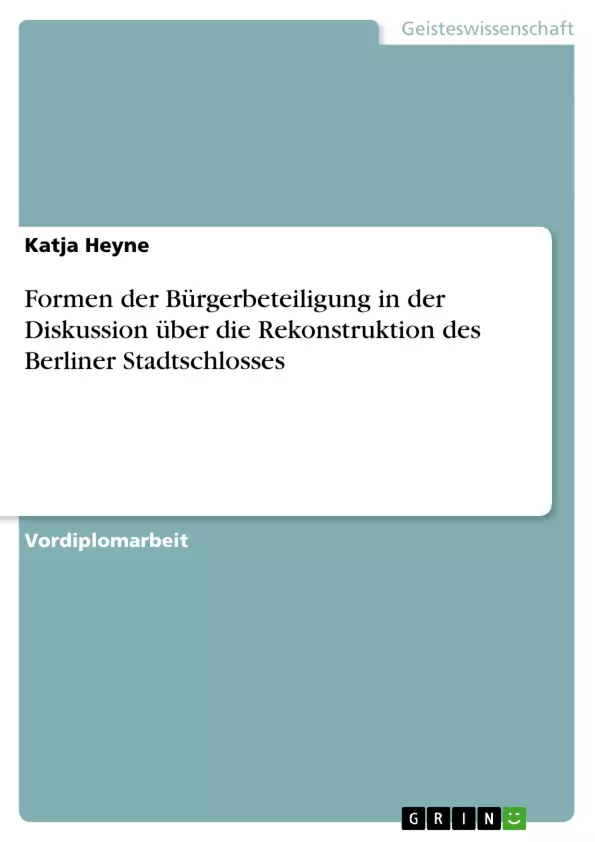[...] Die Argumente nehmen kein Ende und die Breite reicht von politischen und
moralischen über städtebaulichen, bis zu rein emotionalen Aspekten.
Diese Arbeit beschäftigt sich nun mit der Fragestellung:
Wie gestaltet sich der fachliche Hintergrund der Schlossplatzdebatte in bezug auf die
Rekonstruktion und die momentane Schlossplatzgestaltung und welche Formen
der Bürgerbeteiligung existierten in dieser Diskussion?
Im folgenden beschäftige ich mich zunächst mit dem Problem der Rekonstruktion an
sich. Fragen, die mich hierzu begleiten, lauten:
Welche Maßstäbe werden zur Klärung in diesem Fachbereich herangezogen, nach
welchen Grundsätzen wird gehandelt?
Wie gestaltet sich die Situation konkret auf dem Schlosslatz?
Ist die Rekonstruktion der Denkmalpflege oder dem Denkmalschutz überhaupt
zuzuordnen?
Wie ist die Meinung der zuständigen Denkmalbehörden?
In Sachen Bürgerbeteiligung untersuche ich natürlich ebenso die Situation vor Ort.
Wer sind die Beteiligten, außerhalb von Senat, Expertenkommissionen und
Denkmalbehörden?
Wie arbeiten Vereine, Initiativen, die sich extra formiert haben um die Rekonstruktion
durchzusetzen?
Wie sind die Möglichkeiten des ´normalen` und nichtorganisierten Bürgers, seine
Meinungen und Ideen in diesem erst vor kurzem geendeten Prozess einzubringen?
Gibt es eine Art Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gruppen, von den
Vereinen untereinander oder von den Vereinen mit den nichtorganisierbaren
Bürgern?
Welchen Einfluss haben die Vereine insgesamt?
Wie ist die Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung insgesamt zu bewerten?
Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich meine Arbeit in drei Kapitel gegliedert, die
ich wie folgt beschreibe. Zu Beginn gebe ich einen detaillierten Überblick über die Entstehung des Schlosses
und die Entwicklung des Platzes nach der Sprengung von 1950.
Im Anschlusskapitel wird die Denkmalpflegetheorie und die Situation auf dem
heutigen Schlossplatz dargestellt. Zum Ende des Kapitels gehe ich auf die Debatte
zur Rekonstruktion des Stadtschlosses ein.
Im nächsten Kapitel werden die Beteiligten an der Diskussion unter dem Aspekt der
Bürgerbeteiligung näher beleuchtet. Bevor ich diese konkret vorstelle, werden, wie im
zweiten Kapitel, einige ausgewählte Aspekte zur Theorie der Bürgerbeteiligung näher
beschrieben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Chronik des Ortes
- 2.1 Die Entstehung des Schlosses.
- 2.2 Das Schloss zwischen 1918 und 1945
- 2.3 Die Sprengung des Schlosses
- 2.4 Der Palast der Republik_
- 2.5 Das Schlossplatz-Areal nach 1989
- 3. Theorie und Praxis – Die Debatte über die Rekonstruktion des Stadtschlosses
- 3.1 Die Aufgabenbereiche der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes
- 3.2 Die auf dem Schlossplatz eingetragenen Denkmale:
- 3.3 Begriffsklärung der in der Denkmalpflege verwendeten Begriffe
- Konservierung.
- Restaurierung
- Instandhaltung, Instandsetzung.
- Rekonstruktion, Wiederaufbau, Anastylosis.
- Translozierung_
- Denkmalwerte
- 3.4 Die Geschichte der denkmalpflegerischen Grundsätze in Bezug auf Rekonstruktion und Restaurierung
- 3.5 Die aktuelle Debatte zur Rekonstruktion des Stadtschlosses
- 4. Partizipation der Öffentlichkeit an der Diskussion über die Rekonstruktion des
Schlosses
- 4.1 Geschichte der Bürgerbeteiligung.
- 4.2 Die Formelle Bürgerbeteiligung
- 4.3 Die Informelle Bürgerbeteiligung.
- Bürgerinitiativen
- Interessenverbände/ Vereine
- 4.4 Vereine, Initiativen, Arbeitskreise in der Diskussion über die Schlossrekonstruktion
- Vereine und Initiativen zur Erhaltung des Palastes_
- Vereine und Initiativen zur Rekonstruktion des Schlosses_
- Initiativen mit Ganzheitlichem Ansatz
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit beschäftigt sich mit der Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses und untersucht die verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung in dieser komplexen Debatte. Sie untersucht den fachlichen Hintergrund der Schlossplatzdebatte, die verschiedenen Positionen und Argumente der Beteiligten sowie die Rolle der Bürger in diesem Prozess.
- Historische Entwicklung des Schlossplatzes und des Stadtschlosses
- Theorie und Praxis der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes im Kontext der Rekonstruktion
- Formen der Bürgerbeteiligung in der Debatte um die Schlossrekonstruktion
- Analyse verschiedener Vereine, Initiativen und Arbeitskreise, die sich mit der Thematik auseinandersetzen
- Bewertung der Rolle der Bürger in der Entscheidungsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar. Es erläutert den aktuellen Stand der Schlossplatzdebatte und skizziert die Relevanz der Bürgerbeteiligung. Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte des Ortes und gibt einen Überblick über die verschiedenen Phasen der Schlossentwicklung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Kapitel 3 fokussiert auf die theoretischen Grundlagen der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes, insbesondere im Kontext der Rekonstruktion. Es analysiert verschiedene Begriffsdefinitionen und diskutiert die Geschichte der denkmalpflegerischen Grundsätze. Kapitel 4 untersucht die verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung in der Schlossplatzdebatte. Es betrachtet sowohl die formelle Beteiligung durch öffentliche Anhörungen und Abstimmungen als auch die informelle Beteiligung durch Vereine, Initiativen und Bürgergruppen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit fokussiert auf die zentralen Themenbereiche der Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses, der Bürgerbeteiligung und der Denkmalpflege. Relevante Schlüsselwörter sind: Stadtschloss, Schlossplatz, Rekonstruktion, Denkmalpflege, Denkmalschutz, Bürgerbeteiligung, Vereine, Initiativen, Arbeitskreise, Palast der Republik, Historische Mitte Berlin.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses umstritten?
Die Debatte umfasst politische, moralische und städtebauliche Aspekte. Ein zentraler Streitpunkt war der Abriss des Palastes der Republik, um Platz für die Wiederherstellung der historischen Mitte zu schaffen.
Welche Formen der Bürgerbeteiligung gab es in der Schlossplatzdebatte?
Es gab sowohl formelle Beteiligung (Anhörungen) als auch informelle Beteiligung durch Vereine, Bürgerinitiativen und Interessengruppen, die sich für oder gegen die Rekonstruktion einsetzten.
Gilt die Rekonstruktion des Schlosses als Denkmalpflege?
In der Fachwelt ist dies umstritten. Während klassische Denkmalpflege den Erhalt originaler Substanz betont, handelt es sich bei der Rekonstruktion um den Neubau einer verlorenen Struktur nach historischem Vorbild.
Welchen Einfluss hatten Vereine auf den Entscheidungsprozess?
Vereine wie der Förderverein Berliner Schloss spielten eine massive Rolle bei der Mobilisierung der Öffentlichkeit und der Sammlung von Spenden für die historische Fassade.
Was passierte mit dem Schloss nach 1945?
Das im Krieg beschädigte Schloss wurde 1950 auf Geheiß der DDR-Führung gesprengt. Später wurde an dieser Stelle der Palast der Republik errichtet.
- Quote paper
- Katja Heyne (Author), 2002, Formen der Bürgerbeteiligung in der Diskussion über die Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15095