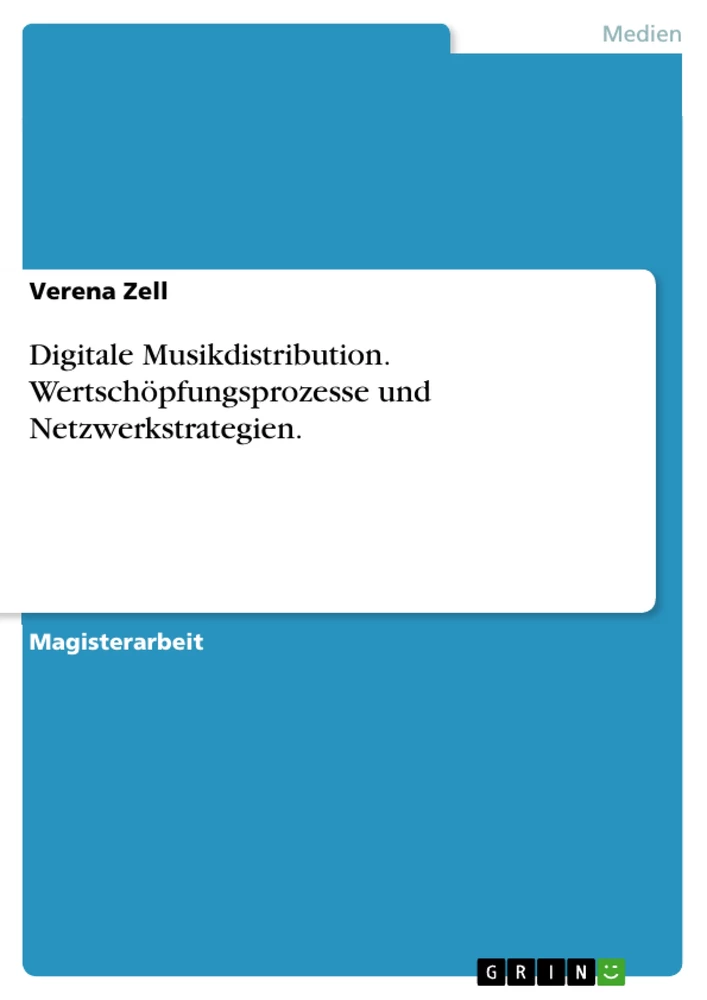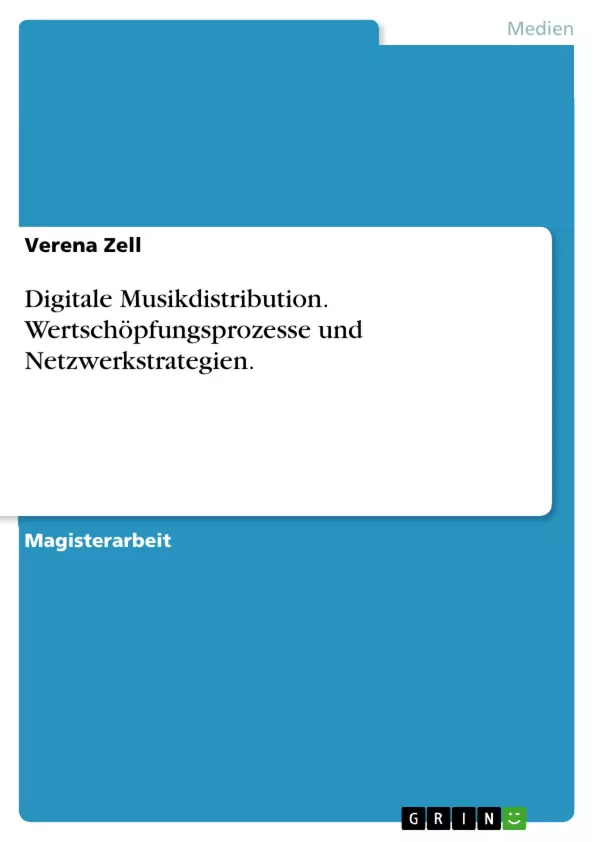Seit nun mehr als zehn Jahren hat die Musikindustrie mit einer wirtschaftlichen Krise zu kämpfen. War der Tonträger lange Zeit der wirtschaftliche Dreh- und Angelpunkt der Musikindustrie und bescherte dieser erheblichen Umsatzzuwachs, änderte sich dies mit der Jahrtausendwende als mit der Digitalisierung neue Produkte den Tonträger zu substituieren drohten.
Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch, dass die Musikindustrie schon immer mit der scheinbaren Bedrohung durch neue Produkte und Technologien kämpfen musste. Bereits die Einführung des Rundfunks 1923 als auch der Verkauf von Tonbandgeräten in den 1960ern und der Verkauf von Leerkassetten Ende der 1970er Jahre wurde von der phonographischen Wirtschaft als Bedrohung angesehen. Ironischerweise läutete jedoch erst die CD, der Tonträger welcher der Musikindustrie ab Mitte der 80er Jahre enormen Umsatzzuwachse einbrachte und somit nicht als Bedrohung angesehen wurde, den Anfang vom Ende ein, indem die Musikstücke erstmals in digitaler Form vorlagen und somit ohne Qualitätsverluste relativ einfach vervielfältigt werden konnten. Zusammen mit der Erfindung des MP3-Formats und dem Aufkommen des Internets führte dies zu gravierenden Änderungen innerhalb der Branche, deren Auswirkungen die phonographische Wirtschaft noch heute teilweise ratlos gegenübersteht.
Diese Arbeit soll nicht den Anspruch haben endgültige Lösungen für diese Problematik anzubieten, vielmehr sollen Zusammenhänge und neue strategische Wege aufgezeigt werden, wie mit den geänderten Bedingungen umgegangen werden kann. Die übergeordnete Frage dabei ist, wie sich die Wertschöpfung und die Vertriebssituation für Musikprodukte geändert haben und welche neuen möglichen Wertschöpfungsperspektiven sich aus diesen Veränderungen heraus für die Musikindustrie ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Guteigenschaften von Musik
- 2.1 Musik als ökonomisches Gut
- 2.1.1 Gebrauchswert und Nutzen von Musik
- 2.1.2 Nachfrage nach Musik
- 2.1.3 Knappheitsprinzip in der Musikindustrie?
- 2.2 Musikprodukte
- 2.2.1 Physische Produkte
- 2.2.2 Nicht-physische Produkte
- 2.2.3 Live-Events
- 2.3 Musik als Kulturgut und meritorisches Gut
- 2.4 Musikprodukte: Sach- oder Dienstleistung?
- 2.5 Musikprodukte sind Informationsgüter
- 3. Das lineare Wertschöpfungskonzept der Musikbranche
- 3.1 Das Wertschöpfungskonzept nach Michael E. Porter
- 3.2 Wertschöpfungskette innerhalb der traditionellen Musikbranche
- 3.2.1 Kosten- und Erlösstruktur physischer Musikprodukte
- 3.2.2 Vertriebssituation für physische Produkte
- 3.3 Wertschöpfungskette für nicht-physische Musikprodukte
- 3.3.1 Kosten- und Erlösstruktur nicht-physischer Musikprodukte
- 3.2.2 Vertriebssituation für nicht-physischer Produkte am Beispiel des iTunes Stores
- 3.4 Kritik am linearen Wertschöpfungsmodell
- 4. Veränderte Realitäten im Musikmarkt
- 4.1 Globalisierung und Regionalisierung der Musikindustrie
- 4.2 Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft
- 4.3 Konvergenz
- 4.4 Von der Wertschöpfungskette zum Wertschöpfungsnetzwerk
- 5. Neue Wertschöpfungsperspektiven für Musikunternehmen
- 5.1 Prozessöffnung und Kooperation: TIME Konvergenz
- 5.2 Blaue und rote Ozeane: Nutzeninnovation und Implementierung von neuen Technologien
- 5.3 Nutzung von globalen Ressourcen: R=G Konzept
- 5.4 Kundenzentrierung und Co-Kreation: N=1 Konzept
- 5.5 Nischenversorgung: The long Tail
- 5.6 Das Rundum-Sorglos-Paket: 360-Grad-Modelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Veränderungen, denen die Musikindustrie in den vergangenen Jahren gegenübersteht. Sie analysiert die Entwicklung der Wertschöpfung und des Vertriebs von Musikprodukten im Kontext der Digitalisierung und der damit verbundenen technologischen Fortschritte.
- Die Entwicklung der Musikindustrie von einem traditionellen linearen Wertschöpfungsmodell hin zu einem komplexeren Wertschöpfungsnetzwerk
- Die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Vertrieb und die Konsumgewohnheiten von Musik
- Neue Strategien und Geschäftsmodelle für Musikunternehmen im digitalen Zeitalter
- Die Rolle von Innovation und Kooperation in der Musikindustrie
- Die Bedeutung von Kundenzentrierung und individualisierten Lösungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die Musikindustrie im Kontext der Digitalisierung vor und beschreibt die Herausforderungen, die sich aus der Verbreitung von Musik im Internet ergeben.
Kapitel zwei analysiert die ökonomischen Eigenschaften von Musik als Gut und untersucht die verschiedenen Güterarten, zu denen Musikprodukte gehören.
Kapitel drei beleuchtet das traditionelle lineare Wertschöpfungsmodell der Musikindustrie, untersucht die Wertschöpfungskette für physische und nicht-physische Musikprodukte und analysiert die Kosten- und Erlösstrukturen.
Kapitel vier befasst sich mit den veränderten Rahmenbedingungen im Musikmarkt, die durch die Globalisierung, Individualisierung und Konvergenz geprägt sind.
Kapitel fünf schließlich präsentiert neue Wertschöpfungsperspektiven für Musikunternehmen, die auf den veränderten Rahmenbedingungen basieren und innovative Strategien und Geschäftsmodelle vorstellen.
Schlüsselwörter
Musikindustrie, Digitalisierung, Wertschöpfung, Vertrieb, Musikprodukte, Geschäftsmodelle, Innovation, Kooperation, Kundenzentrierung, Globalisierung, Individualisierung, Konvergenz, Streaming, Download, Online-Plattformen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat die Digitalisierung die Musikindustrie verändert?
Die Digitalisierung (MP3, Internet) hat das traditionelle lineare Wertschöpfungsmodell (CD-Verkauf) aufgebrochen und zu einem komplexen Wertschöpfungsnetzwerk mit neuen Akteuren geführt.
Was ist der Unterschied zwischen physischen und nicht-physischen Musikprodukten?
Physische Produkte sind Tonträger wie CDs oder LPs. Nicht-physische Produkte umfassen digitale Downloads und Streaming-Dienste, die eine völlig andere Kosten- und Erlösstruktur aufweisen.
Was bedeutet das "Long Tail"-Prinzip in der Musikbranche?
Es beschreibt die Möglichkeit, durch digitale Distribution auch Nischenprodukte dauerhaft verfügbar zu machen, die im stationären Handel aus Platzgründen nicht geführt würden.
Was versteht man unter einem "360-Grad-Modell"?
In diesem Geschäftsmodell betreut ein Unternehmen einen Künstler in allen Bereichen (Aufnahme, Live, Merchandising, Vermarktung), um die wegbrechenden Einnahmen aus dem reinen Tonträgerverkauf zu kompensieren.
Warum wird Musik als "Informationsgut" bezeichnet?
Musikprodukte sind Informationsgüter, weil sie digitalisierbar sind, hohe Fixkosten in der Erstproduktion (First-Copy-Costs) und sehr geringe Grenzkosten bei der Vervielfältigung haben.
- Quote paper
- Verena Zell (Author), 2010, Digitale Musikdistribution. Wertschöpfungsprozesse und Netzwerkstrategien., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151004