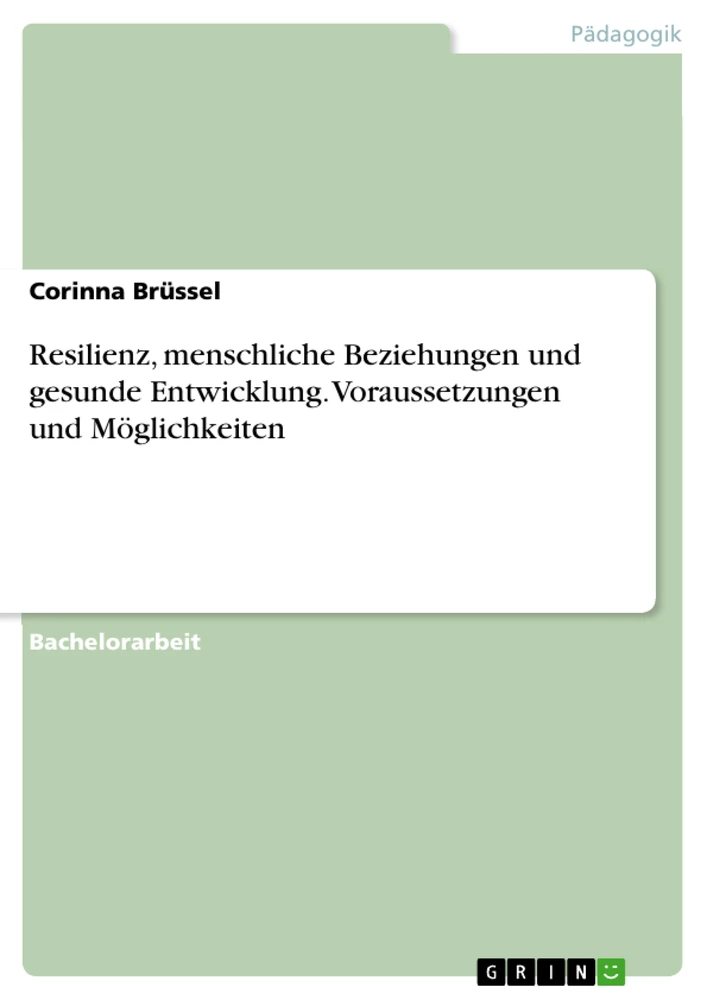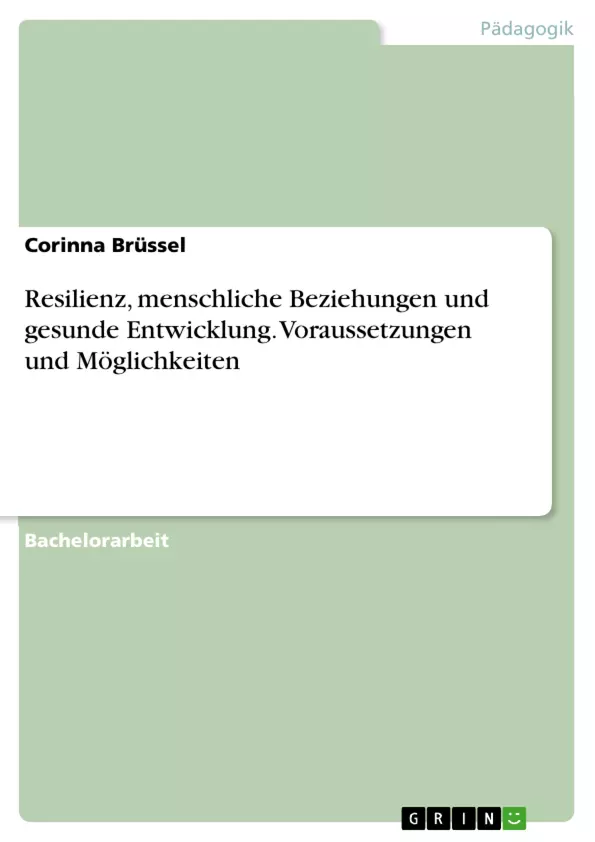Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Resilienz und wie diese im Zusammenhang mit den einzelnen Lebensumständen, dem Alter, als auch Erfahrungen eines jeden Individuums zusammenhängt.
Zu Beginn wird Resilienz definiert, bevor die Stressoren als auslösende Faktoren Berücksichtigung finden. Hierbei stellt sich die Frage, wie Menschen in Stresssituationen reagieren. Langzeitstudien, das Fight-Flight-Freezing-System von Gray, der Resilienzzyklus der Acatech-Studie "Resilienz-Tech", das Krisenmanagement und die Resilienzschlüssel werden neben ähnlichen Konzepten von Resilienz, wie die Bezeichnung Work-Life-Balance und Stressmanagement betrachtet. Aktuelle Forschungen, Konzepte und Entwicklungen in der Erziehungswissenschaft und Resilienz im Rahmen der Kindheitsforschung sowie innerhalb von Bildungsplänen werden hinzugezogen. Das Arbeitsfeld Pädagogik, mit den einzelnen Schwerpunkten Präventions- und Interventionsmaßnahmen, dem Perspektivwechsel, der sich aus der Resilienzforschung vollzogen hat, sowie die Erwachsenenbildung folgen. Ob Resilienz immer gleichbleibend benötigt wird oder in einem gewissen Alter Menschen eher gelassen in Stresssituationen reagieren, wird thematisiert und daraufhin auch der Bezug auf Gesundheit im Allgemeinen sowie auf den Arbeitsalltag, mit dem Fokus auf eine Studie, die Gesundheit Resilienz und Führung im Arbeitsleben thematisiert, genommen.
Es wird sich zeigen, dass Resilienz zwar durch Trainings gefördert werden kann, Situationen aber auftreten können, in denen eine Person, aufgrund ihrer unterschiedlich ausgeprägten Resilienz in verschiedenen Bereichen noch nicht das Optimum für ihr individuelles Selbst erreichen konnte. Im Hinblick auf Stress unterstützt Resilienz, diesem mit Widerstand zu begegnen, damit der Mensch diese Phase bewältigt. Jeder Mensch kann an seiner psychischen Elastizität arbeiten und diese aufgrund von regelmäßigen Trainingseinheiten ausbilden und ausweiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Rahmung der Arbeit
- 2.1 Definition: Resilienz
- 2.2 Aktueller Forschungsstand
- 2.3 Studien zum Thema Resilienz
- 2.4 Einordnung in das Forschungsfeld der Erziehungswissenschaft
- 3. Ressourcen, Anforderungen und Stressoren
- 3.1 Resilienz als Schlüsselkompetenz
- 3.2 Digitales Zeitalter
- 3.3 Stressoren
- 4. Resilienzforschung
- 4.1 Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR)
- 4.2 Längsschnittstudie von Werner und Smith
- 4.3 Studie von Lösel und Bender
- 4.4 LORA-Resilienz-Studie
- 5. Stresssituationen - menschliches Verhalten
- 5.1 Fight-Flight-Freezing-System (FFFS)
- 5.2 Menschliche Belastbarkeit
- 5.3 Resilienzzyklus
- 5.4 Bewältigung und Resilienzschlüssel
- 6. Resilienz - weitere Konzepte und Förderung
- 6.1 Resilienz - weitere Konzepte
- 6.2 Resilienzförderung
- 6.2.1 Messung und Training von Resilienz
- 6.2.2 Verbundprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
- 6.2.3 Deutsches Resilienz Zentrum (DRZ)
- 6.2.4 Trainingskonzepte
- 6.3 Blick in die Zukunft
- 7. Resilienz und Pädagogik
- 7.1 Resilienz - Kindheitsforschung
- 7.2 Bildungs- und Lerngeschichten
- 7.3 Resilienz in Bildungsplänen
- 7.3.1 Frühkindliche Entwicklung
- 7.3.2 Drei Arten von Stress
- 7.3.3 Resilienz als Schutz
- 8. Arbeitsfeld - Pädagogik
- 8.1 Präventions- und Interventionsmaßnahmen
- 8.2 Erwachsenenbildung
- 8.2.1 Resilienzförderung - Konzepte in der Erwachsenenbildung
- 8.2.2 Gelassenheit im Alter
- 9. Entwicklung und Gesundheit in Verbindung zu Resilienz
- 9.1 Studie „Führung, Gesundheit und Resilienz“
- 9.2 Gesundheit am Arbeitsplatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss menschlicher Beziehungen auf die Entwicklung und Förderung von Resilienz. Ziel ist es, die Bedeutung von Resilienz im Kontext der Pädagogik zu beleuchten und praktische Möglichkeiten zur Resilienzförderung aufzuzeigen.
- Definition und aktuelle Forschung zu Resilienz
- Resilienz als Schlüsselkompetenz im digitalen Zeitalter
- Stressoren und Bewältigungsmechanismen im Zusammenhang mit Resilienz
- Resilienzförderung in der Pädagogik (Kindheit und Erwachsenenbildung)
- Resilienz und Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Resilienz ein und veranschaulicht dessen Relevanz im Kontext aktueller Herausforderungen. Kapitel 2 definiert Resilienz und ordnet sie in den erziehungswissenschaftlichen Forschungsdiskurs ein. Kapitel 3 beschäftigt sich mit Ressourcen, Anforderungen und Stressoren, die die Entwicklung von Resilienz beeinflussen. Kapitel 4 präsentiert verschiedene Forschungsstudien zum Thema Resilienz. Kapitel 5 analysiert Stresssituationen und menschliches Verhalten im Umgang damit. Kapitel 6 befasst sich mit weiteren Konzepten der Resilienz und deren Förderung, einschließlich verschiedener Programme und Trainingsmethoden. Kapitel 7 widmet sich der Bedeutung von Resilienz in der Pädagogik, mit Fokus auf die frühkindliche Entwicklung und die Integration von Resilienz in Bildungsplänen. Kapitel 8 beleuchtet das Arbeitsfeld der Pädagogik im Hinblick auf Präventions- und Interventionsmaßnahmen sowie Konzepte zur Resilienzförderung in der Erwachsenenbildung. Kapitel 9 untersucht den Zusammenhang zwischen Entwicklung, Gesundheit und Resilienz anhand ausgewählter Studien.
Schlüsselwörter
Resilienz, menschliche Beziehungen, gesunde Entwicklung, Stressoren, Resilienzforschung, Resilienzförderung, Pädagogik, Erwachsenenbildung, Kindheitsforschung, Prävention, Intervention, Gesundheit.
- Arbeit zitieren
- Corinna Brüssel (Autor:in), 2020, Resilienz, menschliche Beziehungen und gesunde Entwicklung. Voraussetzungen und Möglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1510303