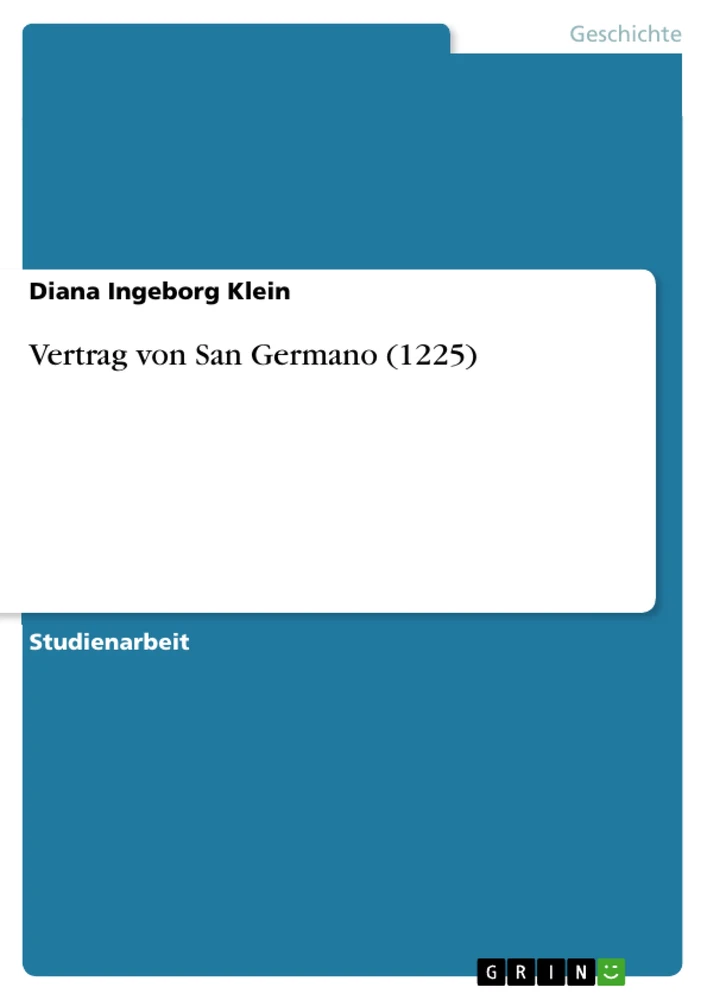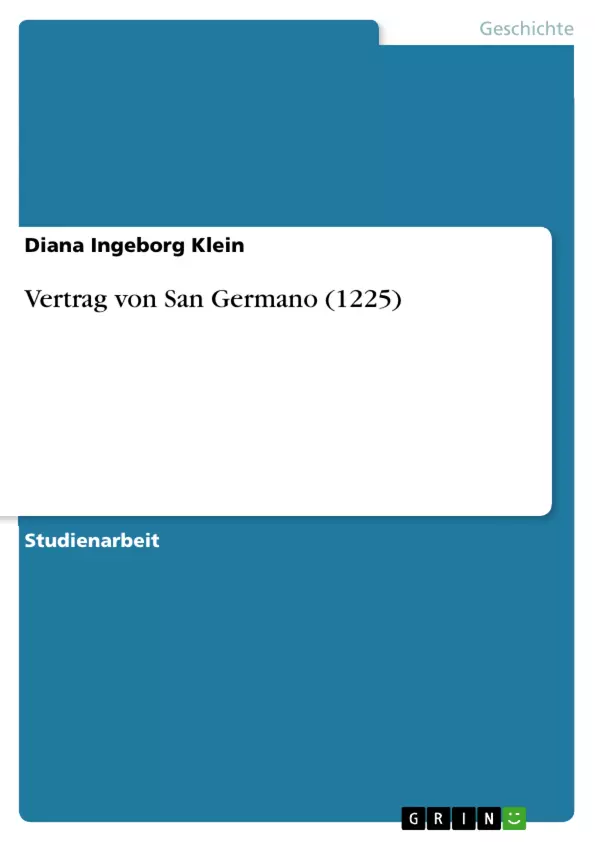Angesichts der vielfältigen Aktivitäten des letzten Stauferkaisers Friedrich II. im naturwissenschaftlichen, architektonischen, legislativen, sprachlich-kulturellen, zoologischen, künstlerischen und vielen weiteren Bereichen, stellt er bis heute eine faszinierende Persönlichkeit dar, die ihrer Zeit oftmals ein Stück voraus zu sein schien. Die sich weiterhin anhäufenden Beiträge zur Forschung spiegeln aber vor allem das Interesse an seiner historischen Gestalt als Herrscher wieder. Bisher existiert eine kritisch edierte Sammlung seiner Urkundenteile die gerade einmal bis in das Jahr 1212 reicht. Damit sind die Publikationen zu Friedrich II. also keineswegs abgeschlossen, sondern stets in Bearbeitung. Als der Staufer dem Papst gelobte einen Kreuzzug persönlich anzutreten, trat er damit in die Fußstapfen seines Großvaters Barbarossa und seines Vaters Heinrich VI. Dies sollte ihm in späteren Jahren neben der Königskrone zu Sizilien, zu Deutschland und seit 1220 der Kaiserkrone auch die Krone zu Jerusalem einbringen, die er sich selbst aufs Haupt setzte. Bis der Kreuzzug jedoch stattfand, kam es vorerst zu etlichen Komplikationen, denn Friedrich verschob sein Gelübde mehrere Male. Was waren seine Motive dafür? War es ihm wirklich ernst einen „gerechten und gottgefälligen Krieg“ zu realisieren oder ging es ihm vielmehr um die Aufmerksamkeit des Papstes und der gesamten Christenheit? Der Vertrag von San Germano stellt bei dieser Thematik einen bedeutenden Wendepunkt dar und soll daher innerhalb dieser Arbeit im Vordergrund stehen. Dazu ist es notwendig die Umstände seiner Entstehung, seines Inhalts und seiner Folgen zu kennen. Nur so lässt sich über die Ereignisse des Kreuzzuges, der im Jahre 1227 folgenden Exkommunikation des staufischen Herrschers und sein Denken und Handeln als Kind seiner Zeit urteilen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Bemühungen Friedrichs II. um einen Kreuzzug
- II.1. Wiederholte Aufschübe des Kreuzzugsgelübdes
- III. Der Vertrag von San Germano (1225)
- III.1. Der Vertragsinhalt
- III.2. Die Bedeutung der Zugeständnisse für Friedrich II.
- III.3. Die Bedeutung für den Papst und die Kurie
- IV. Fazit
- V. Quellen- und Literaturverzeichnis
- V.1. Quellen
- V.2. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Vertrag von San Germano aus dem Jahr 1225, der einen Wendepunkt in den Bemühungen Kaiser Friedrichs II. um einen Kreuzzug darstellt. Ziel ist es, die Entstehungsgeschichte des Vertrages, seinen Inhalt und seine Folgen zu beleuchten, um so die Motivationen und das Handeln Friedrichs II. im Kontext der Kreuzzüge zu verstehen.
- Friedrichs II. Bemühungen um einen Kreuzzug
- Die Aufschübe des Kreuzzugsgelübdes
- Der Vertragsinhalt von San Germano
- Die Bedeutung des Vertrages für Friedrich II. und den Papst
- Die Folgen des Vertrages für die Kreuzzüge
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die vielseitigen Aktivitäten Friedrichs II. ein und stellt die Bedeutung seiner Herrscherrolle heraus. Sie erläutert den Kontext des Kreuzzugsgelübdes und die Herausforderungen, denen Friedrich gegenüberstand.
Kapitel II beleuchtet die Bemühungen Friedrichs II. um einen Kreuzzug, seine zahlreichen Aufschübe des Gelübdes und seine strategischen Schritte zur Mobilisierung der Ressourcen und der Unterstützung für das Unternehmen.
Kapitel III analysiert den Vertrag von San Germano, seine Inhalte und seine Bedeutung für die beteiligten Parteien. Die Analyse konzentriert sich auf die Zugeständnisse für Friedrich II. und die Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Kaiser und Papst.
Schlüsselwörter
Der Vertrag von San Germano, Kreuzzüge, Friedrich II., Papsttum, Staufer, Italien, Jerusalem, Kreuzzugsgelübde, Exkommunikation, Herrscherpolitik, Papst Honorius III., Geschichte des Mittelalters.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Inhalt des Vertrags von San Germano (1225)?
Im Vertrag verpflichtete sich Kaiser Friedrich II. gegenüber dem Papst, spätestens im August 1227 einen Kreuzzug anzutreten, andernfalls drohte ihm die Exkommunikation.
Warum verschob Friedrich II. sein Kreuzzugsgelübde mehrmals?
Gründe waren unter anderem die notwendige Konsolidierung seiner Herrschaft in Sizilien und Deutschland sowie die Mobilisierung ausreichender Ressourcen für das Unternehmen.
Welche Bedeutung hatte der Vertrag für Papst Honorius III.?
Für den Papst war der Vertrag ein Mittel, den Kaiser zur Erfüllung seiner religiösen Pflichten zu zwingen und die Autorität der Kirche über die weltliche Macht zu behaupten.
Kam es nach dem Vertrag zur Exkommunikation Friedrichs II.?
Ja, als Friedrich den Kreuzzug 1227 wegen einer Seuche im Heer erneut abbrechen musste, wurde er von Papst Gregor IX. exkommuniziert.
Welche Krone setzte sich Friedrich II. im Rahmen der Kreuzzüge selbst auf?
Friedrich II. setzte sich 1229 in der Grabeskirche selbst die Krone von Jerusalem aufs Haupt, was ein Novum in der Geschichte der Kreuzzüge war.
- Arbeit zitieren
- Diana Ingeborg Klein (Autor:in), 2005, Vertrag von San Germano (1225), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151033