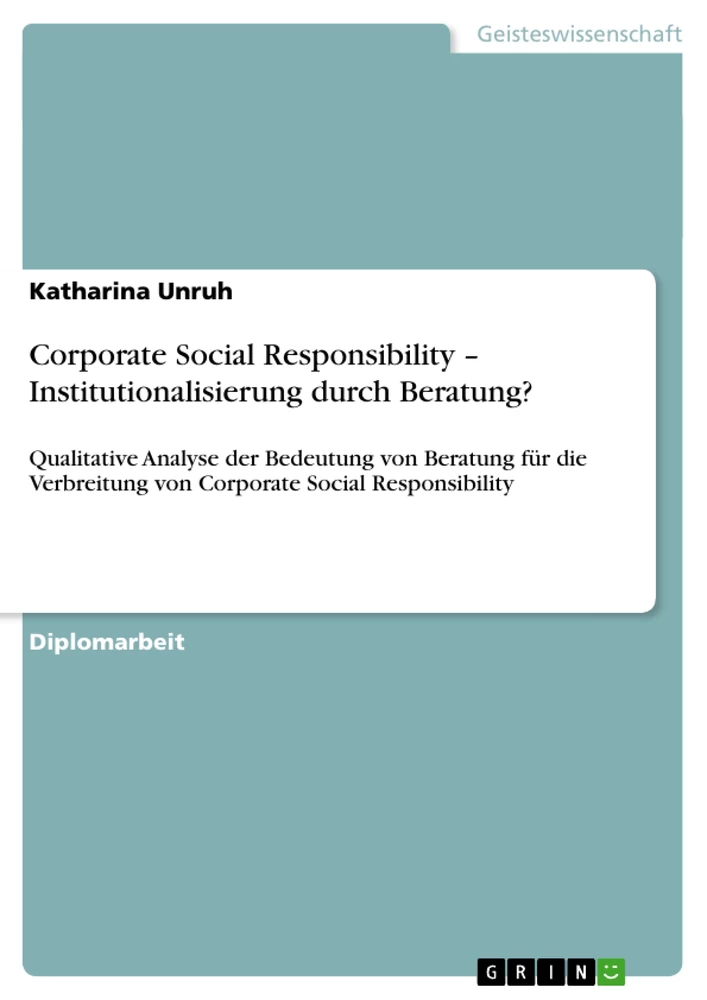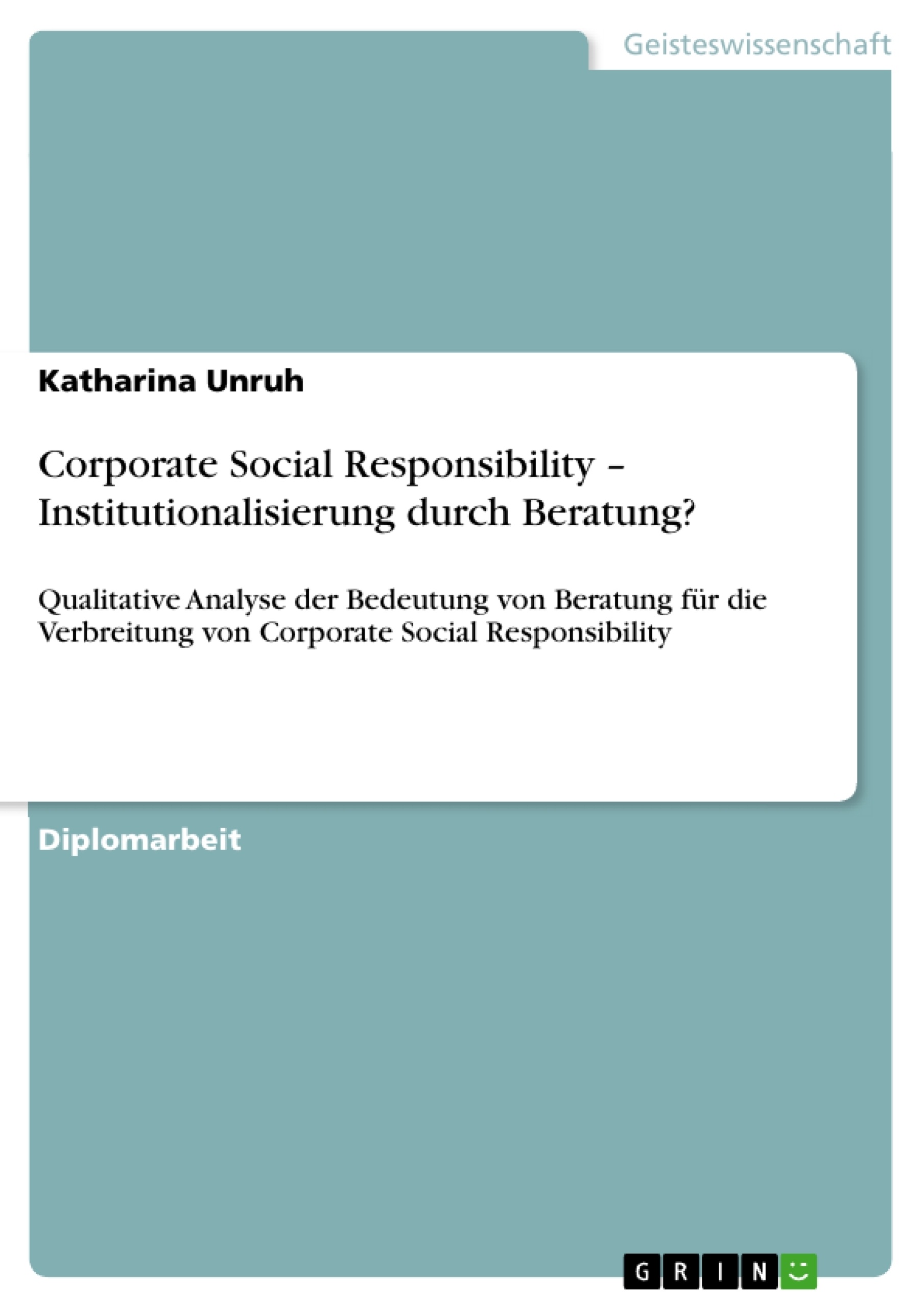In der Arbeit wird die Bedeutung von Beratung für die Verbreitung von Corporate Social Responsibility (CSR) herausgestellt. Dabei wurde die Verbreitung auf zwei Ebenen untersucht: zum einen auf der intraorganisationalen Ebene – wie wird CSR von Beratern in den Unternehmen implementiert? Und zum anderen auf der transorganisationalen Ebene – welcher Mechanismen und Wege bedienen sich Berater, um CSR als Thema für die Unternehmen relevant erscheinen und zusätzlich auch gesamtgesellschaftlich an Bedeutung gewinnen zu lassen?
Zunächst wurde im ersten Teil das Themenfeld CSR umgrenzt. Daraufhin wurde im zweiten Abschnitt anhand des Neo-Institutionalismus und vertiefend mit Hilfe der Managementsoziologieliteratur die generelle Bedeutung von Beratung und speziell ihre Rolle bei der Verbreitung von Managementwissen beschrieben. Mittels qualitativer Experteninterviews mit CSR-Beratern erlangte ich Erkenntnisse über das Beratungsfeld CSR, die daraufhin mit den theoretischen Ausführungen zusammen geführt wurden. Die Diskussion der Ergebnisse ergab, dass Beratung eine wichtige Rolle bei der Diffusion von CSR zukommt, wobei allerdings weitere Akteure in diesem Prozess zu berücksichtigen sind und abzuwarten bleibt, ob sich CSR als Managementwissen institutionalisiert und welche Bedeutung Beratung dabei zukommt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Corporate Social Responsibility (CSR)
- 2.1 Begriffserläuterung
- 2.1.1 Begriffsabgrenzungen
- 2.1.2 CSR im Stakeholderdiskurs
- 2.2 Handlungsfelder und Formen der sozialen Verantwortung
- 2.2.1 Innerer Verantwortungsbereich: Markt und Gesetz
- 2.2.2 Mittlerer Verantwortungsbereich: Freiwillige CSR in der Wertschöpfungskette
- 2.2.3 Äußerer Verantwortungsbereich: Freiwillige CSR außerhalb der Wertschöpfungskette
- 2.3 Ergebnisse zur CSR bei deutschen Unternehmen
- 3 Beratung
- 3.1 Begriffserläuterung Beratung
- 3.2 Begriffserläuterung von Unternehmensberatung
- 3.3 Ansätze ethischer Unternehmensberatung
- 3.4 Besonderheiten ethischer Beratung
- 3.5 Beratung im Neo-Institutionalismus
- 3.5.1 Grundannahmen im Neo-Institutionalismus
- 3.5.2 Rolle von Beratung im Neo-Institutionalismus
- 3.6 Beitrag von Beratung bei der Verbreitung von Managementwissen
- 3.6.1 Selbstverständlichkeit von Beratung
- 3.6.2 Einfluss auf Verbreitung
- 4 Empirie
- 4.1 Methodik
- 4.1.1 Experteninterview
- 4.1.2 Auswertung
- 4.2 Auswahl der Untersuchungsgruppe
- 4.3 Datenerhebung
- 4.3.1 Der Leitfaden
- 4.3.2 Transkription
- 5 Clusteranalyse der Interviews
- 5.1 Beratungsgegenstand CSR
- 5.1.1 Besonderheiten
- 5.1.2 Vorwissen der Unternehmen
- 5.2 Einfluss von Beratung
- 5.2.1 Themensetzung durch Berater
- 5.2.2 Erklärungsmuster der Berater
- 5.3 Qualitative Verbreitung
- 5.3.1 Was
- 5.3.1.1 CSR-Verständnis
- 5.3.1.2 Glaubwürdigkeit, Authentizität
- 5.3.2 Wie Beratungsprozess
- 5.3.3 Wer
- 5.3.3.1 CSR-Beratungsfeld
- 5.3.3.2 Ursprung von Knowhow
- 5.3.3.3 Selbstverständnis der Berater
- 5.4 Quantitative Verbreitung
- 5.4.1 Einflusskanäle
- 5.4.2 (unterstützende) CSR-Akteure
- 5.4.3 Beratene Unternehmen
- 5.5 Zusammenfassung der Clusteranalyse
- 6 Diskussion der Ergebnisse
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Beratung für die Verbreitung von Corporate Social Responsibility (CSR). Die Analyse betrachtet sowohl die intraorganisationale Implementierung von CSR durch Berater als auch die transorganisationale Verbreitung von CSR als gesellschaftlich relevantes Thema. Die Studie zielt darauf ab, die Rolle der Beratung im Institutionalisierungsprozess von CSR zu verstehen.
- Die Bedeutung von Beratung für die Verbreitung von CSR
- Intraorganisationaler und transorganisationaler Aspekt der CSR-Verbreitung
- Der Einfluss von Beratern auf die Themensetzung und das Verständnis von CSR
- Die Rolle von Beratung im Institutionalisierungsprozess von CSR
- Weitere Akteure im Prozess der CSR-Diffusion
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt den Forschungsfokus auf die Rolle von Beratung bei der Verbreitung von Corporate Social Responsibility (CSR). Sie skizziert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der qualitativen Analyse.
2 Corporate Social Responsibility (CSR): Dieses Kapitel definiert den Begriff CSR und grenzt ihn von anderen Konzepten ab. Es diskutiert CSR im Kontext des Stakeholder-Diskurses und analysiert verschiedene Handlungsfelder und Formen sozialer Verantwortung, die von Unternehmen wahrgenommen werden können – vom inneren Verantwortungsbereich (Markt und Gesetz) über den mittleren (freiwillige CSR in der Wertschöpfungskette) bis zum äußeren Verantwortungsbereich (freiwillige CSR außerhalb der Wertschöpfungskette). Weiterhin werden Ergebnisse zu CSR bei deutschen Unternehmen vorgestellt, die als Grundlage für die weitere Analyse dienen.
3 Beratung: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem Thema Beratung. Es klärt die Begriffe Beratung und Unternehmensberatung, untersucht verschiedene Ansätze ethischer Unternehmensberatung und deren Besonderheiten. Ein zentraler Punkt ist die Einbettung des Beratungsprozesses in den neo-institutionalistischen Rahmen. Dabei wird die Rolle der Beratung bei der Verbreitung von Managementwissen im Allgemeinen und im Kontext von CSR im Speziellen beleuchtet. Es wird untersucht, inwiefern Beratung zur Selbstverständlichkeit geworden ist und wie sie die Verbreitung von Managementpraktiken beeinflusst.
4 Empirie: Das Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Durchführung qualitativer Experteninterviews mit CSR-Beratern, die Auswahl der Interviewpartner und die Auswertung der Daten. Der Leitfaden für die Interviews wird vorgestellt und die Transkription der Gespräche beschrieben.
5 Clusteranalyse der Interviews: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Clusteranalyse der durchgeführten Experteninterviews. Es analysiert den Beratungsgegenstand CSR, den Einfluss von Beratung auf die Themensetzung und das Verständnis von CSR, sowie qualitative und quantitative Aspekte der Verbreitung von CSR. Es werden verschiedene Akteure und Einflusskanäle im Prozess der CSR-Verbreitung identifiziert und beschrieben, darunter das Selbstverständnis der Berater, der Ursprung ihres Know-hows und das CSR-Verständnis der befragten Unternehmen.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility (CSR), Beratung, Neo-Institutionalismus, Managementwissen, Qualitative Analyse, Experteninterviews, Diffusion, Institutionalisierung, Stakeholder, Wertschöpfungskette, Unternehmensethik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Die Rolle der Beratung bei der Verbreitung von Corporate Social Responsibility (CSR)
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Unternehmensberatung für die Verbreitung von Corporate Social Responsibility (CSR). Der Fokus liegt sowohl auf der innerbetrieblichen Umsetzung (intraorganisational) als auch auf der überbetrieblichen Verbreitung (transorganisational) von CSR als gesellschaftlich relevantes Thema. Es geht darum zu verstehen, wie Beratung den Institutionalisierungsprozess von CSR beeinflusst.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: die Definition und Abgrenzung von CSR, verschiedene Handlungsfelder und Formen sozialer Verantwortung, die Rolle der Beratung bei der Verbreitung von Managementwissen, ethische Aspekte der Unternehmensberatung im Kontext von CSR, die Methodik der qualitativen Forschung (Experteninterviews), die Clusteranalyse der Interviewergebnisse, und die Identifizierung relevanter Akteure und Einflusskanäle bei der CSR-Diffusion.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf qualitativen Experteninterviews mit CSR-Beratern. Die Auswahl der Interviewpartner, die Durchführung der Interviews (mit Leitfaden), die Transkription der Gespräche und die anschließende Clusteranalyse der Daten werden detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Clusteranalyse der Experteninterviews liefert Erkenntnisse zum Beratungsgegenstand CSR, zum Einfluss von Beratern auf die Themensetzung und das Verständnis von CSR, sowie zu qualitativen und quantitativen Aspekten der CSR-Verbreitung. Die Analyse identifiziert verschiedene Akteure (Berater, Unternehmen, unterstützende Organisationen) und Einflusskanäle im Prozess der CSR-Diffusion. Es werden Besonderheiten des CSR-Beratungsfelds, das Vorwissen der Unternehmen und das Selbstverständnis der Berater beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Corporate Social Responsibility (CSR), Beratung, Empirie (Methodenbeschreibung), Clusteranalyse der Interviews (Ergebnisse), Diskussion der Ergebnisse und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Corporate Social Responsibility (CSR), Beratung, Neo-Institutionalismus, Managementwissen, Qualitative Analyse, Experteninterviews, Diffusion, Institutionalisierung, Stakeholder, Wertschöpfungskette und Unternehmensethik.
Wie ist der Begriff CSR definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff CSR und grenzt ihn von anderen Konzepten ab. Es werden verschiedene Handlungsfelder und Formen sozialer Verantwortung unterschieden: innerer Verantwortungsbereich (Markt und Gesetz), mittlerer Verantwortungsbereich (freiwillige CSR in der Wertschöpfungskette) und äußerer Verantwortungsbereich (freiwillige CSR außerhalb der Wertschöpfungskette).
Welche Rolle spielt der Neo-Institutionalismus?
Der Neo-Institutionalismus bietet einen theoretischen Rahmen für die Analyse des Beratungsprozesses und der Verbreitung von CSR. Die Arbeit untersucht, wie Beratung im neo-institutionalistischen Kontext die Verbreitung von Managementwissen und die Institutionalisierung von CSR beeinflusst.
Welche Akteure beeinflussen die Verbreitung von CSR?
Die Studie identifiziert verschiedene Akteure, die die Verbreitung von CSR beeinflussen, darunter CSR-Berater, Unternehmen, und unterstützende Organisationen. Die Analyse betrachtet den Einfluss dieser Akteure auf die Themensetzung, das Verständnis von CSR und die Implementierung von CSR-Maßnahmen.
- Citar trabajo
- Katharina Unruh (Autor), 2007, Corporate Social Responsibility – Institutionalisierung durch Beratung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151088