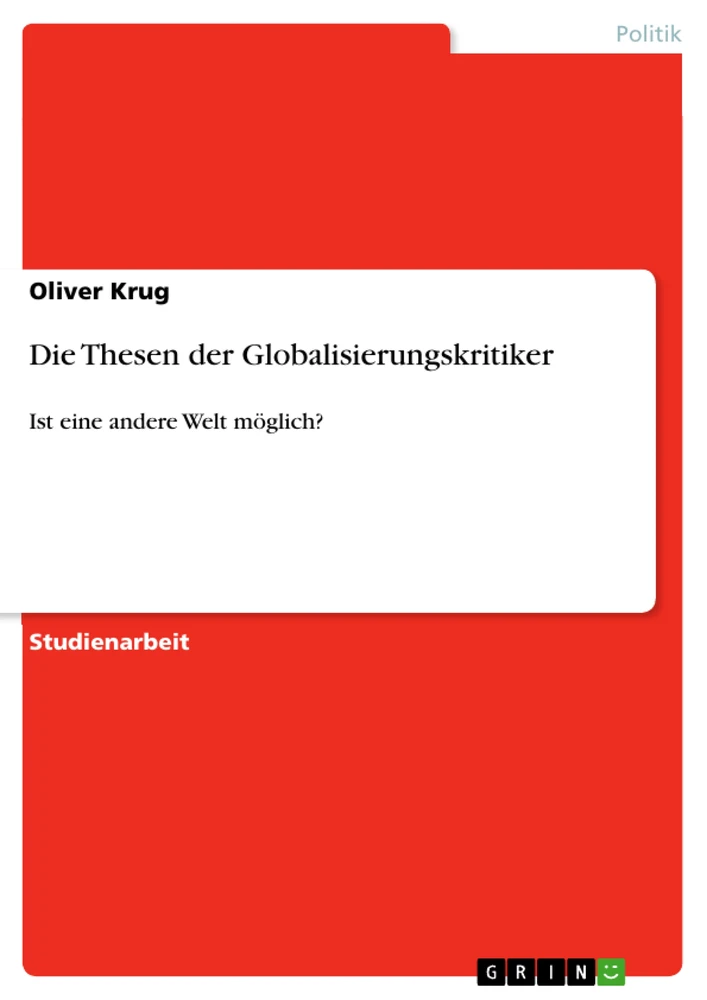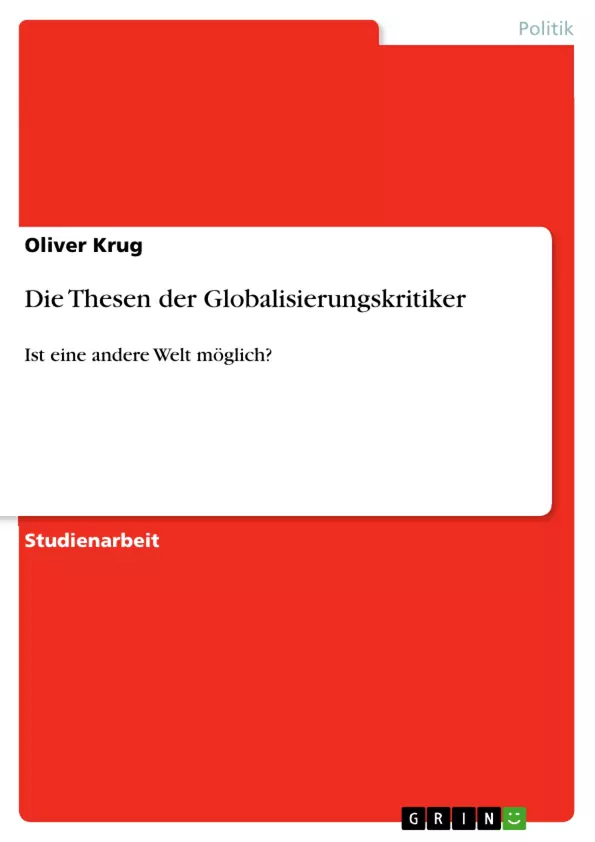[...]
Doch was treibt diese enorme globale Protestbewegung an, die für stetig wachsende Mitgliederzahlen in globalisierungskritischen Organisationen verantwortlich ist?
Die Erläuterung der zahlreichen Motive von Menschen, welche bereit sind – offensichtlich auch unter Lebensgefahr – öffentlich ihre Meinungen über die Auswirkungen einer globalisierten Welt kundzutun, soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Als Einstieg wird zunächst ein grundsätzlicher Überblick über den Term
„Globalisierung“ sowie über relevante Akteure im weltpolitischen Geschehen gegeben. Im verbleibenden Hauptteil der Ausarbeitung werden sodann ausgewählte Thesen der Globalisierungskritiker aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet sowie zugehörige Lösungs- oder Änderungsvorschläge kritisch analysiert.
Diese Seminararbeit unternimmt den Versuch, innerhalb des breiten Themenfeldes der Globalisierungskritik, diverse Argumente der Globalisierungskritiker aufzugreifen und
anschließend zu beurteilen, inwieweit diese positiv zur Veränderung der Weltwirtschaft beitragen können.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Zielsetzung der Arbeit
- 2. Illustrierung: Globalisierung
- 2.1 Allgemeine Kennzeichen der Globalisierung
- 2.2 Globale Akteure und Vereinbarungen
- 3. Hintergründe der Globalisierungskritik
- 3.1 Eingrenzung: Wer sind die Globalisierungskritiker?
- 3.2 Darstellung ausgewählter kritischer Thesen
- 3.2.1 Veränderung der globalen Einkommensstruktur durch Handelsliberalisierung?
- 3.2.2 Führt das Finanzsystem zum Kurzschluss?
- 3.2.3 Ökologische Belastung durch wirtschaftliche Globalisierung?
- 3.2.4 Gravierende Defizite der WTO zu Lasten der Dritten Welt?
- 4. Resultate und Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Motive der Globalisierungskritik und analysiert ausgewählte kritische Thesen. Das Ziel ist es, die Argumente der Kritiker zu beleuchten und deren potenziellen Beitrag zu einer Veränderung der Weltwirtschaft zu beurteilen.
- Analyse der Motive der Globalisierungskritik
- Bewertung ausgewählter kritischer Thesen zur Globalisierung
- Untersuchung der Auswirkungen der Globalisierung auf die Einkommensverteilung
- Beurteilung der Rolle des Finanzsystems in der Globalisierungskritik
- Analyse der ökologischen Folgen der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit beginnt mit einer Schilderung von Gipfeltreffen der Industrienationen und dem damit verbundenen Protest. Sie führt den Leser in die Thematik der Globalisierungskritik ein und erläutert die Zielsetzung: die Analyse der Motive der Globalisierungskritiker und die kritische Auseinandersetzung mit deren Argumenten. Die Arbeit verspricht einen Überblick über den Begriff „Globalisierung“ und relevante Akteure, gefolgt von einer Betrachtung ausgewählter Thesen der Kritiker und deren Lösungsvorschläge.
2. Illustrierung: Globalisierung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Begriff „Globalisierung“ und dessen Kennzeichen. Es betont die zunehmende Vernetzung in politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen sowie den freien Austausch von Waren, Kapital, Dienstleistungen, Menschen und Ideen. Die rasante Steigerung des Welthandelsvolumens zwischen 1950 und 2000 wird als wichtiges Beispiel angeführt und durch eine Abbildung visualisiert. Der Einfluss von Faktoren wie dem Preisverfall in Transport und Kommunikation, der globalen Migration und dem technischen Fortschritt auf die Zunahme multinationaler Unternehmen wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Globalisierungskritik, Globalisierung, Weltwirtschaft, Handelsliberalisierung, Finanzsystem, ökologische Belastung, WTO, Einkommensverteilung, Protestbewegung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Globalisierungskritik
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Motive der Globalisierungskritik und analysiert ausgewählte kritische Thesen. Ziel ist die Beleuchtung der Argumente der Kritiker und die Beurteilung ihres potenziellen Beitrags zur Veränderung der Weltwirtschaft.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse der Motive der Globalisierungskritik, die Bewertung ausgewählter kritischer Thesen, die Untersuchung der Auswirkungen der Globalisierung auf die Einkommensverteilung, die Beurteilung der Rolle des Finanzsystems in der Globalisierungskritik und die Analyse der ökologischen Folgen der Globalisierung.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einführung mit Zielsetzung, eine Erläuterung des Begriffs Globalisierung, eine Darstellung ausgewählter kritischer Thesen zur Globalisierung und abschließende Resultate und Schlussbetrachtungen. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Globalisierung und ihre Kennzeichen, während Kapitel 3 sich detailliert mit verschiedenen kritischen Thesen auseinandersetzt (z.B. Veränderung der globalen Einkommensstruktur, das Finanzsystem, ökologische Belastung, Defizite der WTO).
Welche konkreten kritischen Thesen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert kritische Thesen bezüglich der Veränderung der globalen Einkommensstruktur durch Handelsliberalisierung, die Auswirkungen des Finanzsystems, die ökologische Belastung durch wirtschaftliche Globalisierung und mögliche gravierende Defizite der WTO zu Lasten der Dritten Welt.
Wer wird als Globalisierungskritiker betrachtet?
Die Arbeit grenzt den Begriff "Globalisierungskritiker" ein, um die Perspektive und die Akteure der Kritik präzise zu definieren (Kapitel 3.1).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Globalisierungskritik, Globalisierung, Weltwirtschaft, Handelsliberalisierung, Finanzsystem, ökologische Belastung, WTO, Einkommensverteilung, Protestbewegung.
Wie beginnt die Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Schilderung von Gipfeltreffen der Industrienationen und den damit verbundenen Protesten, um den Leser in die Thematik einzuführen.
Welche Rolle spielt die Abbildung des Welthandelsvolumens?
Die rasante Steigerung des Welthandelsvolumens zwischen 1950 und 2000 wird als wichtiges Beispiel für die Globalisierung angeführt und durch eine Abbildung visualisiert (Kapitel 2).
Welche Faktoren beeinflussen die Globalisierung laut der Arbeit?
Preisverfall in Transport und Kommunikation, globale Migration und technischer Fortschritt werden als Einflussfaktoren auf die Zunahme multinationaler Unternehmen und die Globalisierung im Allgemeinen diskutiert (Kapitel 2).
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit findet sich in Kapitel 4 ("Resultate und Schlussbetrachtungen"), welches die Ergebnisse der Analyse der Globalisierungskritik zusammenfasst und Schlussfolgerungen zieht.
- Arbeit zitieren
- Oliver Krug (Autor:in), 2010, Die Thesen der Globalisierungskritiker, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151107