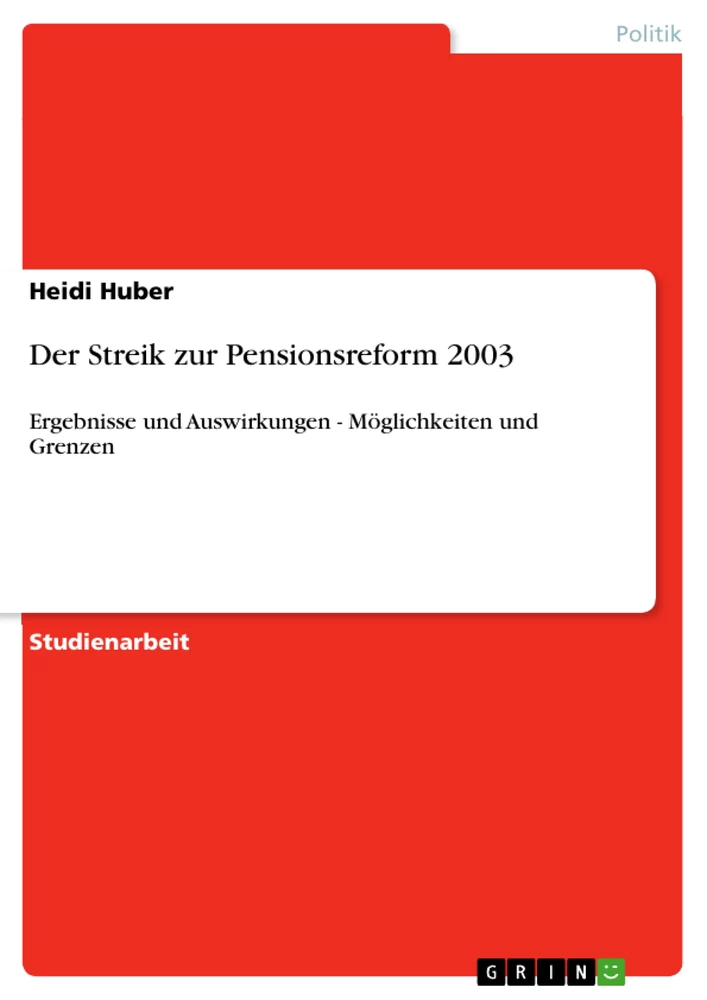„In fünf Wochen kann ich einen Zwerghasen kriegen,
aber keine vernünftige und gerechte Pensionsreform“
(Fritz Dinkhauser, AK-Präsident Tirol)
Problemstellung und Relevanz des Themas
Österreich streikt! Im Jahr 2003 wurde von den Gewerkschaften der größte Streik der Zweiten Republik organisiert. Federführend im Streikjahr 2003 zeigt sich der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB). Die geplante Pensionsreform der schwarz-blauen Regierung gab den Anlass für 200.000 Arbeitnehmer, bei strömendem Regen am 13. Mai aufzumarschieren. Unter dem Motto „Reformieren statt Abkassieren“ demonstrierten sie am Wiener Heldenplatz. Am 3. Juni streiken österreichweit eine Million Menschen in 18.000 Betrieben, Dienststellen und Unternehmungen gegen die Pläne der Regierung Schüssels, nachdem man sich in fünf „Runden Tischen“ nicht näher gekommen ist.
Unbeeindruckt von den Maßnahmen der Gewerkschaften beschließt die schwarz-blaue Regierung, allen voran Kanzler Schüssel, die Regierungsvorlage zur Pensionsreform mit wenigen Abstrichen und mit wenig Berücksichtigung der Forderung der Sozialpartner bereits einen Tag nach dem Großstreik. Der ÖGB konnte zwar bei den Zumutbarkeitsbestimmungen Kompromisse aushandeln, die Positionen zur Harmonisierung und zur Schwerarbeiterregelung fanden aber keine Durchsetzung.
[...]
Was übrig blieb war ein Aufbäumen des ÖGB, der den Großteil seiner Mitglieder hinter sich scharen konnte und zurückkehrte auf die innenpolitische Bühne, die Ergebnisse aber letztendlich nicht zugunsten seiner Interessen durchsetzen konnte. Das lag schon allein daran, dass die Forderung von vornherein eine vollständige Zurücknahme der Pensionsreform beinhaltete – ein strategischer Fehler, wie sich später herausstellte. Damit konnte die Gewerkschaft nur als Verlierer aus den Verhandlungen gehen. Die Tatsache, dass die Arbeiterkammer nur eine marginale Rolle einnahm, verwundert zu diesem Zeitpunkt der Untersuchung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Relevanz des Themas
- Zentrale Fragestellungen und Hypothesen
- Methodik
- Aufbau der Arbeit
- Sozialpartnerschaft und Streik – conditio sine qua non?
- Streik und seine Bedeutung
- Historischer Abriss über die Rolle und Bedeutung der Sozialpartner bis 2003
- Österreichische Streikkultur der Zweiten Republik
- Die Einstellung der Bevölkerung zur Sozialpartnerschaft und zu den Streiktätigkeiten
- Der Streik zur Pensionsreform 2003
- Die Pensionsreform im Detail
- Einbindung und Positionierung der Sozialpartner
- Österreich streikt!
- Ergebnis und Auswirkungen der Streikmaßnahmen
- Konklusion
- Resümee
- Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Streik zur Pensionsreform 2003 in Österreich und analysiert dessen Ergebnisse und Auswirkungen auf die Sozialpartnerschaft und das Verhältnis zwischen Gewerkschaft und Regierung. Sie untersucht die Rolle des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) und die Reaktion der Bevölkerung auf die Streikmaßnahmen.
- Die Bedeutung des Streiks als Instrument der Einflussnahme der Gewerkschaften
- Die Rolle der Sozialpartnerschaft in Österreich und ihre Entwicklung bis 2003
- Die Auswirkungen der Pensionsreform 2003 auf die österreichische Gesellschaft
- Die strategischen Entscheidungen des ÖGB im Kontext des Streiks
- Die Folgen des Streiks für das Verhältnis zwischen Gewerkschaft und Regierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Relevanz des Themas dar, formuliert die Forschungsfragen und Hypothesen und beschreibt die Methodik der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet das Thema Streik und Sozialpartnerschaft in Österreich, indem es einen historischen Abriss über die Rolle der Sozialpartner bis 2003 liefert und die österreichische Streikkultur der Zweiten Republik beleuchtet. Kapitel 3 befasst sich mit dem Streik zur Pensionsreform 2003 im Detail, analysiert die Positionen der Regierung und der Sozialpartner, beschreibt die Streikmaßnahmen und untersucht die Ergebnisse und Auswirkungen auf die Pensionsreform sowie auf die Sozialpartnerschaft und das Verhältnis zur Regierung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Streik, Sozialpartnerschaft, Pensionsreform, Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB), Regierung, Politik, Einflussnahme, Ergebnisse, Auswirkungen, historische Entwicklung, Zweite Republik, Österreich.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass für den großen Streik in Österreich im Jahr 2003?
Der Anlass war die geplante Pensionsreform der schwarz-blauen Regierung unter Kanzler Wolfgang Schüssel.
Wie viele Menschen beteiligten sich an den Protesten?
Am 13. Mai demonstrierten 200.000 Menschen in Wien, und am 3. Juni streikten österreichweit rund eine Million Menschen in 18.000 Betrieben.
Konnte der ÖGB seine Forderungen durchsetzen?
Nur teilweise. Während Kompromisse bei den Zumutbarkeitsbestimmungen erzielt wurden, beschloss die Regierung die Reform weitgehend ohne Berücksichtigung der gewerkschaftlichen Kernforderungen.
Welcher strategische Fehler wird der Gewerkschaft in der Arbeit zugeschrieben?
Die Forderung nach einer vollständigen Zurücknahme der Pensionsreform wird als strategischer Fehler gewertet, da dies Verhandlungen von vornherein erschwerte.
Welche Rolle spielte die Arbeiterkammer (AK) während des Streiks?
Die Untersuchung stellt fest, dass die Arbeiterkammer zu diesem Zeitpunkt eine eher marginale Rolle einnahm.
Wie veränderte der Streik die österreichische Sozialpartnerschaft?
Die Arbeit analysiert, wie der Streik das traditionelle Gefüge der Sozialpartnerschaft und das Verhältnis zwischen Gewerkschaft und Regierung dauerhaft beeinflusste.
- Citar trabajo
- BA Bakk.Komm. Heidi Huber (Autor), 2010, Der Streik zur Pensionsreform 2003, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151108