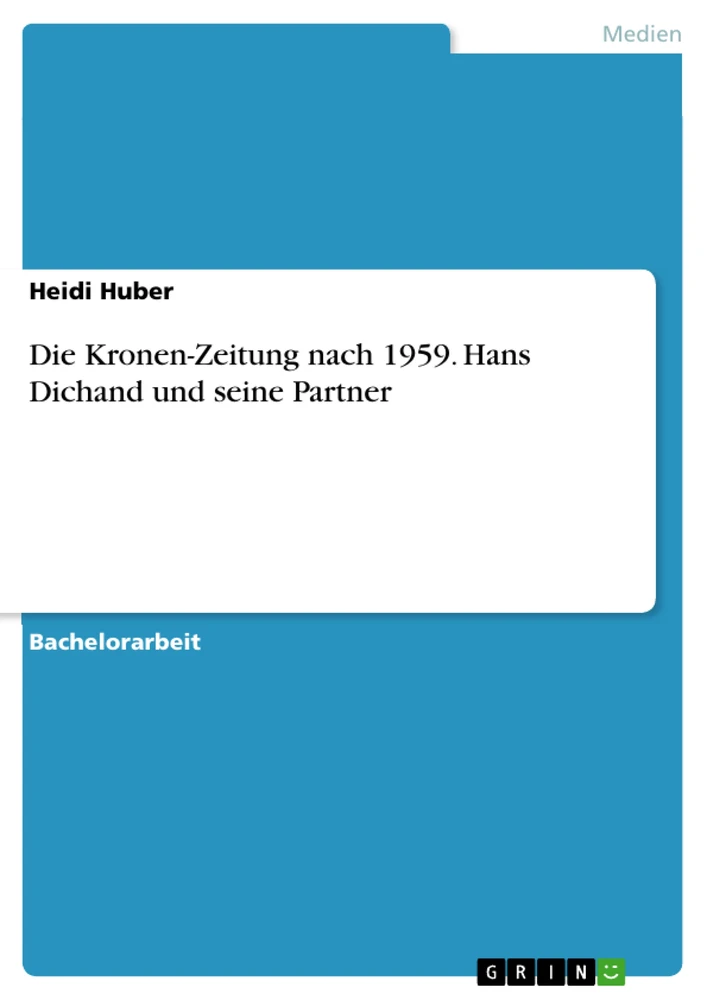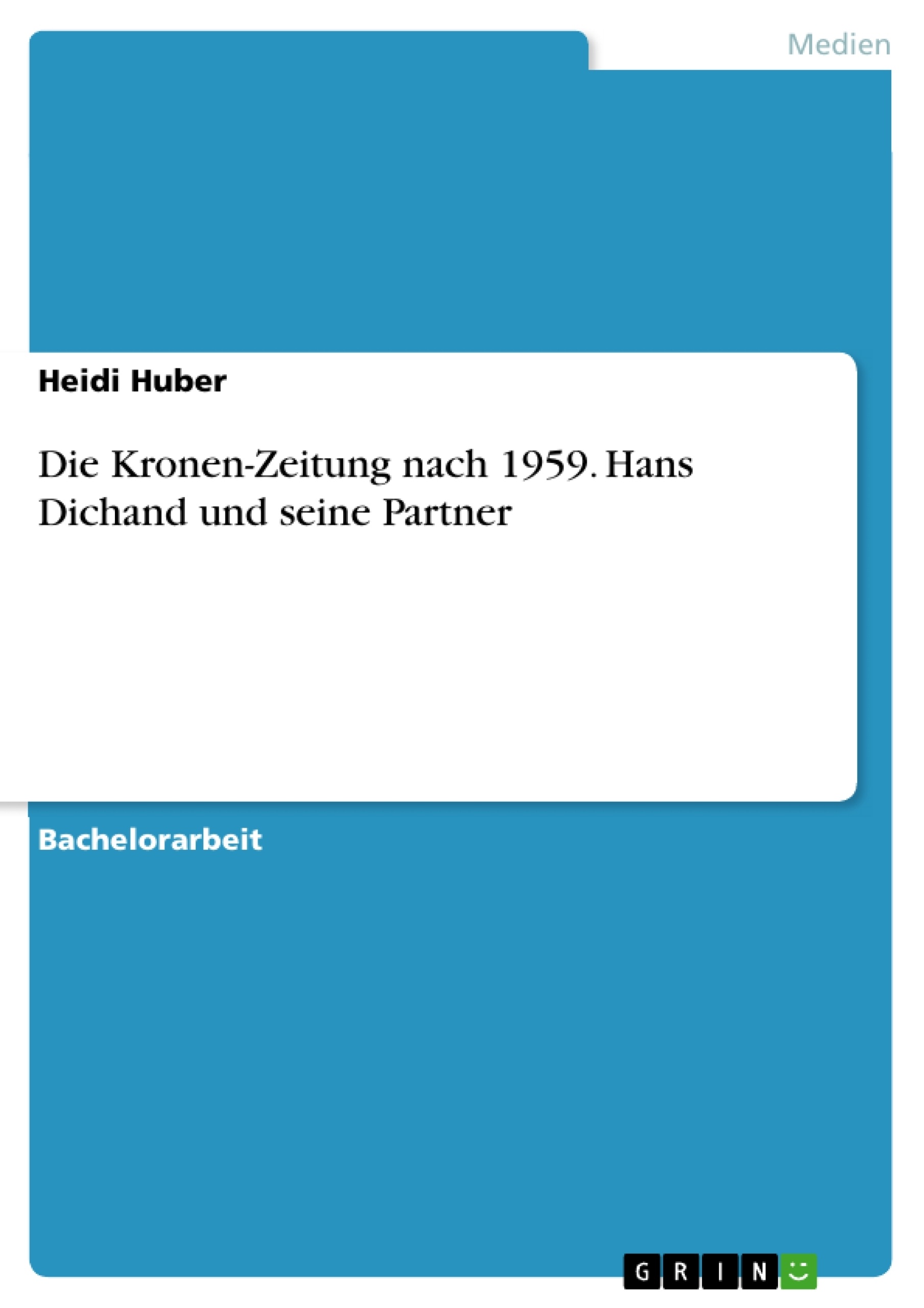Die Neue Kronen Zeitung gilt als das mächtigste Medium in Österreich. Mit einer Reichweite von über 40 Prozent erreicht das Kleinformat täglich an die drei Millionen Leser. Eine ähnliche Monopolstellung am Zeitungsmarkt findet man nicht in der Medienwelt. Mit dem Boulevardblatt ist ein Name unzertrennlich verbunden – Hans Dichand. Der heute 87-Jährige wurde zum Journalisten des Jahrhunderts gekürt und hat eine beispiellose Karriere hinter sich. Der Erfolg der „Krone“ ist eng an seinen Namen geknüpft.
In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit der „Kronen Zeitung“ seit ihrem Gründungsjahr 1959. Damals sicherte sich Hans Dichand als ehemaliger „Kurier“-Chefredakteur die Titelrechte und begann, seine Vision eines Volksblattes in die Tat umzusetzen. Gemeinsam mit Kurt Falk wurde die Zeitung ein Erfolg und hatte bald die Vormachtstellung im Land. Dazwischen folgte die Olah-Affäre, in der Hans Dichand um „seine“ Krone kämpfen musste. Der ÖGB beanspruchte die Zeitung für sich, da Gewerkschaftsboss Franz Olah damals ÖGB-Sparbücher als Bankgarantie für die „Krone“ hinterlegte. Immer wieder kommt es zwischen Hans Dichand und seinen Partnern zum Bruch. Kurt Falk wird aus der Zeitung herausgekauft und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) übernimmt zur Hälfte die Krone (und den „Kurier“). Damit wird die Mediaprint gegründet. 2001 eskaliert der Streit mit den Herren aus dem Ruhrpott und dauert bis heute an. Die WAZ akzeptiert Sohn Christoph nicht als Chefredakteur.
Ein weiterer Wegbegleiter Dichands war und ist Friedrich Dragon. Er arbeitete 40 Jahre lang an der Seite von Dichand, heute ist er Prokurist der WAZ und arbeitet gegen seinen einstigen Chef. Die „Krone“ ist berühmt für ihre tendenziöse Berichterstattung. So greift das Kleinformat politische Kampagnen auf, mit der Erfolge gefeiert werden. Vom Sternwartepark bis zur Hainburger Au, von Zwentendorf bis Temelin, von Waldheim-Wahlkampf zur EU, immer wieder gibt es eine klare Botschaft und eine einseitige Berichterstattung. Jüngstes Beispiel ist die Rolle der „Kronen Zeitung“ im Nationalratswahlkampf 2008. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Macht der „Kronen Zeitung“ und letztendlich auch des Herausgebers Hans Dichand.
Ich will in dieser Literaturarbeit der Frage nachgehen, wie die „Kronen Zeitung“ zum mächtigsten Printmedium in Österreich avancieren konnte und wie viel Macht Hans Dichand und seine Zeitung tatsächlich ausüben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hans Dichand und seine Partner
- Vom Nobody zum Chefredakteur der Krone
- Dichand und die Macht „seiner“ Zeitung
- Das Erfolgsrezept
- Kurt Falk
- Friedrich Dragon
- Der Streit mit der WAZ
- Krone und „Kurier“ haben eines gemeinsam: die MEDIAPRINT
- Die Wiederauferstehung einer Zeitung
- Die „alte“ Krone
- Voraussetzungen für eine neue Tageszeitung
- Wiener Zeitungskrieg
- Gründung der „neuen“ Krone
- Im Café Resch
- Die Olah-Affäre
- Weitere Entwicklung der Zeitung
- Die Gegenwart
- Eine Zeitung macht Politik
- Politische Kampagnen der Krone
- Nein zu Temelin
- Die Waldheim-Verteidigung
- Die EU als Feind
- Antisemitismus und Rassismus
- „Onkel Hans“ als Kanzlermacher?
- Politische Kampagnen der Krone
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der „Kronen Zeitung“ seit 1959 und den Einfluss von Hans Dichand auf deren Erfolg und Macht. Es werden die Schlüsselfiguren, strategischen Entscheidungen und politischen Kampagnen der Zeitung analysiert.
- Der Aufstieg Hans Dichands und seine Rolle bei der „Kronen Zeitung“
- Die geschäftlichen Partnerschaften und Konflikte, insbesondere mit der WAZ
- Die politischen Kampagnen und die Berichterstattung der „Kronen Zeitung“
- Die Olah-Affäre und ihre Auswirkungen auf die Zeitung
- Der Einfluss der „Kronen Zeitung“ auf die österreichische Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die „Kronen Zeitung“ als mächtigstes Medium Österreichs vor und führt Hans Dichand als zentrale Figur ein. Die Arbeit fokussiert auf die Entwicklung der Zeitung seit 1959, inklusive der Olah-Affäre und des Streits mit der WAZ. Die Forschungsfragen und Hypothesen werden formuliert, die sich auf Dichands Einfluss, die Entwicklung der Zeitung und deren politische Rolle konzentrieren.
Hans Dichand und seine Partner: Dieses Kapitel beschreibt den Werdegang Hans Dichands zum Medienmagnaten, von seinen bescheidenen Anfängen bis zur Führung der „Kronen Zeitung“. Es beleuchtet seine Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie Kurt Falk und Friedrich Dragon und den langjährigen Konflikt mit der WAZ. Das Kapitel verdeutlicht Dichands strategisches Geschick und die Herausforderungen, die er meistern musste, um seine Vision einer einflussreichen Zeitung zu verwirklichen.
Krone und „Kurier“ haben eines gemeinsam: die MEDIAPRINT: Dieses Kapitel behandelt die Geschichte der „Kronen Zeitung“, beginnend mit den Voraussetzungen nach dem Krieg, über die Gründung und den frühen Erfolg bis hin zum Olah-Prozess und der Übernahme durch die WAZ. Es schildert die Entwicklung der Zeitung, die strategischen Entscheidungen und die Herausforderungen, die sie während ihrer Existenz durchlief. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Wiener Zeitungskrieg und der Entstehung der Mediaprint.
Eine Zeitung macht Politik: Dieses Kapitel analysiert die politischen Kampagnen der „Kronen Zeitung“, darunter die Berichterstattung über Temelin, den Waldheim-Wahlkampf und die EU-Kritik. Es beleuchtet den oft kontroversen und tendenziösen Stil der Zeitung und untersucht deren Einfluss auf die öffentliche Meinung und möglicherweise auf Wahlergebnisse, beispielhaft am Nationalratswahlkampf 2008. Der antisemitische und rassistische Stil der Zeitung wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Kronen Zeitung, Hans Dichand, Kurt Falk, Friedrich Dragon, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), Mediaprint, Olah-Affäre, Boulevardpresse, politische Kampagnen, Medienmacht, Österreichische Politik, Nationalratswahl 2008, Antisemitismus, Rassismus.
Häufig gestellte Fragen zur "Kronen Zeitung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der „Kronen Zeitung“ seit 1959 und den Einfluss von Hans Dichand auf deren Erfolg und Macht. Analysiert werden Schlüsselfiguren, strategische Entscheidungen und politische Kampagnen der Zeitung.
Wer sind die wichtigsten Personen, die in dieser Arbeit behandelt werden?
Die wichtigsten Personen sind Hans Dichand, der Gründer und langjährige Leiter der „Kronen Zeitung“, sowie seine Partner Kurt Falk und Friedrich Dragon. Weitere relevante Personen werden im Kontext der Olah-Affäre und des Konflikts mit der WAZ erwähnt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Aufstieg Hans Dichands, seine geschäftlichen Partnerschaften und Konflikte (insbesondere mit der WAZ), die politischen Kampagnen und die Berichterstattung der „Kronen Zeitung“, die Olah-Affäre und deren Auswirkungen, sowie den Einfluss der „Kronen Zeitung“ auf die österreichische Politik.
Welche politischen Kampagnen der „Kronen Zeitung“ werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Berichterstattung der „Kronen Zeitung“ über Temelin, den Waldheim-Wahlkampf und die EU-Kritik. Der oft kontroverse und tendenziöse Stil der Zeitung und deren Einfluss auf die öffentliche Meinung werden untersucht. Der antisemitische und rassistische Stil der Zeitung wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielte die Mediaprint?
Die Mediaprint wird als gemeinsames Unternehmen der „Kronen Zeitung“ und des „Kuriers“ beschrieben. Das Kapitel behandelt die Geschichte der „Kronen Zeitung“, beginnend mit den Voraussetzungen nach dem Krieg, über die Gründung und den frühen Erfolg bis hin zum Olah-Prozess und der Übernahme durch die WAZ. Die Entstehung der Mediaprint im Kontext des Wiener Zeitungskrieges wird beleuchtet.
Was ist die Olah-Affäre und welche Bedeutung hat sie für die „Kronen Zeitung“?
Die Olah-Affäre wird als ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der „Kronen Zeitung“ dargestellt, das im Kapitel über die gemeinsame Geschichte mit dem Kurier und der Mediaprint detailliert behandelt wird. Ihre Auswirkungen auf die Zeitung werden ebenfalls analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über Hans Dichand und seine Partner, ein Kapitel über die Krone, den Kurier und die Mediaprint, ein Kapitel über die politischen Aktivitäten der Zeitung und eine Schlussfolgerung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel kurz zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kronen Zeitung, Hans Dichand, Kurt Falk, Friedrich Dragon, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), Mediaprint, Olah-Affäre, Boulevardpresse, politische Kampagnen, Medienmacht, Österreichische Politik, Nationalratswahl 2008, Antisemitismus, Rassismus.
- Citar trabajo
- Heidi Huber (Autor), 2009, Die Kronen-Zeitung nach 1959. Hans Dichand und seine Partner, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151115