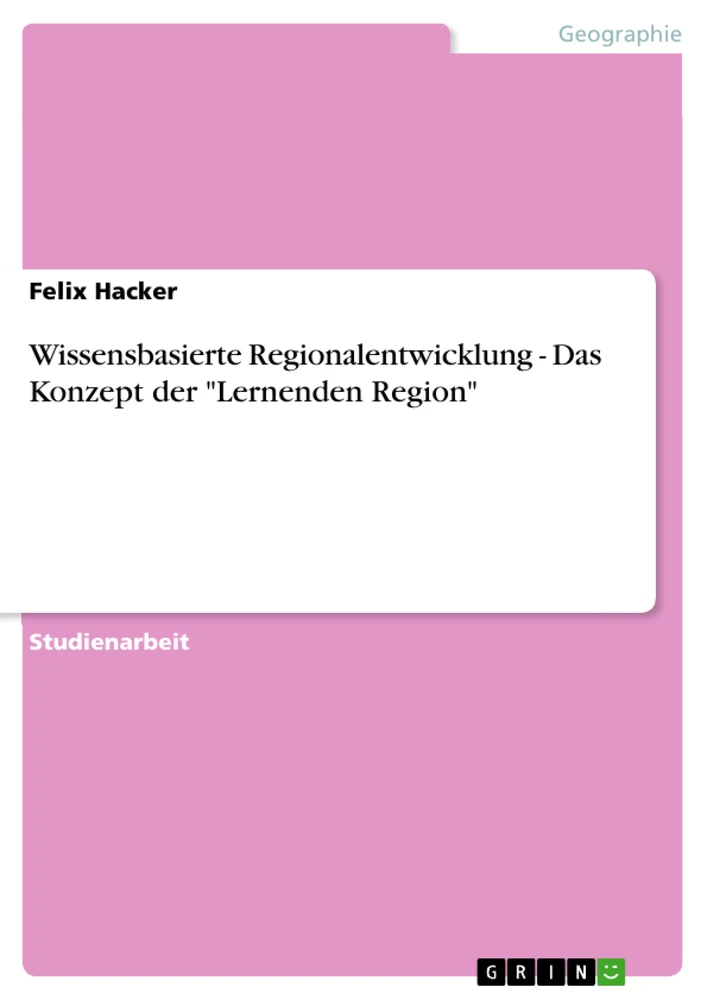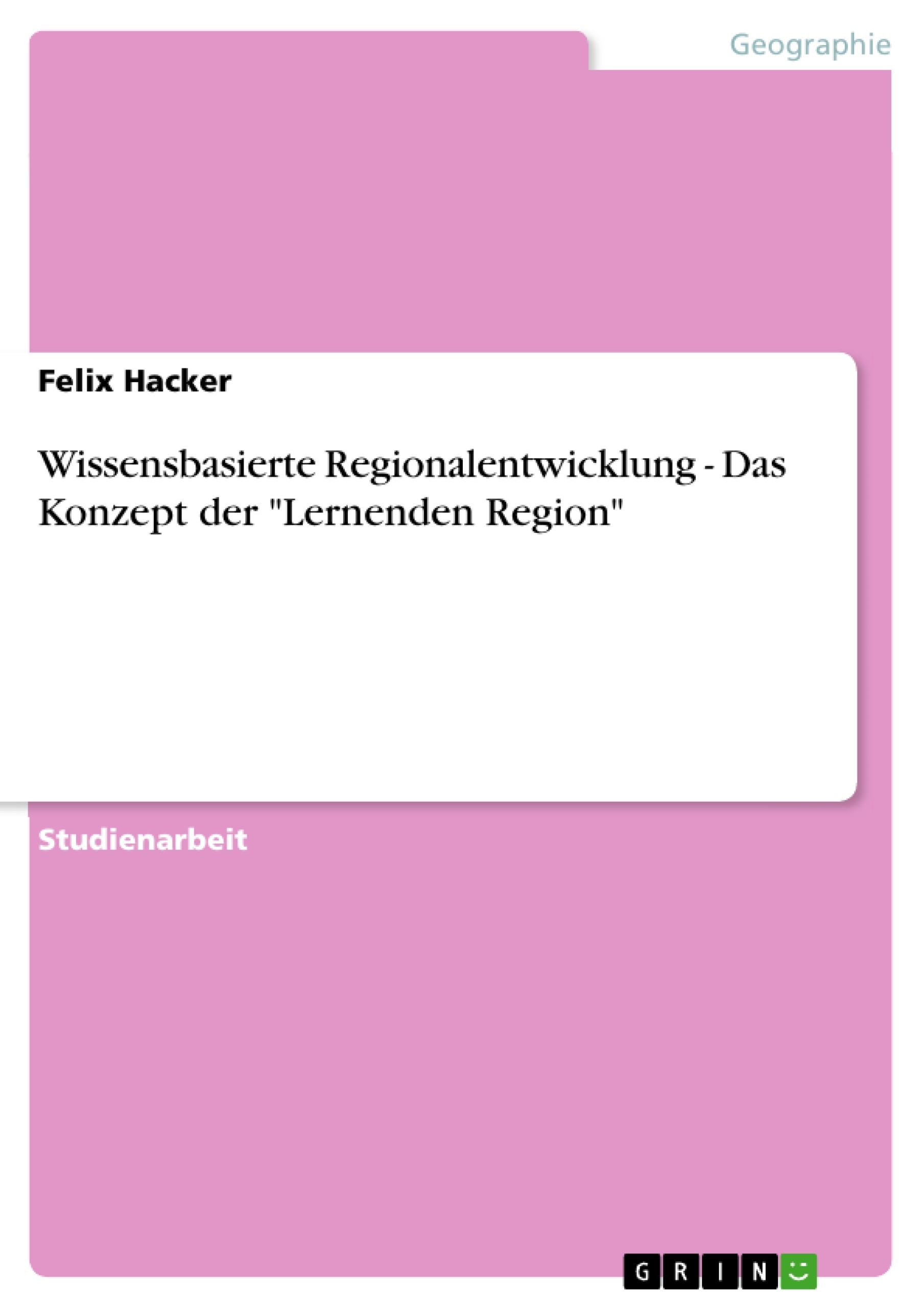Das Konzept der Lernenden Region als Ansatz wissensbasierter Regionalentwicklung scheint ein vielversprechender Ansatz neuerer Zeit zu sein um auf regionaler Ebene Impulse für wirtschaftliches Wachstum setzen zu können. Die Popularität solcher Ansätze und Theorien scheinen dabei einer Fluktuation zu unterliegen und werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten mehr oder minder heiß diskutiert. Mitte der 1990er Jahre war für die Regionalentwicklung
unter anderem der Ansatz der Lernenden Region ein viel besprochenes Konzept. Um dieses Konzept besser einordnen zu können, sollen in dieser Arbeit wesentliche Punkte des Konzeptes vorgestellt und kritisch betrachtet werden. Dazu wird im Kapitel zwei der Wandel wirtschaftlicher Aktivitäten sowie verbundenen Änderungen der Anforderungen an Unternehmen erläutert. nschließend befasst sich das Kapitel drei intensiver mit dem
Konzept der Lernenden Region. Auf Grundlage der im Kapitel drei erläuterten Merkmalen und Definitionen werden im Kapitel vier zwei Fallbeispiele vorgestellt und anschließend der
Spannungsbogen des theoretischen Ansatzes in der Praxis überprüft und hinsichtlich der Umsetzbarkeit betrachtet. Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Lernende Region charakteristisch
vorzustellen. Zum Ende der Untersuchung wird sich zeigen in wie weit es Die Lernende Region gibt und wo Mängel bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Paradigmenwechsel und die Notwendigkeit neuer Ansätze
- Das Konzept der „Lernenden Region“
- Theoretische Einordnung
- Definition
- Ziele
- Merkmale
- Akteure
- Kritische Betrachtung und Spannungsfelder zwischen Anspruch und Wirklichkeit
- Fallbeispiele
- Die Lernende Region Graz
- Geographische Abgrenzung
- Aufgaben und Ziele
- Initiierung und Verlauf des Konzeptes Lernende Region Graz
- Vergleich zwischen Theorie und Praxis
- Lernende Region MIA – Mitteldeutsche Industrieregion im Aufbruch
- Geographische Abgrenzung
- Aufgaben und Ziele
- Ergebnisse
- Vergleich zwischen Theorie und Praxis
- Die Lernende Region Graz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Lernenden Region als Ansatz für wissensbasierte Regionalentwicklung. Ziel ist es, das Konzept zu erläutern, kritisch zu betrachten und seine Umsetzbarkeit in der Praxis zu untersuchen. Dabei werden wichtige Merkmale und Definitionen des Konzepts vorgestellt und anhand von Fallbeispielen aus Graz und der Mitteldeutschen Industrieregion (MIA) die Spannungsfelder zwischen Theorie und Praxis beleuchtet.
- Der Wandel wirtschaftlicher Aktivitäten und die veränderten Anforderungen an Unternehmen in der postindustriellen Gesellschaft.
- Die Bedeutung von Wissen als Produktionsfaktor und die Rolle des Humankapitals für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.
- Das Konzept der Lernenden Region als Ansatz für wissensbasierte Regionalentwicklung.
- Die Herausforderungen bei der Umsetzung des Konzepts der Lernenden Region in der Praxis.
- Eine kritische Bewertung der Fallbeispiele Graz und MIA im Hinblick auf die Umsetzung des Konzepts.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext des Konzepts der Lernenden Region und seine Relevanz für die heutige Zeit beleuchtet. Anschließend wird im zweiten Kapitel der Paradigmenwechsel in der Wirtschaft, der Wandel wirtschaftlicher Aktivitäten und die Notwendigkeit neuer Ansätze für eine erfolgreiche Regionalentwicklung beschrieben. Kapitel drei widmet sich dem Konzept der Lernenden Region und erläutert dessen theoretische Einordnung, Definition, Ziele, Merkmale und Akteure. In Kapitel vier werden zwei Fallbeispiele – die Lernende Region Graz und die Lernende Region MIA – vorgestellt, wobei der Fokus auf die Umsetzung des Konzeptes in der Praxis und die jeweiligen Herausforderungen liegt. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Erkenntnisse der Untersuchung zusammenfasst und die Bedeutung des Konzepts der Lernenden Region für die Zukunft der Regionalentwicklung beurteilt.
Schlüsselwörter
Wissensbasierte Regionalentwicklung, Lernende Region, Paradigmenwechsel, Wirtschaftswandel, Humankapital, Innovationsfähigkeit, Flexibilität, Fallbeispiele, Graz, MIA, Mitteldeutsche Industrieregion, Umsetzung, Praxis, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept der „Lernenden Region“?
Es ist ein Ansatz der wissensbasierten Regionalentwicklung, bei dem Netzwerke aus Unternehmen, Politik und Bildungseinrichtungen Innovationen fördern.
Welche Rolle spielt Wissen für die Regionalentwicklung?
Wissen gilt in der postindustriellen Gesellschaft als zentraler Produktionsfaktor und Humankapital als Basis für nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum.
Was wurde am Fallbeispiel Graz untersucht?
Die Arbeit analysiert die Initiierung und den Verlauf des Konzepts in Graz und vergleicht den theoretischen Anspruch mit der praktischen Umsetzung.
Was ist die Lernende Region MIA?
MIA steht für die „Mitteldeutsche Industrieregion im Aufbruch“, ein Projekt zur Bewältigung des Strukturwandels durch kooperatives Lernen.
Welche Akteure sind in einer Lernenden Region wichtig?
Wichtige Akteure sind lokale Firmen, Forschungsinstitute, Kammern, Bildungsanbieter und die regionale Verwaltung.
Welche Mängel gibt es oft bei der Umsetzung?
Häufige Probleme sind mangelnde Flexibilität der Strukturen, Schwierigkeiten bei der Koordination der Akteure und eine Kluft zwischen Theorie und Praxis.
- Citar trabajo
- Felix Hacker (Autor), 2010, Wissensbasierte Regionalentwicklung - Das Konzept der "Lernenden Region", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151187