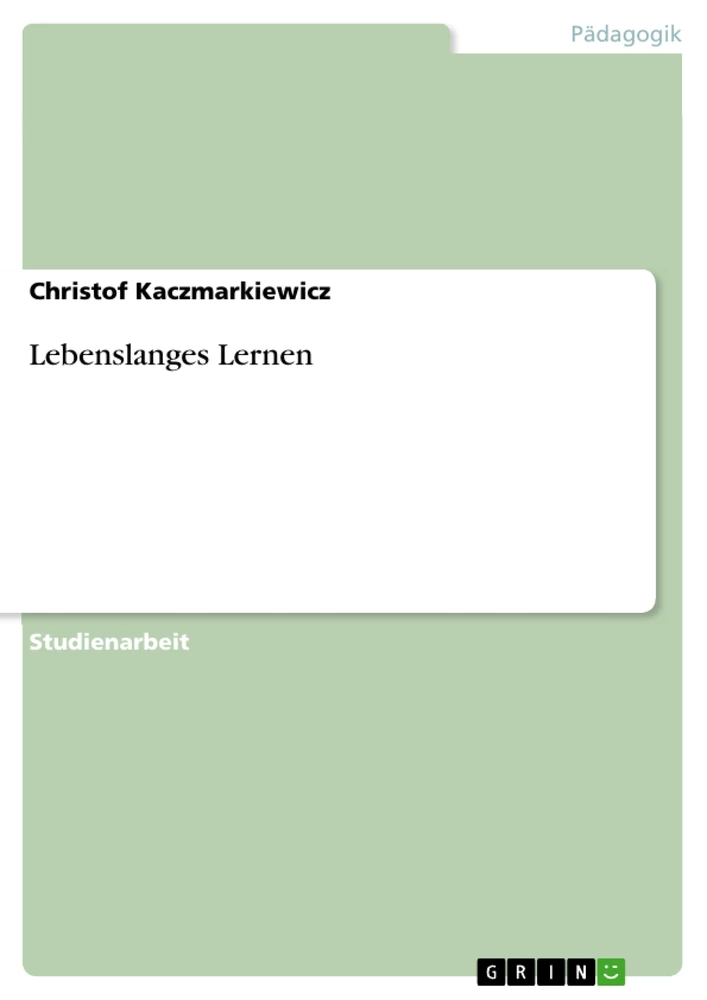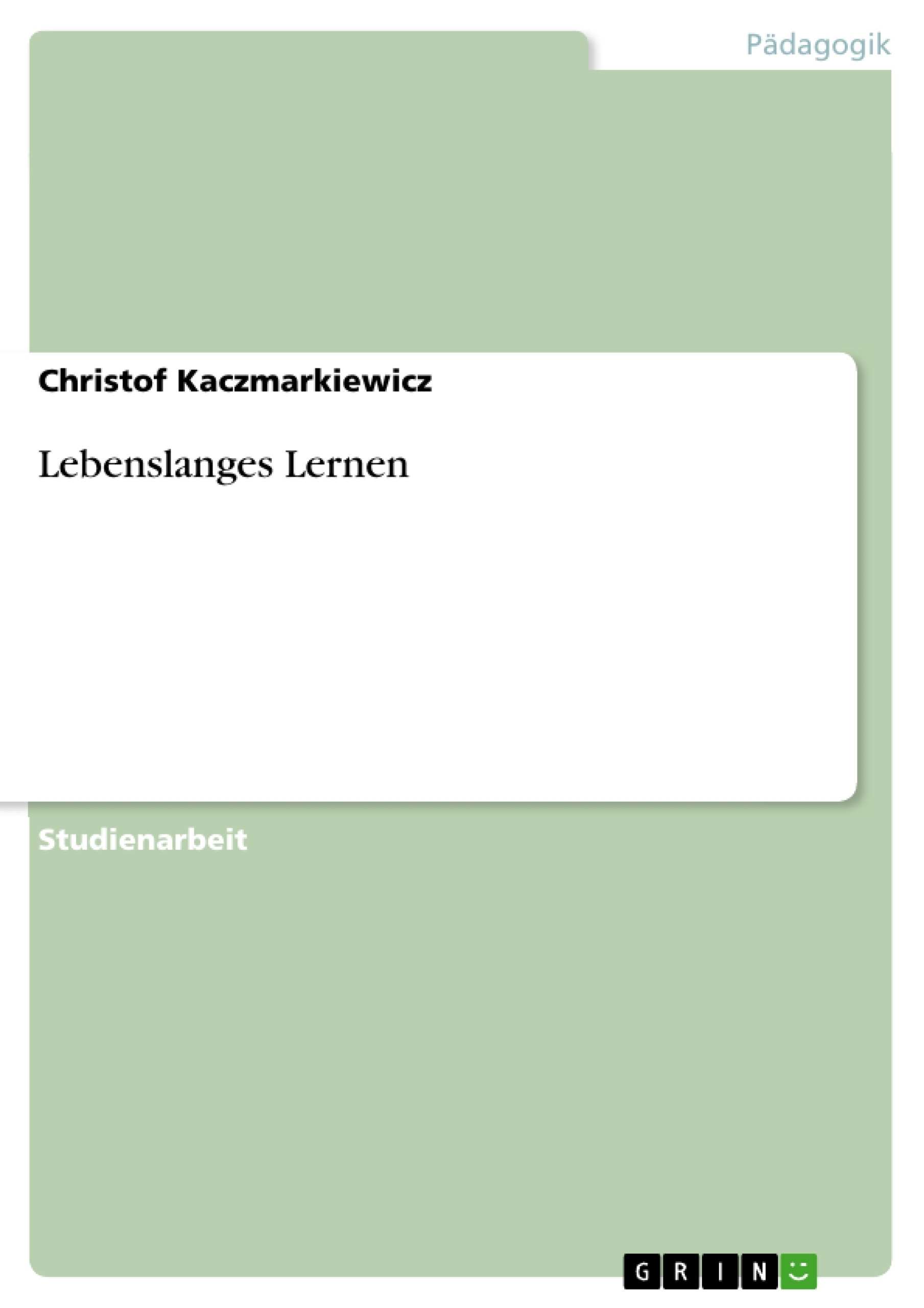Thema dieser Arbeit ist das Lebenslange Lernen der gesamten Bevölkerung Deutschlands, welches unter anderem der Bundesregierung ein Anliegen ist (vgl. B.2. 2006, S. 38). Das Lebenslange Lernen ist mittlerweile ein fester Terminus in der Sprache von Politikern und Wissenschaftlern geworden, welcher sogar zentrale Bedeutung während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2007 inne hatte (vgl. B.3. 2008, S. 28). Ein Jenaer Soziologe forderte vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebenserwartung das Überdenken tradierter Formen des Lebens im Alter, was die Änderung des Lernverhaltens hin zum lebenslangen Lernen miteinschließt (vgl. Flohr 2009, S. 1). Da ein Lernen auch in hohem Alter in der heutigen hochtechnisierten Welt geradezu unumgänglich ist, erscheint eine derart allgemein formulierte Forderung geradezu obsolet, wie ein kurzes Beispiel verdeutlichen wird. Ein 80-Jähriger mit einer kürzlich aufgetretenen, krankheitsbedingten Gehbehinderung wird in der Folge nicht umhin kommen die Handhabung eines Rollstuhls oder ähnlicher Hilfsmittel zu erlernen, um nicht in seiner Mobilität eingeschränkt zu sein. Somit hätte er dem Anspruch des individuellen Lernens in diesem Lebensabschnitt bezogen auf sein privates Fortkommen Genüge getan. Aber wie ist Lebenslanges Lernen im Sinne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu verstehen, welches darin eine notwendige Bedingung für den Wandel von der „Industrie- zur Wissens- und Informationsgesellschaft“ (B.2. 2006, S. 38) aber auch eine Erforderlichkeit aus „gesellschafts- und bildungspolitischen, aber auch aus ökonomischen Gründen“ (ebd.) sieht? Von entscheidender Bedeutung scheint dem Autor die Klärung des Begriffs des Lebenslangen Lernens, bevor eine genauere Bestimmung des Stellenwertes dieses neuen Lernens erfolgt. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Fragestellung lautet daher:
Wie wird Lebenslanges Lernen definiert, was beinhaltet es und wie wird es gefördert?
Beim dem methodischen Vorgehen zur Beantwortung dieser Fragestellung wird der Autor eine Analyse ausgewählter Berufsbildungsberichte hinsichtlich ihrer Aussagekräftigkeit im Bezug auf Lebenslanges Lernen durchführen. Ergänzend wird der Autor die Strategie für Lebenslanges Lernen sowie thematisch relevante Aufsätze hinzuziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was umfasst Lebenslanges Lernen?
- Maßnahmen zur Förderung Lebenslangen Lernens
- Diskussion/ Zusammenfassung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Konzept des Lebenslangen Lernens in Deutschland, wobei er die Definition, die Förderung und die Bedeutung dieses Lernens in verschiedenen Kontexten beleuchtet. Der Autor untersucht, wie Lebenslanges Lernen von der Bundesregierung und der EU definiert wird, analysiert die notwendigen Kompetenzen und erörtert die Rolle des Lebenslangen Lernens in der Wissensgesellschaft.
- Definition und Umfang von Lebenslangem Lernen
- Förderung von Lebenslangem Lernen in Deutschland
- Bedeutung des Lebenslangen Lernens für die Wissensgesellschaft
- Kritik an der Gleichsetzung von Lernen und menschlichem Sein
- Die Rolle des Lebenslangen Lernens als marktwirtschaftliches Anliegen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt das Thema Lebenslanges Lernen in Deutschland vor und führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Wie wird Lebenslanges Lernen definiert, was beinhaltet es und wie wird es gefördert?
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition von Lebenslangem Lernen. Der Autor analysiert die Definition der Bund-Länder-Kommission, die es als alles „formale, nicht-formale und informelle Lernen“ versteht. Er diskutiert die weite Fassung des Begriffs und die Bedeutung von „Selbststeuerungs-/ [und] Selbstorganisationsdispositionen“ für Lebenslanges Lernen.
Das dritte Kapitel behandelt die Förderung des Lebenslangen Lernens in Deutschland. Der Autor skizziert die Ziele der Strategie für Lebenslanges Lernen der Bund-Länder-Kommission und die Bedeutung der Modularisierung von Lernangeboten und der Lernortvernetzung.
Schlüsselwörter
Lebenslanges Lernen, Bildung, Kompetenzentwicklung, Wissensgesellschaft, Selbststeuerung, Selbstorganisation, Förderung, Strategie, Bund-Länder-Kommission, Berufsbildungsberichte, EU, marktwirtschaftliches Anliegen.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert die Bund-Länder-Kommission Lebenslanges Lernen?
Sie versteht darunter alles formale, nicht-formale und informelle Lernen, das während des gesamten Lebens stattfindet.
Warum ist Lebenslanges Lernen für die Wissensgesellschaft wichtig?
Es gilt als notwendige Bedingung für den Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft und ist sowohl aus ökonomischen als auch aus bildungspolitischen Gründen erforderlich.
Welche Maßnahmen fördern das Lebenslange Lernen in Deutschland?
Wichtige Ansätze sind die Modularisierung von Lernangeboten, die Vernetzung von Lernorten und die Förderung von Selbststeuerungs-Kompetenzen.
Was ist informelles Lernen?
Informelles Lernen findet außerhalb strukturierter Bildungseinrichtungen statt, zum Beispiel im Alltag oder bei der Bewältigung neuer privater Herausforderungen (z.B. Umgang mit Hilfsmitteln im Alter).
Gibt es Kritik am Konzept des Lebenslangen Lernens?
Kritiker bemängeln oft die rein marktwirtschaftliche Ausrichtung des Begriffs und die Tendenz, das gesamte menschliche Sein nur noch unter dem Aspekt der Verwertbarkeit zu betrachten.
- Quote paper
- Christof Kaczmarkiewicz (Author), 2010, Lebenslanges Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151192