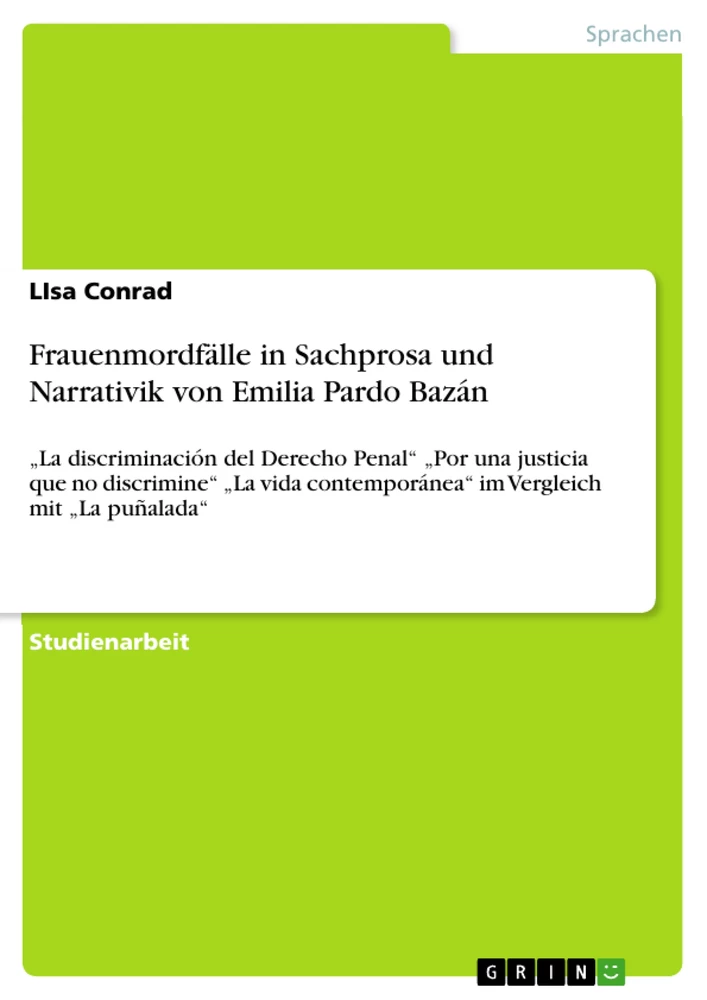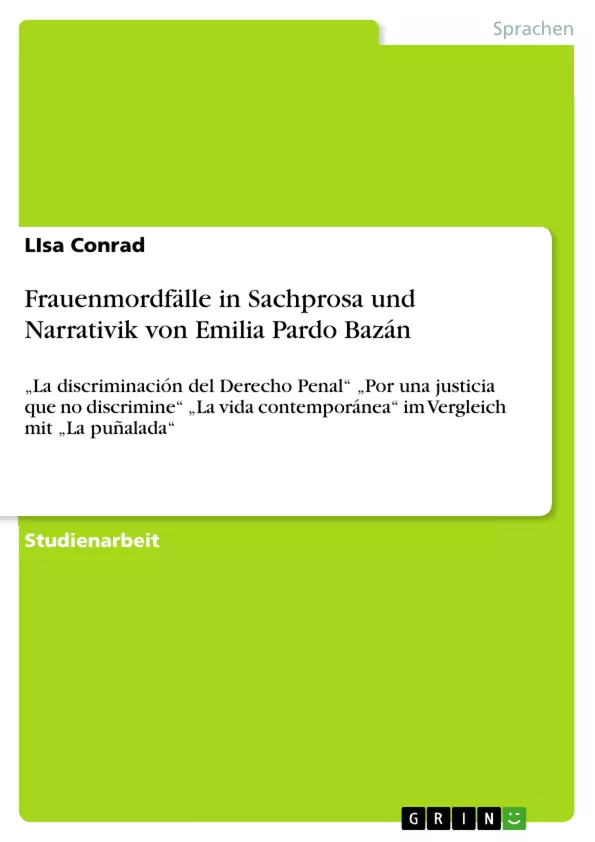Gegenstand dieser Hausarbeit ist die literarische Ausarbeitung von Frauenmordfällen und Gewalt gegen Frauen in Sachprosa und, im Vergleich narrativen Texten bei Emilia Pardo Bazán. Hierzu werden nach einigen biographischen Angaben zur Verfasserin der für diese Arbeit relevanten Werke die drei Sachtexte:
• „Por una justicia que no discrimine“,
• „La discriminación del Derecho Penal“ und
• „La vida contemporánea“
im Zusammenhang erschlossen, um diese anschließend hinsichtlich des Inhaltes und der Themenverarbeitung dem narrativen Text der selben Autorin
• „La puñalada“
vergleichend gegenüberzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Emilia Pardo Bazán
- Frauenmordfälle in den Sachtexten
- Bazáns Kritik an Staat und Gesellschaft
- Schwere der Taten und angemessene Strafen
- Die Darstellung der Täter und ihrer Motive
- Die Darstellung der Opfer
- Bazáns Sprache und Stil
- Frauenmordfall im narrativen Text „La puñalada“
- Die Darstellung des Täters und des Motivs
- Die Darstellung des „Opfers“
- Frauenmord im Sachtext vs. Frauenmord in Narrativik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die literarische Darstellung von Frauenmordfällen und Gewalt gegen Frauen in Sachprosa und narrativen Texten von Emilia Pardo Bazán. Dabei werden zunächst biographische Angaben zur Autorin sowie die drei Sachtexte „Por una justicia que no discrimine“, „La discriminación del Derecho Penal“ und „La vida contemporánea“ im Hinblick auf ihre Inhalte und Themenschwerpunkte erschlossen. Anschließend werden diese Texte vergleichend dem narrativen Text „La puñalada“ gegenübergestellt.
- Die Kritik an Staat und Gesellschaft in Bezug auf die Reaktion auf Frauenmordfälle
- Die Darstellung der Täter und ihrer Motive in Sachprosa und narrativen Texten
- Die Rolle der Opfer in der Darstellung von Frauenmordfällen
- Die sprachliche und stilistische Umsetzung der Thematik in den Werken von Emilia Pardo Bazán
- Der Vergleich zwischen der Darstellung von Frauenmordfällen in Sachprosa und Narrativik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Frauenmordes und die Relevanz des Themas in Spanien um 1900 ein. Sie stellt die Arbeit von Emilia Pardo Bazán vor und skizziert die Inhalte der einzelnen Kapitel.
Das zweite Kapitel widmet sich der Biographie von Emilia Pardo Bazán. Es beleuchtet ihre Rolle als Vorreiterin des Naturalismus in Spanien und ihr Engagement für die Rechte der Frauen.
Das dritte Kapitel analysiert die Sachtexte „La discriminación del Derecho Penal“, „Por una justicia que no discrimine“ und „La vida contemporánea“. Es untersucht Bazáns Kritik an Staat und Gesellschaft, die Darstellung der Täter und Opfer sowie die sprachliche und stilistische Umsetzung der Thematik.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem narrativen Text „La puñalada“. Es analysiert die Darstellung des Täters und des „Opfers“ sowie die Motive des Täters.
Das fünfte Kapitel vergleicht die Darstellung von Frauenmordfällen in Sachprosa und Narrativik. Es untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung der Thematik in den beiden Textformen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Frauenmord, Gewalt gegen Frauen, Naturalismus, Emilia Pardo Bazán, Sachprosa, Narrativik, Spanien, Gesellschaftliche Verhältnisse, Kritik an Staat und Gesellschaft, Recht und Gerechtigkeit, Opferperspektive, Tätermotive, Sprache und Stil.
Häufig gestellte Fragen
Wie stellt Emilia Pardo Bazán Gewalt gegen Frauen dar?
Bazán nutzt sowohl Sachtexte als auch Erzählungen wie „La puñalada“, um Frauenmorde als Resultat gesellschaftlicher Missstände und mangelnder Justiz anzuprangern.
Was kritisiert Bazán am damaligen Strafrecht?
In ihren Sachtexten kritisiert sie eine diskriminierende Justiz, die Täter oft schützt oder deren Motive verharmlost, während die Opfer keine Stimme haben.
Welche Rolle spielt der Naturalismus in ihren Werken?
Als Vorreiterin des Naturalismus in Spanien beschreibt sie Gewalt und soziale Realität ungeschönt und detailliert, um auf notwendige Reformen hinzuweisen.
Wie unterscheiden sich ihre Sachtexte von ihrer Narrativik?
Sachtexte dienen der direkten gesellschaftlichen Kritik und Analyse, während ihre Erzählungen die psychologischen Abgründe der Täter und das Leid der Opfer literarisch erfahrbar machen.
Worum geht es in der Erzählung „La puñalada“?
Die Erzählung beschreibt einen konkreten Frauenmordfall und beleuchtet die erschreckende Normalität von Gewalt in den damaligen Geschlechterverhältnissen.
- Citar trabajo
- LIsa Conrad (Autor), 2009, Frauenmordfälle in Sachprosa und Narrativik von Emilia Pardo Bazán, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151206