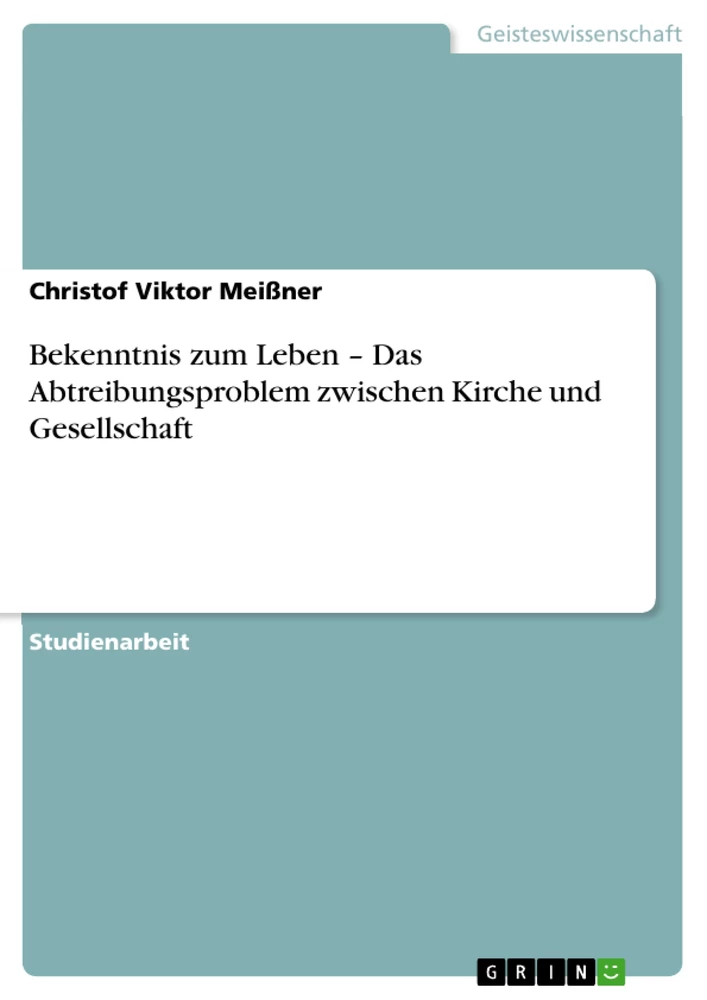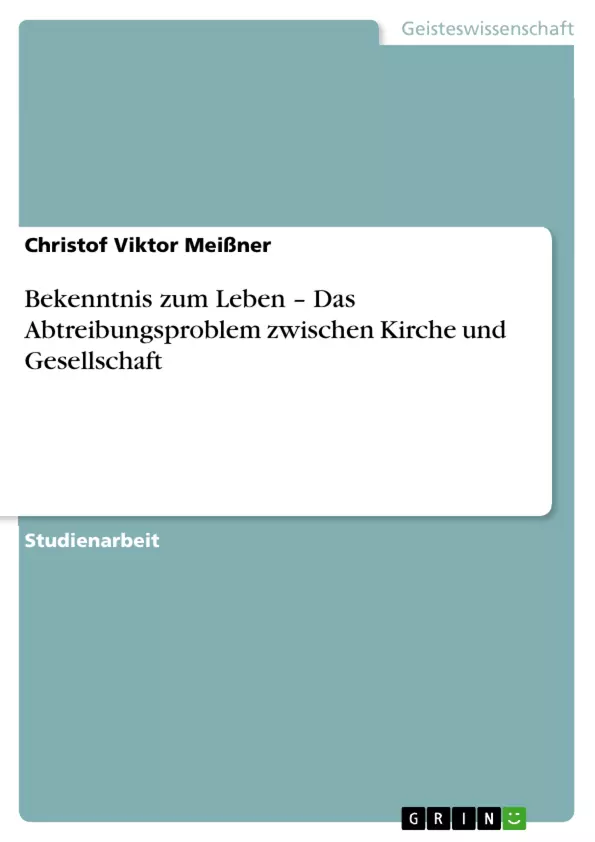Niemand „will“ Abtreibung, darin sind sich alle einig. Kontrovers ist aber, wie Staat und Gesellschaft, Kirche und Ethik damit umgehen sollen. Inwiefern kommt dem Embryo Menschen- bzw. Personwürde zu (Karin Ulrich-Eschemann)? Was bedeutet Abtreibung im Hinblick auf das „natürliche Leben“ (Bonhoeffer) und welche Aufgaben hat der Staat und die Gesellschaft in Bezug auf die Schwangere und das Ungeborene? Schließlich: Wie antwortet eine kirchliche Ethik – eine „Ethik der Geschöpflichkeit“ (Marco Hofheinz) – aus ökumenischer Perspektive auf die Frage nach dem uneingeschränkten Schutz des menschlichen Lebens (Wolfgang Lienemann)? — „Es wird der kirchlich-theologische Diskurs in seinen Grundlinien nachgezeichnet und kritisch auf die Punkte gebracht, an denen das Urteilen einsetzen muss. Es wird zugleich mittels einschlägiger Literatur der gesellschaftliche Kontext in den Blick gerückt, innerhalb dessen sich dieser Diskurs bewegt. Letzteres geschieht u.a. durch den Bezug auf die Arbeit von Boltanski, was sich als sehr erhellend erweist, zumal der Verfasser es versteht, die Pointe dieser Arbeit für seine eigene Urteilsbildung fruchtbar zu machen.“ (Professor Hans G. Ulrich in der Beurteilung der Arbeit)
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Bekenntnis zum Leben – Das Abtreibungsproblem zwischen Kirche und Gesellschaft
- 1. Zum moralischen Status des Ungeborenen
- 1.1 Vom Anfang menschlichen Lebens
- 1.2 Gottebenbildlichkeit und Menschenwürde
- 1.3 Der ungeborene Mensch als Person?
- 1.4 Ergebnis
- 2. Die schwangere Frau zwischen gesellschaftlicher Hilfestellung und Abtreibung
- 2.1 Das Natürliche der Schwangerschaft
- 2.2 Das Unnatürliche der Abtreibung
- 2.3 Menschenwürde als positives Menschenrecht? - Zur rechtlichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland
- 2.4 Fazit: Vorbeugende Maßnahmen
- 2.4.1 Gesetzliche Regelung
- 2.4.2 Staatliche und kirchliche Solidarität
- 3. Kirchliche Ethik und Abtreibung
- 3.1 Eine kirchliche Ethik
- 3.1.1 Eine Ethik der Geschöpflichkeit
- 3.1.2 Geschöpflichkeit und „Sein in Christo”
- 3.1.3 Geschöpfliches Leben als Befreiung zum Leben
- 3.2 Kirchliche Ethik als einladende und beratende Ethik
- 3.3 Ein neues Bekenntnis?
- 3.1 Eine kirchliche Ethik
- C. Ergebnisse
- 1. Zum moralischen Status des Ungeborenen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem moralischen Status des ungeborenen Lebens und den ethischen Herausforderungen, die mit der Abtreibungsproblematik einhergehen. Sie analysiert die Positionen von Kirche und Gesellschaft in dieser Debatte und untersucht, wie die Frage der Abtreibung im Spannungsfeld von Menschenwürde, natürlichem Lebensrecht und den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen betrachtet werden kann.
- Der moralische Status des Ungeborenen
- Die Rolle der Frau und die gesellschaftlichen Bedingungen im Kontext der Abtreibung
- Die Position der Kirche und eine ethische Betrachtungsweise der Abtreibungsproblematik
- Die Bedeutung von Natürlichkeit und Menschenwürde im Spannungsfeld von Lebensschutz und Selbstbestimmung
- Die Suche nach einer einladenden und beratenden Ethik in der Abtreibungsdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den historischen und gesellschaftlichen Kontext der Abtreibungsdebatte beleuchtet. Im ersten Kapitel wird der moralische Status des ungeborenen Lebens analysiert, wobei verschiedene Aspekte wie der Beginn menschlichen Lebens, die Gottebenbildlichkeit und die Frage nach der Personwerdung des Embryos diskutiert werden. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Rolle der Frau im Kontext der Schwangerschaft und der Abtreibung. Es analysiert die gesellschaftlichen Kräfte und Bedingungen, die Einfluss auf die Entscheidungen der Frau haben, sowie die rechtliche Situation in Deutschland. Das dritte Kapitel widmet sich einer kirchlichen Ethik im Hinblick auf die Abtreibungsproblematik. Es analysiert die Theologie des Leibes Christi und sucht nach einer einladenden und beratenden Ethik, die die komplexen moralischen und gesellschaftlichen Dimensionen des Abtreibungsproblems angemessen berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Abtreibung, Menschenwürde, ungeborenes Leben, natürliches Lebensrecht, Kirchliche Ethik, gesellschaftliche Bedingungen, Selbstbestimmung, Schwangere, Bioethik, Lebensrecht, Geschöpflichkeit, Christus, Moral, Recht, Gesellschaft, Familienbild, biologische Entwicklung, Beseelung, Personwerdung, Theologie, Ethik, Debatte, Veränderung, Emanzipation, Feminismus
Häufig gestellte Fragen
Welchen moralischen Status hat der Embryo in dieser Debatte?
Die Arbeit untersucht, inwiefern dem Embryo Menschen- bzw. Personwürde und Gottebenbildlichkeit zukommt und ab wann menschliches Leben als schützenswerte Person gilt.
Was versteht man unter einer „Ethik der Geschöpflichkeit“?
Nach Marco Hofheinz ist dies eine kirchliche Ethik, die das Leben als Geschenk Gottes (Geschöpf) betrachtet und daraus einen uneingeschränkten Schutzauftrag ableitet.
Wie sieht die rechtliche Lage zur Abtreibung in Deutschland aus?
Die Arbeit analysiert die Menschenwürde als positives Menschenrecht und wie der Staat den Schutz des Ungeborenen im Spannungsfeld zur Selbstbestimmung der Frau gesetzlich regelt.
Welche Rolle spielt die Solidarität von Kirche und Staat?
Es wird betont, dass vorbeugende Maßnahmen und soziale Unterstützung für Schwangere essenziell sind, um Konfliktsituationen aufzufangen und das „Ja zum Leben“ zu ermöglichen.
Wie antwortet eine einladende kirchliche Ethik auf die Abtreibungsfrage?
Die Arbeit plädiert für eine beratende Ethik, die über reine Verbote hinausgeht und den gesellschaftlichen Kontext sowie die Not der betroffenen Frauen ökumenisch in den Blick nimmt.
- Citation du texte
- Christof Viktor Meißner (Auteur), 2010, Bekenntnis zum Leben – Das Abtreibungsproblem zwischen Kirche und Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151234