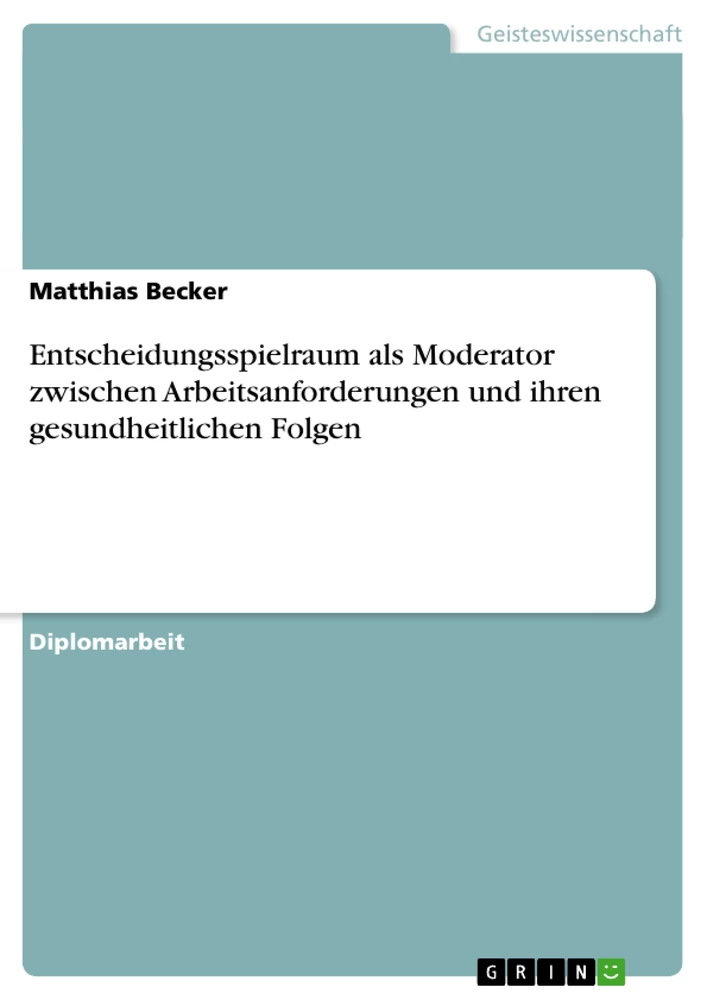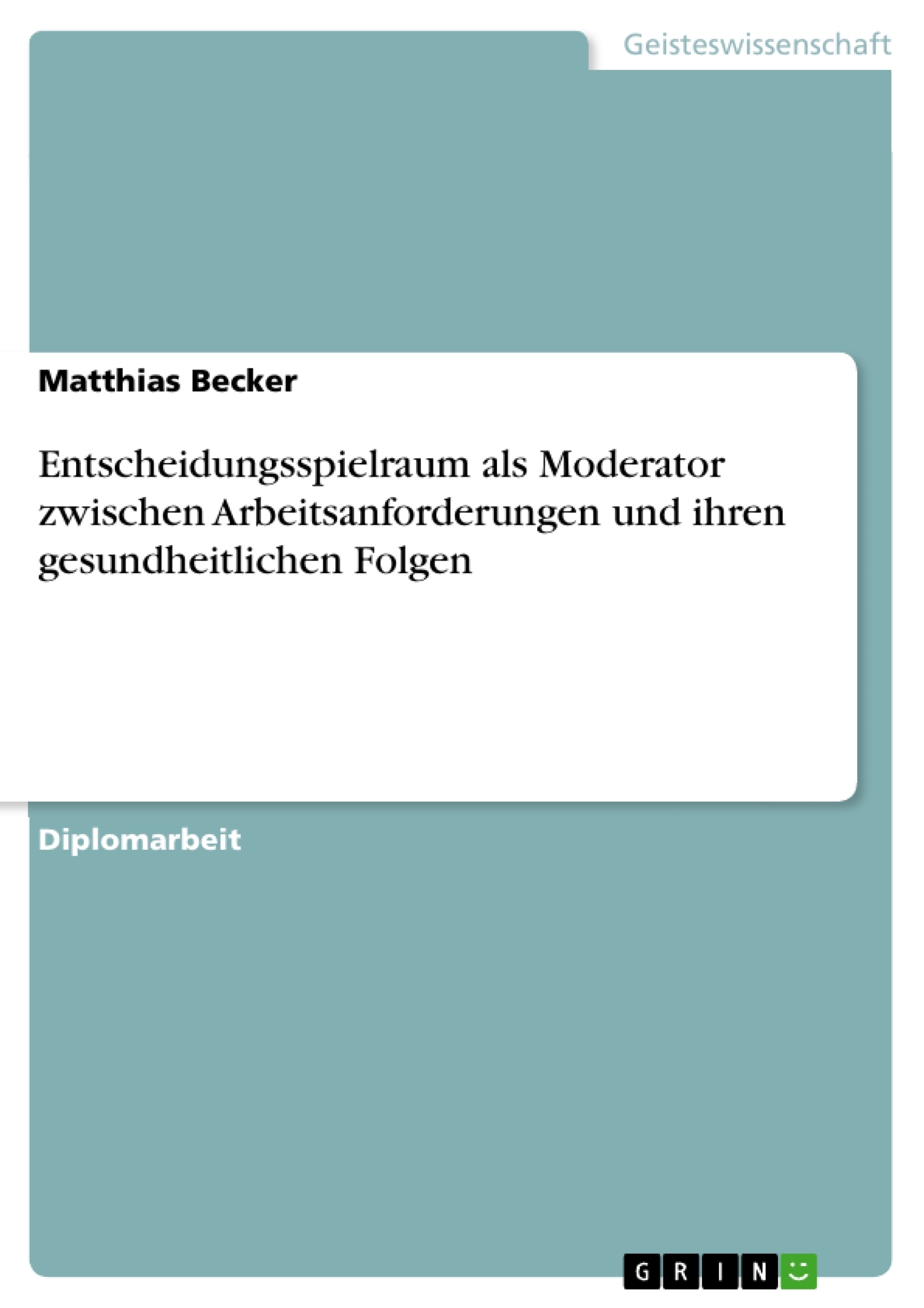Die Arbeits- und Organisationspsychologie als eine Anwendungsdisziplin innerhalb der Psychologie befasst sich unter anderem mit der Gestaltung von Arbeit. Der Kern dieses Bereichs bezieht sich darauf, Arbeit „menschengerecht“ zumachen.Damit ist zusammenfassend gemeint, Arbeit so an die Eigenschaften des Menschen anzupassen, dass deren Ausführung für die Beschäftigten frei von Gefährdungen für die Gesundheit und im günstigsten Fall sogar förderlich für die Persönlichkeit ist (Ulich,2005).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Beschreibung des Untersuchungsfeldes der Behindertenarbeit
- 2.2 Begriffsbestimmungen und Erklärungsmodelle zur Beschreibung der Wirkung von Arbeit
- 2.2.1 Das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept
- 2.2.2 Das Auftrags-Auseinandersetzungs-Konzept
- 2.3 Definitionen und grundlegende Befunde zu Spielräumen
- 2.4 Entscheidungsspielraum als Ausgangspunkt selbstgesteuerten Handelns
- 2.5 Die Rolle von Spielräumen in Bezug auf die Wirkung von Arbeit
- 2.5.1 Das „Job Demand/Job Decision Latitude“-Modell
- 2.5.2 Das Vitamin-Modell
- 2.5.3 Der Salutogenese-Ansatz
- 3 Fragestellung und Hypothesen
- 3.1 Ableitung der Fragestellung
- 3.2 Hypothesen
- 3.2.1 Entscheidungsspielraum als Gesamtkonstrukt in der Arbeitsituation
- 3.2.1.1 Haupteffekte der Arbeitsanforderungen und des Moderators Entscheidungsspielraum
- 3.2.1.2 Interaktionseffekte zu Entscheidungsspielraum als Gesamtkonstrukt
- 3.2.2 Inhaltliche Aspekte des Entscheidungsspielraums
- 3.2.2.1 Haupteffekte der inhaltlichen Facetten des Entscheidungsspielraums
- 3.2.2.2 Interaktionseffekte der inhaltlichen Facetten des Entscheidungsspielraums
- 4 Methoden
- 4.1 Beschreibung des Unternehmens
- 4.1.1 Klientel, Angebot und Ziele der Berlin gGmbH
- 4.1.2 Organisationsstruktur der Berlin gGmbH
- 4.1.3 Beschäftigte und Personalbemessung
- 4.2 Datenerhebung
- 4.2.1 Stichprobenauswahl
- 4.2.2 Methodisches Vorgehen bei der Datenerhebung in der Pilotphase
- 4.2.2.1 Screening Psychischer Arbeitsbelastungen - Person
- 4.2.2.2 Screening Psychischer Arbeitsbelastungen – Wirkungen
- 4.2.2.3 Frankfurter Skalen zur Emotionsarbeit
- 4.3 Operationalisierungen der Konstrukte
- 4.3.1 Entscheidungsspielraum
- 4.3.1.1 Erfassung des Entscheidungsspielraums
- 4.3.1.2 Erfassung inhaltlicher Facetten des Entscheidungsspielraums
- 4.3.2 Risikobehaftete Arbeitssituationen, Belastende Ausführungsbedingungen, Emotionale Dissonanz
- 4.3.3 Operationalisierung der negativen Beanspruchungsfolgen
- 4.4 Kontrollvariablen
- 4.5 Statistische Auswertungen
- 4.5.1 Begründung der Verfahrensauswahl
- 4.5.2 Überprüfung der Kontrollvariablen und statistische Voruntersuchungen
- 4.5.3 Hypothesenprüfung mittels moderierter linearer Regression
- 4.5.3.1 Voraussetzungen der multiplen linearen Regression
- 4.5.3.2 Überprüfung der Haupteffekte
- 4.5.3.3 Überprüfung der Interaktionshypothesen
- 4.5.4 Signifikanzniveau, Elektronische Datenauswertung
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Beschreibung der Stichprobe
- 5.1.1 Rücklauf
- 5.1.2 Alter und Geschlecht
- 5.1.3 Arbeitszeit, Arbeitsverhältnis, Schichtarbeit
- 5.1.4 Betriebszugehörigkeit, Tätigkeitsdauer, Ausbildungsstand
- 5.1.5 Unterschiede zwischen verschiedenen Einrichtungen und Einrichtungstypen
- 5.2 Deskriptive Ergebnisse der Arbeitsanalyse
- 5.2.1 Profil der Arbeitsanalyse
- 5.2.2 Emotionale Dissonanz
- 5.2.3 Psychophysische Beschwerden
- 5.3 Faktorenanalytische Bestätigung und deskriptive Beschreibung der inhaltlichen Facetten des Entscheidungsspielraums
- 5.4 Überprüfung der möglichen Kontrollvariablen
- 5.5 Überprüfung der Voraussetzungen zur Hypothesenprüfung
- 5.5.1 Stärke und Richtung der Zusammenhänge zwischen den Arbeitsmerkmalen untereinander sowie mit den psychophysischen Beschwerden
- 5.5.1.1 Arbeitsmerkmale und psychophysische Beschwerden
- 5.5.1.2 Interkorrelationen der Anforderungen
- 5.5.1.3 Interkorrelationen zwischen den Moderatoren
- 5.5.1.4 Zusammenhänge zwischen den Anforderungen und den Moderatorvariablen
- 5.5.2 Form der Zusammenhänge zwischen den Arbeitsmerkmalen und den psychophysischen Beschwerden
- 5.5.3 Überprüfung der Normalverteilung der Residuen
- 5.5.4 Homoskedastizität
- 5.6 Überprüfung der Hypothesen
- 5.6.1 Entscheidungsspielraum als Gesamtkonstrukt und Anforderungen der Arbeitssituation zur Vorhersage psychophysischer Beanspruchungsfolgen
- 5.6.1.1 Haupteffekte
- 5.6.1.2 Interaktionseffekte
- 5.6.2 Spezifische Facetten von Entscheidungsspielraum und Anforderungen der Arbeitssituation zur Vorhersage psychophysischer Beanspruchungsfolgen
- 5.6.2.1 Haupteffekte spezifischer Facetten von Entscheidungsspielraum
- 5.6.2.2 Interaktionseffekte von Entscheidungsspielraum bezogen auf Arbeitsinhalte, Zeiteinteilung und die Art und Weise der Arbeitserledigung
- 6 Diskussion
- 6.1 Diskussion der Methodik
- 6.1.1 Untersuchungsdesign
- 6.1.2 Stichprobe
- 6.1.3 Instrumente und Operationalisierungen
- 6.1.3.1 Objektive vs. subjektive Erhebung der betrachteten Variablen
- 6.1.3.2 Subjektive Einschätzungen von Arbeitsmerkmalen und Persönlichkeitsmerkmale
- 6.1.3.3 Operationalisierungen der Arbeitsmerkmale
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Einfluss von Entscheidungsspielraum auf die Beziehung zwischen Arbeitsanforderungen und gesundheitlichen Folgen. Ziel ist es, den moderierenden Effekt von Entscheidungsspielraum zu belegen und dessen verschiedenen Facetten zu analysieren.
- Moderierende Wirkung von Entscheidungsspielraum auf den Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen und gesundheitlichen Folgen
- Analyse verschiedener Modelle zur Erklärung der Wirkung von Arbeit (Belastungs-Beanspruchungs-Konzept, Auftrags-Auseinandersetzungs-Konzept)
- Untersuchung inhaltlicher Facetten des Entscheidungsspielraums (Arbeitsinhalte, Zeiteinteilung, Art der Arbeitserledigung)
- Empirische Überprüfung der Hypothesen mittels moderierter linearer Regression
- Diskussion der Methodik und der Ergebnisse im Kontext bestehender Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeitspsychologie und der Bedeutung von Entscheidungsspielraum ein. Es wird die Relevanz der Untersuchung für die Gesundheit von Beschäftigten hervorgehoben und die Forschungsfrage formuliert.
2 Theoretischer Hintergrund: Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über relevante Theorien und Modelle zur Arbeitsgestaltung und deren Auswirkungen auf die Gesundheit. Es werden das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept, das Auftrags-Auseinandersetzungs-Konzept, sowie Modelle wie das „Job Demand/Job Decision Latitude“-Modell und das Vitamin-Modell detailliert erläutert. Der Entscheidungsspielraum wird als zentraler Faktor für die Selbststeuerung im Arbeitskontext definiert und eingeordnet. Die Kapitel 2.1 und 2.5 werden dabei in ihrer Gesamtheit betrachtet um die verschiedenen Ansätze zur Betrachtung der Wirkung von Arbeit zu beleuchten.
3 Fragestellung und Hypothesen: Hier werden die Forschungsfragen präzise formuliert und die daraus abgeleiteten Hypothesen zur Wirkung des Entscheidungsspielraums als Moderator zwischen Arbeitsanforderungen und deren gesundheitlichen Folgen dargestellt. Es wird zwischen dem Entscheidungsspielraum als Gesamtkonstrukt und dessen inhaltlichen Facetten unterschieden, für die jeweils separate Hypothesen aufgestellt werden. Diese formulieren die erwarteten Haupteffekte und Interaktionseffekte.
4 Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der durchgeführten Studie. Es wird das untersuchte Unternehmen, die Stichprobenauswahl, die verwendeten Messinstrumente (z.B. Screening Psychischer Arbeitsbelastungen, Frankfurter Skalen zur Emotionsarbeit) und das statistische Verfahren (moderierte lineare Regression) erläutert. Die Operationalisierung der zentralen Konstrukte (Entscheidungsspielraum, Arbeitsanforderungen, Beanspruchungsfolgen) wird präzise dargelegt.
5 Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert. Es beinhaltet die deskriptive Darstellung der Stichprobe, die Ergebnisse der Arbeitsanalyse (einschließlich emotionaler Dissonanz und psychophysischer Beschwerden), die Faktorenanalyse des Entscheidungsspielraums sowie die Ergebnisse der Hypothesentests mittels moderierter linearer Regression. Die Prüfung der Voraussetzungen für die statistische Analyse wird ebenfalls dokumentiert.
Schlüsselwörter
Entscheidungsspielraum, Arbeitsanforderungen, Gesundheit, Beanspruchung, Moderation, Belastungs-Beanspruchungs-Konzept, Job Demand/Job Decision Latitude-Modell, Vitamin-Modell, Salutogenese, moderierte lineare Regression, Arbeitsanalyse, emotionale Dissonanz, psychophysische Beschwerden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Der Einfluss von Entscheidungsspielraum auf die Beziehung zwischen Arbeitsanforderungen und gesundheitlichen Folgen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Einfluss von Entscheidungsspielraum auf den Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen und den daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen bei Beschäftigten. Der Fokus liegt auf der moderierenden Wirkung des Entscheidungsspielraums und der Analyse seiner verschiedenen Facetten.
Welche Theorien und Modelle werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Theorien und Modelle der Arbeitspsychologie, darunter das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept, das Auftrags-Auseinandersetzungs-Konzept, das „Job Demand/Job Decision Latitude“-Modell, das Vitamin-Modell und den Salutogenese-Ansatz. Diese dienen dazu, die Wirkung von Arbeit und den Einfluss von Entscheidungsspielraum zu erklären.
Welche Forschungsfragen und Hypothesen werden untersucht?
Die Arbeit formuliert präzise Forschungsfragen zum moderierenden Effekt des Entscheidungsspielraums (als Gesamtkonstrukt und in seinen inhaltlichen Facetten) auf den Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen und gesundheitlichen Folgen. Es werden spezifische Hypothesen zu Haupteffekten und Interaktionseffekten aufgestellt.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet eine quantitative Methode. Es wird ein bestimmtes Unternehmen untersucht, eine Stichprobe ausgewählt und verschiedene Messinstrumente eingesetzt, darunter das Screening Psychischer Arbeitsbelastungen und die Frankfurter Skalen zur Emotionsarbeit. Die Datenanalyse erfolgt mittels moderierter linearer Regression.
Wie wurde der Entscheidungsspielraum operationalisiert?
Der Entscheidungsspielraum wird sowohl als Gesamtkonstrukt als auch in seinen inhaltlichen Facetten (Arbeitsinhalte, Zeiteinteilung, Art der Arbeitserledigung) operationalisiert. Die konkreten Erfassungsmethoden werden detailliert im Methodenkapitel beschrieben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse umfassen deskriptive Statistiken zur Stichprobe, Ergebnisse der Arbeitsanalyse (emotionale Dissonanz, psychophysische Beschwerden), eine Faktorenanalyse des Entscheidungsspielraums und die Ergebnisse der Hypothesentests mittels moderierter linearer Regression. Die Überprüfung der Voraussetzungen für die statistische Analyse ist ebenfalls dokumentiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Diskussion der Ergebnisse umfasst eine kritische Reflexion der Methodik (Stichprobe, Instrumente, Operationalisierungen) und eine Einordnung der Ergebnisse in den Kontext bestehender Forschung. Die Arbeit diskutiert die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis und gibt Hinweise für zukünftige Forschungsvorhaben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Entscheidungsspielraum, Arbeitsanforderungen, Gesundheit, Beanspruchung, Moderation, Belastungs-Beanspruchungs-Konzept, Job Demand/Job Decision Latitude-Modell, Vitamin-Modell, Salutogenese, moderierte lineare Regression, Arbeitsanalyse, emotionale Dissonanz, psychophysische Beschwerden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Fragestellung und Hypothesen, Methoden, Ergebnisse und Diskussion. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Wo finde ich den vollständigen Inhalt der Diplomarbeit?
Der vollständige Inhalt der Diplomarbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten, aber der Inhaltsverzeichnis gibt einen umfassenden Überblick über die Struktur und den Inhalt der Arbeit.
- Citation du texte
- Matthias Becker (Auteur), 2009, Entscheidungsspielraum als Moderator zwischen Arbeitsanforderungen und ihren gesundheitlichen Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151290