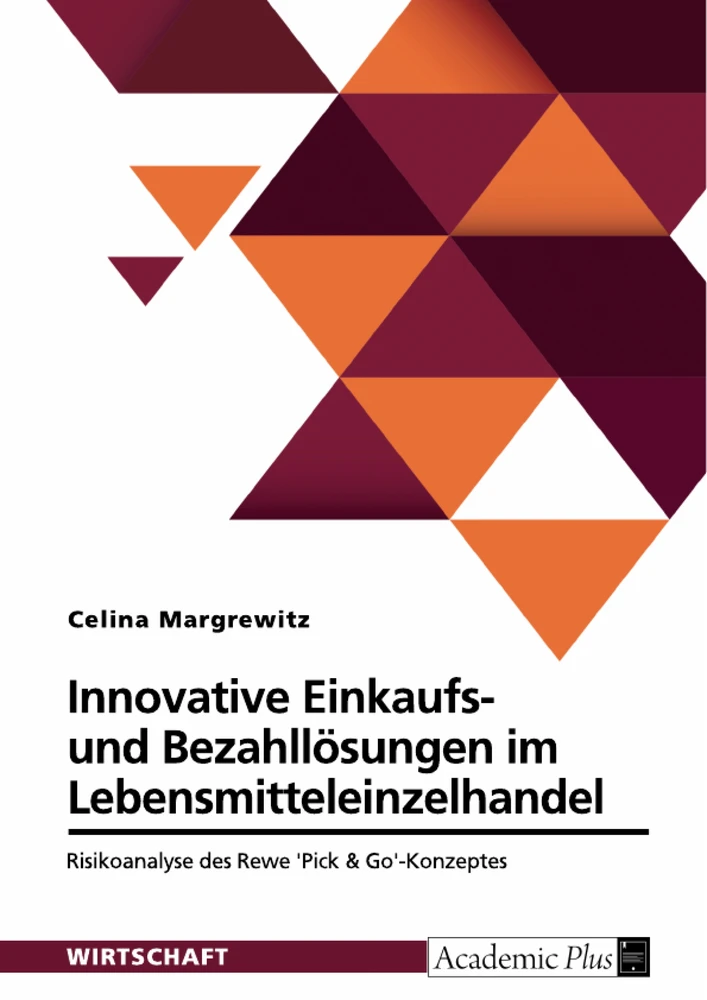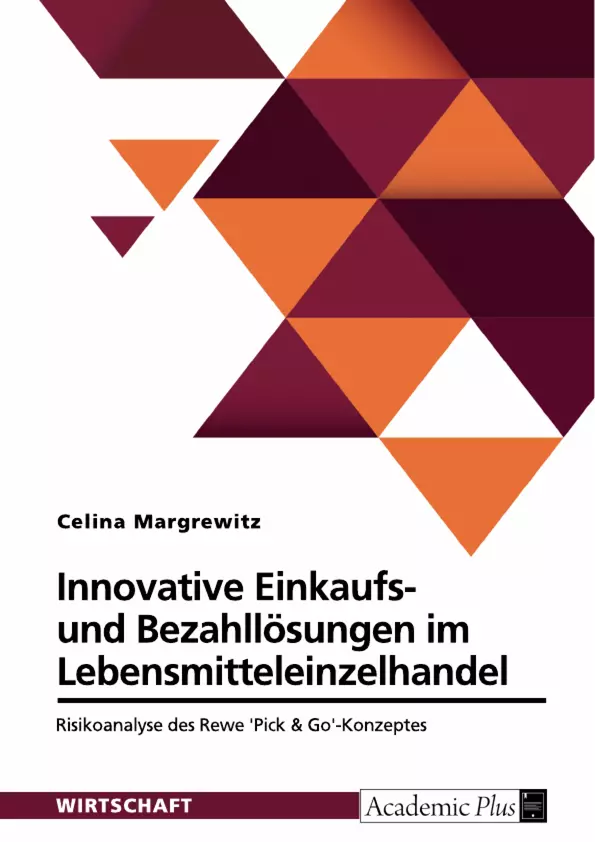Im Zentrum der Arbeit stehen zwei Forschungsfragen: Erstens wird untersucht, welche Arten von Risiken im Zusammenhang mit dem „Pick & Go“-Konzept identifiziert werden können. Dabei werden insbesondere wahrgenommene Unsicherheiten und mögliche negative Konsequenzen beleuchtet, die Kunden mit der Nutzung dieses digitalen Einkaufs- und Bezahlinstruments verbinden. Zweitens wird analysiert, inwiefern die beiden Komponenten Unsicherheit und Ausmaß der negativen Kauffolge, basierend auf dem Zwei-Komponenten-Modell von Cunningham, die Risikowahrnehmung des „Pick & Go“-Konzeptes beeinflussen.
Zur Beantwortung dieser Fragen wurde eine qualitative Untersuchung in Form von Interviews durchgeführt, deren Auswertung mithilfe der Software MAXQDA erfolgte. Die Datenanalyse basiert auf der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring, und es wird ein Kategoriensystem entwickelt, um die identifizierten Risiken zu klassifizieren und auszuwerten.
Die Arbeit schließt mit einer kritischen Reflexion der Untersuchungsergebnisse. Dabei wird sowohl auf die Chancen als auch die Herausforderungen des „Pick & Go“-Systems im Kontext digitaler Services eingegangen. Ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen im Bereich digitaler Zahlungslösungen im Einzelhandel rundet die Untersuchung ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Relevanz des „Pick & Go-Konzeptes“ von Rewe als innovatives Einkaufs- und Bezahlinstrument
- 1.1 Problemstellung und Bedeutung des Themas
- 1.2 Forschungsfragen und Zielsetzung
- 1.3 Methodische Vorgehensweise
- 2 Einordnung der Begrifflichkeiten
- 2.1 Darstellung der Begrifflichkeiten digitale Einkaufs- und Bezahlinstrumente sowie digitale Services
- 2.2 Vorstellung des „Pick & Go-Konzeptes“ von Rewe
- 2.3 Abgrenzung des Konzeptes „Pick & Go“ zu anderen digitalen Diensten
- 3 Beschreibung des aktuellen Forschungstandes
- 3.1 Der aktuelle Forschungsstand des „Pick & Go-Konzeptes“
- 3.2 Forschungslücke und Relevanz für die vorliegende Arbeit
- 4 Theoretischer Bezugsrahmen
- 4.1 Auswahl und Begründung der Theorie
- 4.2 Die Ursprünge der Risikotheorie
- 4.3 Das Zwei-Komponenten-Modell von Cunningham
- 4.4 Die in der Theorie dargestellten Risikoarten und ihre Übertragung auf den Forschungsgegenstand
- 5 Die Erstellung und Durchführung des Interviewleitfadens
- 5.1 Auswahl der Interviewteilnehmer
- 5.2 Die Erstellung des Interviewleitfadens
- 5.3 Pretest des Leitfadens
- 5.4 Durchführung der Interviews
- 6 Aufbereitung der Daten und Beschreibung des Vorgehens der qualitativen Inhaltsanalyse
- 6.1 Transkription des Datenmaterials
- 6.2 Die Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring
- 6.2.1 Die Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse
- 6.2.2 Die Güterkriterien der qualitativen Inhaltsanalyse
- 6.2.3 Das Ablaufmodell der Analyse
- 6.3 Die Erstellung des Kategoriensystems nach Mayring
- 7 Datenauswertung und Interpretation der Ergebnisse unter Einbezug des Zwei-Komponenten-Modells von Cunningham
- 7.1 Kategorienbasierte Darstellung und Auswertung der identifizierten Risikoarten
- 7.2 Die Analyse der Nutzungsbereitschaft unter Einbezug des Zwei-Komponenten-Modells von Cunningham
- 7.3 Die Analyse der Nutzungsbereitschaft vor dem Hintergrund bereits gesammelter Erfahrungen mit digitalen Services
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Nutzung innovativer digitaler Einkaufs- und Bezahlinstrumente im stationären Lebensmitteleinzelhandel, fokussiert auf Rewes „Pick & Go“-Konzept. Ziel ist es, die Risiken aus risikotheoretischer Perspektive qualitativ zu analysieren.
- Risikobewertung des „Pick & Go“-Konzeptes
- Analyse der Akzeptanz digitaler Bezahlmethoden
- Nutzererfahrungen mit digitalen Services im Lebensmitteleinzelhandel
- Anwendung des Zwei-Komponenten-Modells von Cunningham
- Qualitative Forschung mit Interviewmethode
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und formuliert die Forschungsfragen. Kapitel 2 klärt die Begrifflichkeiten und stellt das „Pick & Go“-Konzept vor. Kapitel 3 analysiert den aktuellen Forschungsstand und identifiziert Forschungslücken. Kapitel 4 beschreibt den theoretischen Bezugsrahmen, insbesondere das Zwei-Komponenten-Modell von Cunningham. Kapitel 5 erläutert die Methode, die Datenerhebung und -aufbereitung. Kapitel 6 detailliert die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Datenauswertung.
Schlüsselwörter
Digitale Einkaufsinstrumente, digitale Bezahlmethoden, „Pick & Go“, Lebensmitteleinzelhandel, Risikotheorie, qualitative Inhaltsanalyse, Nutzerakzeptanz, Zwei-Komponenten-Modell, Rewe.
- Citar trabajo
- Celina Margrewitz (Autor), 2024, Innovative Einkaufs- und Bezahllösungen im Lebensmitteleinzelhandel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1513103