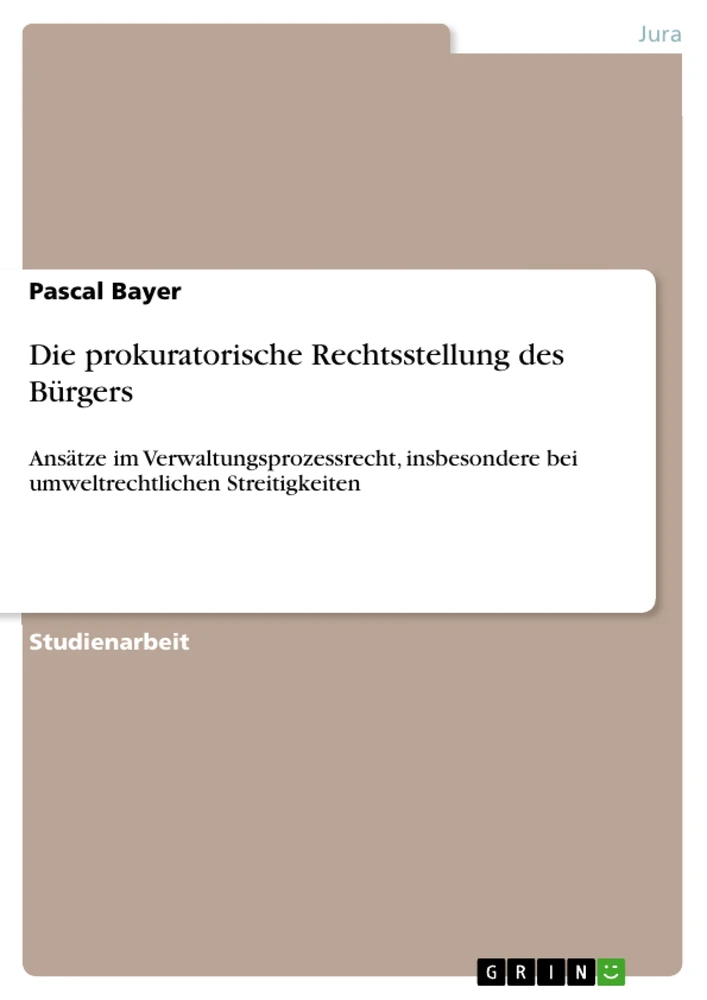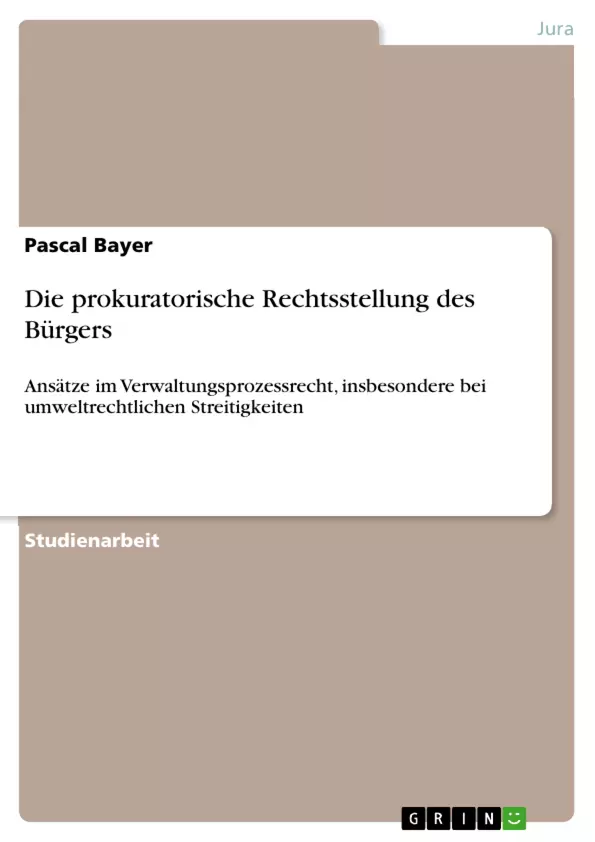Diese Arbeit beschäftigt sich mit der prokuratorischen Rechtsstellung des Bürgers. Sie zeigt zunächst deren Entwicklung in der ergangenen Rechtsprechung im Bereich des Umweltrechts auf und stellt sodann zusammenfassend dar, was eine prokuratorische Rechtsstellung ist. Im Anschluss daran wird untersucht, ob die für den Bereich des Umweltrechts dargestellten Entwicklungen auf das allgemeine Verwaltungsprozessrecht übertragen werden können und ob dies sinnvoll ist. Ist das der Fall, werden erste Vorschläge entwickelt, wie eine solche Übertragung gelingen kann.
Inhaltsverzeichnis
B.Entwicklung der Rechtsfigur in der umweltrechtlichen Rechtsprechung. 1
I.EuGH, Urt. v. 25.7.2008 – C-237/07 (Janecek) 1
II.EuGH, Urt. v. 8.3.2011 – C-240/09 (slowakischer Braunbär) 2
III.EuGH, Urt. v. 12.5.2011 – C-115/09 (Trianel) 3
IV.BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12. 5
V.BVerwG, Urt. v. 19.12.2013 – 4 C 14/12. 6
VI.EuGH, Urt. v. 20.12.2017 – C-664/15 (Protect) 7
VII.Zusammenfassung: Was ist ein prokuratorisches Recht?. 8
VIII.Aktuelle Rechtsprechung der deutschen Verwaltungsgerichte. 8
C.Übertragung auf das allgemeine Verwaltungsprozessrecht möglich und sinnvoll?. 9
D.Vorschläge für eine Übertragung. 14
Literaturverzeichnis
|
Bader, Johann/Funke-Kaiser, Michael/Stuhlfauth, Thomas/von Albedyll, Jörg |
Verwaltungsgerichtsordnung, 8. Aufl. 2021, Heidelberg 2021 (zit.: VwGO/Bearbeiter). |
|
Dürig, Günter/Herzog, Roman/Scholz, Rupert |
Grundgesetz, Kommentar, Band III, 103. EL 2024 (zit.: GG/Bearbeiter). |
|
Fehling, Michael/Kastner, Berthold/Störmer, Rainer (Hrsg.) |
Verwaltungsrecht – VwVfG, VwGO, Nebengesetze, Handkommentar, 5. Aufl. 2021, Baden-Baden 2021 (zit.: VerwR/Bearbeiter). |
|
Franzius, Claudio |
Rechtsschutz als Steuerungsstrategie, in: ZUR 2024, 195. |
|
Ders. |
Baustellen des Umweltrechtsschutzes, in: DVBl. 2018, 410. |
|
Ders. |
Modernisierung des subjektiven öffentlichen Rechts, in: UPR 2016, 281. |
|
Ders. |
Möglichkeiten und Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung zur Bestimmung der Klagebefugnis im Umweltrecht, in: DVBl. 2014, 543. |
|
Gluding, Katja Viktoria |
Kollektiver und überindividueller Rechtsschutz im Zivil- und Verwaltungsprozessrecht – Eine übergreifende Betrachtung unter Einbeziehung der Musterfeststellungsklage, 1. Aufl. 2020, Baden-Baden 2020. |
|
Guckelberger, Annette/Mitschang, Ella |
Klagerecht der Umweltvereinigungen gegen Kfz-Typengenehmigung, in: NJW 2022, 3747. |
|
Kahl, Wolfgang/Ludwigs, Markus (Hrsg) |
Handbuch des Verwaltungsrechts, Band IV: Status des Einzelnen und Verfahren, 1. Aufl. 2022, Heidelberg 2022 (zit.: Kahl/Ludwigs/Bearbeiter). |
|
Kintz, Roland |
Öffentliches Recht im Assessorexamen, 12. Aufl. 2024, München 2024. |
|
Klinger, Remo |
Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 20.12.2017, C-664/15, in: NVwZ 2018, 225. |
|
Kloepfer, Michael |
Umweltrecht, 4. Aufl. 2016, München 2016. |
|
Mangold, Katharina/Wahl, Rainer |
Das europäisierte deutsche Rechtsschutzkonzept, in: Die Verwaltung 48 (2015), 1. |
|
Masing, Johannes |
Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts – Europäische Impulse für eine Revision der Lehre vom subjektiv-öffentlichen Recht, Berlin 1997. |
|
Posser, Herbert/Wolff, Heinrich Amadeus/Decker, Andreas (Hrsg.) |
Beck’scher Online-Kommentar VwGO, 69. Edition, Stand: 01.04.2024 (zit.: BeckOK VwGO/Bearbeiter). |
|
Rennert, Klaus |
Funktionswandel der Verwaltungsgerichtsbarkeit?, in: DVBl. 2015, 793. |
|
Ders. |
Übersicht über die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Umweltrecht anlässlich der 40. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltrecht (GfU) vom 10.-12. November 2016 in Leipzig, im Internet abrufbar unter: https://www.bverwg.de/medien/pdf/rede_201611_gfu_rennert.pdf (zuletzt abgerufen am: 28.07.2024, 13:21 Uhr; zit.: Rspr.-Übersicht). |
|
Rennert, Klaus |
Verwaltungsgerichtsbarkeit im europäischen Kontext, im Internet abrufbar unter: https://www.bverwg.de/medien/pdf/rede_20161103_wien_rennert.pdf (zuletzt abgerufen am: 28.07.2024 13:21 Uhr; zit.: Rennert Verwaltungsgerichtsbarkeit). |
|
Ders. |
Funktionswandel der Verwaltungsgerichtsbarkeit unter dem Einfluss des Unionsrechts? – Umfang des Verwaltungsrechtsschutzes auf dem Prüfstand, 14. September 2016, im Internet abrufbar unter: https://www.bverwg.de/user/data/media/rede_20160914_essen_funktionswandel_rennert.pdf (zuletzt abgerufen am: 28.07.2024, 13:22 Uhr; zit.: Rennert Funktionswandel). |
|
Schlacke, Sabine |
(Auf)Brüche des Öffentlichen Rechts: von der Verletztenklage zur Interessentenklage, in: DVBl. 2015, 929. |
|
Schoch, Friedrich/Schneider, Jens-Peter (Hrsg.) |
Verwaltungsrecht – VwGO, Kommentar, 45. EL 2024, München 2024 (zit.: Schoch/Schneider/Bearbeiter). |
|
Stüer, Bernhard |
Zukunft der Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: DVBl. 2016, 829. |
|
Voßkuhle, Andres/Schemmel, Jakob |
Grundwissen – Öffentliches Recht: Die Europäisierung des Verwaltungsrechts, in: JuS 2019, 347. |
Einleitung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der prokuratorischen Rechtsstellung des Bürgers. Sie zeigt zunächst deren Entwicklung in der ergangenen Rechtsprechung im Bereich des Umweltrechts auf und stellt sodann zusammenfassend dar, was eine prokuratorische Rechtsstellung ist. Im Anschluss daran wird untersucht, ob die für den Bereich des Umweltrechts dargestellten Entwicklungen auf das allgemeine Verwaltungsprozessrecht übertragen werden können und ob dies sinnvoll ist. Ist das der Fall, werden erste Vorschläge entwickelt, wie eine solche Übertragung gelingen kann.
Entwicklung der Rechtsfigur in der umweltrechtlichen Rechtsprechung
Die Entwicklung der prokuratorischen Rechte durch die Rechtsprechung erfolgte wie so oft im Umweltrecht aufgrund von Impulsen durch die europäische Ebene, hier durch den EuGH. [1] Diese Entwicklungslinie im Umweltrecht wird im Folgenden anhand der wichtigsten Entscheidungen chronologisch dargestellt.
EuGH, Urt. v. 25.7.2008 – C-237/07 (Janecek) [2]
Der heutige Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Dieter Janecek, [3] klagte vor dem Verwaltungsgericht München gegen den Freistaat Bayern auf Aufstellung eines Luftreinhalteaktionsplanes im Bereich der Landshuter Allee, welche sich in München befindet. Er begehrte die Verpflichtung zu kurzfristig zu ergreifenden Maßnahmen zur Einhaltung der unionsrechtlich vorgegebenen Grenzwerte von Feinstaubpartikeln. [4] Nachdem das Verfahren bis vor das Bundesverwaltungsgericht gelangt war, setzte dieses das Verfahren aus und legte dem EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 AEUV [5] mehrere Fragen vor. [6] Unter anderem wollte das Bundesverwaltungsgericht wissen, „ob ein Einzelner von den zuständigen nationalen Behörden im – in Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie 96/62/EG [7] geregelten – Fall der Gefahr einer Überschreitung der Grenzwerte oder der Alarmschwellen die Erstellung eines Aktionsplanes beanspruchen kann.“ [8]
Im Wesentlichen entschied der EuGH, dass sowohl natürliche als auch juristische Personen notfalls auch vor Gericht erwirken können müssen, dass ein Aktionsplan erstellt wird. [9] Voraussetzung hierfür sei, dass die Person „unmittelbar von der Gefahr einer Überschreitung der Grenzwerte oder der Alarmschwellen betroffen“ [10] ist. [11]
EuGH, Urt. v. 8.3.2011 – C-240/09 (slowakischer Braunbär) [12]
In diesem Vorabentscheidungsverfahren, vorgelegt von einem slowakischen Gericht, klagte vor den dortigen nationalen Gerichten ein Umweltschutzverein gegen das slowakische Umweltministerium. Der Verein machte geltend, er müsse an Verwaltungsverfahren, die u.a. die Genehmigung von Ausnahmen von Artenschutzregelungen wie z.B. den slowakischen Braunbären betreffen, beteiligt werden. [13] Die im Kontext dieser Arbeit relevante Vorlagefrage ging dahin, ob Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention [14] unmittelbar anwendbar ist oder diese Norm zumindest unmittelbare Wirkung durch das Gemeinschaftsrecht im nationalen Recht vermittelt. [15]
Hierzu entschied der EuGH, dass die Durchführung und die Wirkung von Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention vom Erlass eines weiteren nationalen Rechtsaktes abhingen. [16] Es sei zudem Sache der Mitgliedstaaten, das Verfahrensrecht für Klagen betreffend den Schutz Einzelner und diesen erwachsenen Rechte aus dem Unionsrecht zu regeln. [17] Diese Verfahrensmodalitäten dürften „nicht weniger günstig ausgestaltet sein als die für entsprechende innerstaatliche Klagen (…) und die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren (…)“[18]. Hieraus schlussfolgert der EuGH, dass ein nationales Gericht das nationale Verfahrensrecht in Bezug auf die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens vor dem Hintergrund von Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention so auszulegen hat, dass eine gerichtliche Anfechtung einer möglicherweise unionsrechtswidrigen Entscheidung möglich ist. [19]
EuGH, Urt. v. 12.5.2011 – C-115/09 (Trianel) [20]
In diesem Vorabentscheidungsverfahren legte das OVG Münster dem EuGH mehrere aufeinander rekurrierende Fragen vor. [21] Dem Verfahren lag das Begehren des BUND zugrunde, den für die geplante Errichtung und den Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Lünen erteilten Vorbescheid aufheben zu lassen. [22] Problematisch war hier, dass das nationale Recht mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 5 S. 1 Nr. 1 UmwRG [23] zum maßgeblichen Zeitpunkt keine Klageberechtigung für den BUND vorsah. [24] Das OVG Münster wollte u.a. wissen, ob Art. 10a der Richtlinie 85/337/EWG [25] es erfordere, dass eine Nichtregierungsorganisation im Falle der Ausgestaltung des nationalen Prozessrechts im Sinne einer Verletztenklage die Geltendmachung von für die Vorhabenzulassung maßgeblicher Umweltvorschriften auch dann zulässig ist, wenn es sich um Vorschriften handelt, die lediglich den Interessen der Allgemeinheit dienen und damit nicht zumindest auch den Schutz von Rechtsgütern des Einzelnen bezwecken. [26]
Laut dem EuGH beschränke Art. 10a Abs. 1 der Richtlinie 85/337/EWG nicht die Gründe, die für einen Rechtsbehelf geltend gemacht werden können. Unter zwei Alternativen seien Rechtsbehelfe nach der Norm zulässig: entweder es existiere ein ausreichendes Interesse oder der Rechtsbehelfsführer mache eine Rechtsverletzung geltend. Je nach der Ausgestaltung des nationalen Rechts sei davon auszugehen, dass entweder die eine oder die andere Voraussetzung erfüllt ist. [27] Eine Beschränkung der Zulässigkeit eines nationalen Rechtsbehelfs auf subjektiv-öffentliche Rechte sei nicht zulässig im Hinblick auf Umweltverbände. Der Begriff der Rechtsverletzung aus Art. 10a Abs. 1 der Richtlinie 85/337/EWG könne daher nicht so verstanden werden, dass lediglich subjektiv-öffentliche Rechte darunterfallen. [28] Zu den von einem Umweltverband geltend zu machenden Rechten müssten daher zwingend die nationalen Rechtsvorschriften, welche Unionsumweltrecht umsetzen, und unmittelbar anwendbare Vorschriften des Unionsumweltrechts gehören. Es müsse einem Umweltverband also möglich sein vorzubringen, dass eine Entscheidung nationale Rechtsvorschriften, die aus Art. 6 der Habitatrichtlinie hervorgegangen sind, verletze. Auch wenn das nationale Verfahrensrecht eine gerichtliche Geltendmachung nicht zulasse, so müsse es einem Umweltverband dennoch möglich sein, in gewissen Fällen eine Entscheidung gerichtlich anzufechten. [29]
BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12
Mit diesem Urteil schuf das Bundesverwaltungsgericht zum ersten Mal richterrechtlich die sog. prokuratorische Rechtsstellung. Dabei bezog sich das Gericht insbesondere auf die EuGH-Rechtssachen Janecek und slowakischer Braunbär. [30]
Vor dem Ausgangsgericht (Verwaltungsgericht Wiesbaden) klagte eine nach § 3 UmwRG anerkannte Umweltvereinigung auf die Änderung des Luftreinhalteplans für Darmstadt. Laut Prognosen sollte dieser nicht dafür sorgen, dass an drei Stellen in Darmstadt die festgeschriebenen Grenzwerte für Stickstoff eingehalten werden können. [31]
Das Bundesverwaltungsgericht sah im geschilderten Fall die Klagebefugnis der Umweltvereinigung nicht gem. § 42 Abs. 2 Hs. 1 VwGO [32] gegeben. Eine Verbandsklagemöglichkeit bestehe nicht. Auch könne der Anwendungsbereich des UmwRG nicht durch eine Analogie auf Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention erstreckt werden. Eine planwidrige Regelungslücke existiere nicht. Insbesondere hätten die Nationalstaaten einen Spielraum hinsichtlich des „Wie“ der durch Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention zwingenden Zulässigkeit einer umweltrechtlichen Verbandsklage. Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention sei zudem nicht unmittelbar anwendbar. [33]
Jedoch stellt das Gericht auf § 42 Abs. 2 Hs. 2 VwGO ab. Hier beruft es sich auf § 47 Abs. 1 BImSchG[34]. Diese Norm bezwecke den Schutz der menschlichen Gesundheit, sodass sich unmittelbar betroffene natürliche Personen hierauf berufen könnten. Das gelte aber nicht für Umweltverbände als juristische Personen, da diese in ihrer Gesundheit nicht betroffen sein könnten. [35] Allerdings gebiete das Unionsrecht „eine erweiternde Auslegung der aus dem Luftqualitätsrecht folgenden subjektiven Rechtspositionen.“ [36] Denn nach dem EuGH stehe unmittelbar betroffenen juristischen Personen genau wie natürlichen Personen ein Klagerecht zu. In dieser Betroffenheit sei die Geltendmachung überindividueller Rechtspositionen angelegt. Die juristische Person dürfe ein fremdes Interesse wie z.B. die Gesundheit von Mitarbeitern zum eigenen Anliegen machen, sofern ein räumlicher Bezug zu dem Wirkungsbereich der Immissionen bestehe. Durch diese Voraussetzungen, die aus dem Unionsrecht folgten, sei in unionsrechtskonformer Auslegung von § 42 Abs. 2 Hs. 2 VwGO das subjektive Recht von Umweltverbänden anzuerkennen. [37] Der Bürger habe also eine prokuratorische Rechtsstellung inne, „bezogen auf das objektive Interesse an einer Sicherung der praktischen Wirksamkeit und der Einheit des Unionsrechts.“ [38] Zu den unmittelbar betroffenen juristischen Personen gehörten die nach § 3 UmwRG anerkannten Umweltverbände. Im Ergebnis hätten alle nach § 3 UmwRG anerkannten Umweltverbände ein vom Unionsrecht gefordertes Interesse, da solche anerkannten Verbände sich für den Umweltschutz einsetzen und die durch die mit § 3 UmwRG getroffene Grundentscheidung des Gesetzgebers erfüllen. [39]
BVerwG, Urt. v. 19.12.2013 – 4 C 14/12
Kurz nachdem der 4. Senat die prokuratorische Rechtsstellung zulässigerweise im Rahmen der richterrechtlichen Rechtsfortbildung geschaffen hatte, [40] entschied der 4. Senat über einen ähnlich gelagerten Fall. Dabei vermied er jedoch eine Vorlage an den Großen Senat, indem er sich eines Kunstgriffes bediente. [41]
In dem Verfahren klagte ein in Sachsen anerkannter Naturschutzverein gegen Flugrouten für den Flughafen Leipzig/Halle. Diese führten u.a. über Natura 2000-Gebiete. Der Verein machte im Wesentlichen geltend, vor Festlegung der Flugrouten hätte eine Umweltverträglichkeits- und FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müssen, welche hier nach Änderung der Flugrouten nicht erneut erfolgt waren. [42]
Das Gericht entschied, dass § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 S. 1 UmwRG den gerichtlichen Zugang nicht eröffne, da Flugroutenfestlegungen nicht zu den Entscheidungen gehörten, nach denen nach dem UVPG [43] eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müsse. [44] Eine Erweiterung des Anwendungsbereiches den UmwRG komme vor dem Hintergrund des Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention nicht in Betracht. Es bestehe keine planwidrige Regelungslücke, da der Anwendungsbereich des UmwRG abschließend sei. [45] Im Ergebnis erkennt der 4. Senat ein prokuratorisches Klagerecht nur an, wenn vom Verband ein Individualrecht eines Dritten geltend gemacht wird. Ausschließlich objektives Recht vermittele also keine prokuratorische Klagebefugnis. [46]
EuGH, Urt. v. 20.12.2017 – C-664/15 (Protect) [47]
In Österreich klagte die Umweltorgansisation Protect gegen eine Wiedererteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung für eine Beschneiungsanlage. Die Organisation wollte in dem Verfahren die Stellung als Partei zuerkannt bekommen. [48]
In dem Vorabentscheidungsverfahren entschied der EuGH, dass Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention i.V.m. Art. 47 GrCh [49] die Mitgliedstaaten dazu verpflichte, „einen wirksamen gerichtlichen Schutz der durch das Recht der Union garantierten Rechte, insbesondere der Vorschriften des Umweltrechts, zu gewährleisten“[50]. Eine nationale Vorschrift des Verfahrensrechts, die den gerichtlichen Zugang regelt, müsse zuerst „im Einklang sowohl mit den Zielen von Art. 9 Abs. 3 des Übereinkommens von Aarhus als auch mit dem Ziel eines effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes für die durch das Unionsrecht verliehenen Rechte“ [51] ausgelegt werden. Sollte eine solche Auslegung jedoch nicht möglich sein, so müsse die jeweilige nationale Verfahrensvorschrift unangewendet bleiben. [52] Durch diese Entscheidung hat der EuGH klargestellt, dass es auf prokuratorische Rechte eines Umweltverbandes, die ja einen Unterfall des subjektiv-öffentlichen Rechts darstellen, im Bereich des Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention nicht mehr ankommen kann. [53]
Zusammenfassung: Was ist ein prokuratorisches Recht?
Bei prokuratorischen Rechten handelt es sich um eine Kategorie subjektiv-öffentlicher Rechte, welche es Umweltschutzverbänden ermöglicht, objektives Umweltrecht zu verteidigen. [54] Es handelt sich somit gerade nicht um eine Verbandsklage. [55]
Aktuelle Rechtsprechung der deutschen Verwaltungsgerichte
Mittlerweile ist nach den deutschen Verwaltungsgerichten nach deren neueren Entscheidungen eine prokuratorische Rechtsstellung nicht mehr einschlägig, auch wenn diese (noch) geprüft wird. [56] Eine solche Rechtsstellung wird meistens verneint, weil vorausgesetzt wird, dass ein prokuratorisches Klagerecht subjektive Rechte von natürlichen Personen voraussetze und solche in der einschlägigen Entscheidung nicht gegeben seien. [57] Teilweise wird auch eingeworfen, der Gesetzgeber habe mit der Novelle des UmwRG im Jahr 2017 eine abschließende Regelung für Umweltverbände getroffen [58] oder die streitgegenständlichen Vorschriften seien nicht dem Bereich des europäischen Umweltrechts zuzuordnen. [59] In der Rechtsprechung ist es um die prokuratorischen Rechte wieder ruhiger geworden.
Übertragung auf das allgemeine Verwaltungsprozessrecht möglich und sinnvoll?
Dieser Abschnitt widmet sich der besonderen Frage, ob eine Übertragung prokuratorischer Rechte bzw. deren Regelung im allgemeinen Verwaltungsprozessrecht möglich und vor allem auch sinnvoll ist.
Übertragung möglich?
Das deutsche Verwaltungsprozessrecht ist von der Verletztenklage geprägt. [60] § 42 Abs. 2 VwGO sieht vor, dass ein Kläger (Antragsteller/Widerspruchsführer) geltend machen muss, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein. Nur dann ist die Klage zulässig, es handelt sich somit um eine Sachurteilsvoraussetzung. [61] Das gilt dann, soweit nicht gesetzlich ein Anderes bestimmt ist. Auch wenn der Wortlaut der Norm die Ausnahme [62] (die nur selten greift) untypischerweise an den Anfang der Norm stellt, so stellt die von § 42 Abs. 2 Hs. 2 VwGO vorausgesetzte Geltendmachung einer Verletzung in einem subjektiv-öffentlichen Recht den Regelfall dar. [63] Grund für die Systementscheidung für die Verletztenklage [64] ist neben dem Ausschluss von Popularrechtsbehelfen [65] auch der von Interessentenklagen. [66] Das sind Klagen, bei denen lediglich ein eigenes Interesse verlangt wird, welches unterschiedlicher Art sein kann. Die Geltendmachung eines subjektiv-öffentlichen Rechts ist hierbei gerade keine Voraussetzung. [67]
Ob die von § 42 Abs. 2 Hs. 2 VwGO aufgestellte Voraussetzung für die Zulässigkeitsprüfung eines Rechtsbehelfes vorliegt, bestimmt sich nach der sog. Möglichkeitstheorie. Danach ist es ausreichend, wenn der Rechtsbehelfsführer substantiiert geltend macht, möglicherweise in einem subjektiv-öffentlichen Recht verletzt zu sein. [68] Ein solches subjektiv-öffentliches Recht liegt nach der sog. Schutznormtheorie immer dann vor, wenn die betroffene Norm zumindest auch dem Schutz von Individualinteressen dient und der Rechtsbehelfsführer zum geschützten Personenkreis gehört. [69] Gerade in den Drittbeteiligungsfällen muss auf die Schutznormtheorie abgestellt werden. [70]
Das Europarecht [71] ist so flexibel bzw. offen, um den Mitgliedstaaten die Entscheidung zu überlassen, welches Rechtsschutzmodell diese in ihrem nationalen Recht ausführen. Insbesondere verstößt das Verletztenklagemodell nicht gegen Europarecht. [72] Mithin gibt es keine grundsätzlichen Vorgaben aus dem Europarecht, die es erfordern würden, das deutsche verwaltungsrechtliche Rechtsschutzsystem im Hinblick auf die Klagebefugnis zu verändern. Ein Wechsel hin zum Interessentenklagemodell ist nicht erforderlich. [73]
Auch verfassungsrechtlich steht der Einführung einer prokuratorischen Klagebefugnis nichts entgegen. [74] Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG [75] regelt lediglich, dass jedem der Rechtsweg offen stehen muss, wenn er durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt ist. Die Rechtsverletzung meint hier eine Verletzung in subjektiv-öffentlichen Rechten. [76] Ob eine solche Verletzung tatsächlich vorliegt, ist jedoch eine Frage der Begründetheit des Rechtsbehelfs (siehe § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO). Verfassungsrechtliche Voraussetzung ist demnach nur, dass in allen Fällen der Geltendmachung einer Verletzung in einem subjektiv-öffentlichen Recht der Rechtsweg offenstehen muss. [77] Darüber hinausgehende Regelungen, wie die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen für Verbände oder bei einer prokuratorischen Rechtsstellung, sind zulässig. [78] Denn sie erweitern die Fälle, in denen um Rechtsschutz vor den nationalen Gerichten nachgesucht werden kann und gehen damit über die verfassungsrechtliche „Mindestanforderung“ [79] hinaus. [80]
Nach dem Vorangegangenen stünde es dem deutschen Gesetzgeber somit frei, eine Erweiterung von Klagemöglichkeiten [81] auf prokuratorische Rechtsstellungen durchzuführen.
Dabei muss es sich auch nicht zwingend für oder gegen eine (neuerliche) Systementscheidung in Bezug auf das Verletztenklagemodell handeln – dieses kann beibehalten werden. [82] Das System kann vielmehr durchbrochen werden von prokuratorischen Rechten, [83] ganz besonders im Bereich des Umweltrechts. Damit würde eine Annäherung an die übrigen europäischen Staaten stattfinden. [84]
Übertragung sinnvoll?
Ob es sinnvoll ist, eine prokuratorische Rechtsstellung in das allgemeine Verwaltungsprozessrecht der VwGO zu inkorporieren, ist jedoch eine ganz andere Fragestellung. Durch das Urteil des EuGH in der Rechtssache Protect ist klar geworden, dass eine nationale Verfahrensnorm im Zweifel unangewendet bleibt, sofern sie die Möglichkeit von Rechtsschutz zu eng zieht. [85] Ein Bedürfnis für eine prokuratorische Rechtsstellung zumindest im Bereich des unionsrechtlich determinierten Rechts sehen daher auch die meisten Gerichte nicht (mehr). [86] Mittlerweile lassen sich die dortigen Fälle über die Verbandsklage regeln. [87]
Das täuscht jedoch darüber hinweg, dass es dennoch Fälle außerhalb des Umweltrechts geben kann, die eine prokuratorische Rechtsstellung erfordern. Ohne eine prokuratorische Rechtsstellung bestünde keine Möglichkeit der Anfechtung einer Entscheidung. [88] So kann z.B. im Bereich des Informationsfreiheitsrechtes eine solche Rechtsstellung erforderlich sein. [89] Prokuratorische Rechte müssen sich somit nicht zwangsläufig nur auf das Umweltrecht beschränken. [90] Insbesondere handelt es sich bei einer solchen Beschränkung um eine rechtssystematische Verfehlung. [91]
Teilweise wird vertreten, prokuratorische Rechte nur im Ausnahmefall zuzulassen, z.B. dann, wenn die zugrundeliegenden öffentlichen Interessen „einen Bezug zu demokratischen Mitwirkungsrechten aufweisen und die Teilhabe des Bürgers an der Verwirklichung des Gemeinwohls zu fördern geeignet sind.“ [92] Auch zulässig seien solche Rechte, wenn es um den Schutz von überragend wichtigen öffentlichen Interessen gehe und Vollzugsdefizite bestehen. [93] Eine solche begrenzte Übertragung in das allgemeine Prozessrecht erscheint vor dem Hintergrund des deutschen subjektiven Rechtsschutzsystems vorzugswürdig. An der Grundentscheidung für das Verletztenklagemodell würde damit nichts geändert werden, zudem werden mögliche Rechtsschutzlücken oder die eben erwähnten Vollzugsdefizite beseitigt, [94] was rechtsstaatlich gesehen als Gewinn verstanden werden kann.
Neben einer Anwendbarkeit auf Verbände wäre auch danach zu fragen, ob diese neuartige Rechtsfigur [95] auf Individuen, mithin natürliche Personen, Anwendung finden soll. [96] Diese Frage vermag die vorliegende Arbeit jedoch nicht zu beantworten, wäre diese dann doch zu umfangreich.
Alles in allem ist damit eine Übertragung auf das allgemeine Verwaltungsprozessrecht sinnvoll, [97] wenn auch überlegt und in Grenzen.
Vorschläge für eine Übertragung
Überwiegend wird vertreten, dass der Gesetzgeber tätig werden müsse. [98] So wird z.B. konkret vorgeschlagen, in § 42 VwGO einen neuen Absatz 3 einzufügen. In diesem könnten die allgemeinen Voraussetzungen einer prokuratorischen Klagebefugnis geregelt werden. [99] In den einzelnen Fachgesetzen, wie zum Beispiel dem UmwRG, könnte dann auf § 42 Abs. 3 VwGO verwiesen werden. [100]
Es mag allerdings auch Fälle geben, wo einem Kläger nach heutigem Verständnis ein Klagerecht zukommen soll, dieses jedoch an der Hürde des § 42 Abs. 2 Hs. 2 VwGO scheitert. In einem solchen Fall, aber auch ganz generell, gäbe es die Möglichkeit (auf jeden Fall bis zu einer gesetzlichen Regelung), die Schutznormtheorie zu erweitern. [101] Eine solche könnte in der Weise geschehen, dass auch dem Bürger als Anwalt von Gemeinbelangen ein subjektiv-öffentliches Recht zuerkannt wird. [102]
Alles in allem spricht viel für ein Tätigwerden des Gesetzgebers. Das wäre vor dem Hintergrund von Art. 20 Abs. 3 GG zumindest wünschenswert. M.E. ist eine eindeutige gesetzliche Regelung erforderlich, um der Sektoralisierung des Umweltrechtsschutzes einen Riegel vorzuschieben [103] und das Verwaltungsprozessrecht im Allgemeinen neueren Entwicklungen, vor allem solchen des EU-Rechts, sofort und vor allem offen begegnen zu können.
Schlussendlich lässt sich feststellen, dass es der deutschen Verwaltungsrechtswissenschaft gut zu Gesicht stehen würde, die verwaltungsrechtliche Dogmatik zu hinterfragen und flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren. [104] Eine offener verstandene Dogmatik [105] bedeutet nicht gleich eine Abkehr von allem Bekannten. [106] Dem Gesetzgeber könnten hierdurch Denkanstöße gegeben werden.
Fazit
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Rechtsprechung die Diskussion um prokuratorische Rechte in Gang gebracht hat. Diese hat jedoch in den letzten Jahren eine Talfahrt angetreten. Nachdem Masing bereits 1997 [107] erstmals solche Rechte in der rechtswissenschaftlichen Literatur erwähnte und diese auch auf rechtswissenschaftlichen Tagungen diskutiert wurden, [108] sollte eine solche Diskussion auch auf rechtspolitischer Ebene geführt werden. Denn am Ende des Tages muss geklärt werden, ob prokuratorische Rechte den aktuellen Verwaltungsrechtsschutz erweitern sollen oder nicht. Zumindest die Diskussion darüber wäre – der Wichtigkeit des Themas geschuldet – ordentlich zu führen.
[1] Ähnlich siehe Voßkuhle/Schemmel, JuS 2019, 347, 349.
[2] EuGH, Urt. v. 25.7.2008, C-237/07, EU:C:2008:447 – Janecek.
[3] https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/J/janecek_dieter-857506 (zuletzt abgerufen am: 28.07.2024, 13:23 Uhr).
[4] EuGH, Urt. v. 25.7.2008, C-237/07, EU:C:2008:447, Rn. 13 ff.
[5] Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Fassung aufgrund des am 1.12.2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon (konsolidierte Fassung bekanntgemacht im ABl. EG Nr. C 115, S. 47), zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Kroatien und die Anpassungen des Vertrages über die Europäische Union, des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. EU L 112/21) mit Wirkung vom 1.7.2013.
[6] EuGH, Urt. v. 25.7.2008, C-237/07, EU:C:2008:447, Rn. 21.
[7] Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 26. September 1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität (ABl. L 296, S. 55), aufgehoben durch Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa (ABl. L 152, S. 1).
[8] So die „Übersetzung“ der Vorlagefrage des BVerwG durch den EuGH, EuGH, Urt. v. 25.7.2008, C-237/07, EU:C:2008:447, Rn. 34.
[9] EuGH, Urt. v. 25.7.2008, C-237/07, EU:C:2008:447, Rn. 42.
[10] EuGH, Urt. v. 25.7.2008, C-237/07, EU:C:2008:447, Rn. 42.
[11] EuGH, Urt. v. 25.7.2008, C-237/07, EU:C:2008:447, Rn. 42.
[12] EuGH, Urt. v. 8.3.2011, C-240/09, EU:C:2011:125 – slowakischer Braunbär.
[13] EuGH, Urt. v. 8.3.2011, C-240/09, EU:C:2011:125, Rn. 2, 20 ff.
[14] Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten vom 25. Juni 1998, von der Bundesrepublik Deutschland am 21.12.1998 in Aarhus unterzeichnet und durch Gesetz v. 9. Dezember 2006 (BGBl. 2006 II S. 1251) ratifiziert, in Kraft getreten am 16.12.2006.
[15] Vorlagefrage 2, EuGH, Urt. v. 8.3.2011, C-240/09, EU:C:2011:125, Rn. 23.
[16] EuGH, Urt. v. 8.3.2011, C-240/09, EU:C:2011:125, Rn. 45.
[17] EuGH, Urt. v. 8.3.2011, C-240/09, EU:C:2011:125, Rn. 47.
[18] EuGH, Urt. v. 8.3.2011, C-240/09, EU:C:2011:125, Rn. 48.
[19] EuGH, Urt. v. 8.3.2011, C-240/09, EU:C:2011:125, Rn. 52.
[20] EuGH, Urt. v. 12.5.2011, C-115/09, EU:C:2011:289 – Trianel; auf dieses Urteil hin wurde § 2 Abs. 5 Nr. 1 UmwRG neu geregelt, Mangold/Wahl, Die Verwaltung 48 (2015), 1, 21.
[21] EuGH, Urt. v. 12.5.2011, C-115/09, EU:C:2011:289, Rn. 34.
[22] EuGH, Urt. v. 12.5.2011, C-115/09, EU:C:2011:289, Rn. 24 ff.
[23] Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 2017 (BGBl. I S. 3290), zuletzt geändert durch Art. 14b des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405).
[24] EuGH, Urt. v. 12.5.2011, C-115/09, EU:C:2011:289, Rn. 28.
[25] Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27.6.1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABlEG Nr. L 175, S. 40) in der durch die Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 5. 2003 (ABlEG Nr. L 156, S. 17) geänderten Fassung.
[26] Vorlagefrage 1, EuGH, Urt. v. 12.5.2011, C-115/09, EU:C:2011:289, Rn. 34.
[27] EuGH, Urt. v. 12.5.2011, C-115/09, EU:C:2011:289, Rn. 37 ff.
[28] EuGH, Urt. v. 12.5.2011, C-115/09, EU:C:2011:289, Rn. 45 ff.
[29] EuGH, Urt. v. 12.5.2011, C-115/09, EU:C:2011:289, Rn. 48 ff.
[30] BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12, Rn. 41, 15.
[31] BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12, Rn. 1 ff.
[32] Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409).
[33] BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12, Rn. 25 ff.
[34] Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2023 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225).
[35] BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12, Rn. 39 ff.
[36] BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12, Rn. 43.
[37] BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12, Rn. 44 ff.
[38] BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12, Rn. 46.
[39] BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12, Rn. 47 ff.
[40] Vgl. Franzius, DVBl. 2018, 410, 414; Franzius, DVBl. 2014, 543, 550; a.A. Guckelberger/Mitschang, NJW 2022, 3747, 3748 m.w.N.; Kahl/Ludwigs/Kahl, § 94 Rn. 68.
[41] Rspr.-Übersicht, Seite 9.
[42] BVerwG, Urt. v. 19.12.2013 – 4 C 14/12, Rn. 1 ff.
[43] Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151).
[44] BVerwG, Urt. v. 19.12.2013 – 4 C 14/12, Rn.10 ff.
[45] BVerwG, Urt. v. 19.12.2013 – 4 C 14/12, Rn. 20.
[46] Den 4. Senat so verstehend Rspr.-Übersicht, Seite 9; Franzius, UPR 2016, 281; Schlacke, DVBl. 2015, 929, 934.
[47] EuGH, Urt. v. 20.12.2017, C-664/15, EU:C:2017:987 – Protect.
[48] EuGH, Urt. v. 20.12.2017, C-664/15, EU:C:2017:987, Rn. 2.
[49] Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 12. Dezember 2007 (ABl. Nr. C 303 S. 1), in Kraft getreten am 1.12.2009, siehe die Bek. v. 13.11.2009 (BGBl. II S. 1223).
[50] EuGH, Urt. v. 20.12.2017, C-664/15, EU:C:2017:987, Rn. 45.
[51] EuGH, Urt. v. 20.12.2017, C-664/15, EU:C:2017:987, Rn. 54.
[52] EuGH, Urt. v. 20.12.2017, C-664/15, EU:C:2017:987, Rn. 55; inhaltlich gleich, nur in anderer Sache: EuGH, Urt. v. 08.11.2022, C-873/19, EU:C:2022:857.
[53] Überlegung aus Klinger, NVwZ 2018, 225, 232 weitergeführt; a.A. Guckelberger/Mitschang, NJW 2022, 3747, 3749, die die prokuratorischen Rechte unter die Auslegung fassen.
[54] Kahl/Ludwigs/Kahl, § 94 Rn. 67; als subj.-öff. Recht verstehend auch VwGO/v. Albedyll, § 42 Rn. 68 und Mangold/Wahl, Die Verwaltung 48 (2015), 1, 22; als Mischform zwischen subjektiv-öffentlichen Rechten und öffentlichen Entscheidungsbefugnissen verstehend Masing, S. 226; bereits vor dem Hintergrund von BVerwG, Urt. v. 05.09.2013 – 7 C 21.12, Rn. 45 f., spätestens aber mit BVerwG, Urt. v. 19.12.2013 – 4 C 14.12, Rn. 20 ff. und vor allem BVerwG, Urt. v. 12.11.2014 – 4 C 34.13, Rn. 22 ff. ist das nicht mehr haltbar.
[55] Siehe VerwR/Sennekamp, § 42 VwGO Rn. 184; siehe zu den Arten der Verbandsklage Schoch/Schneider/Wahl/Schütz, § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 234 f.
[56] Siehe nur VGH BW, Urt. v. 14.07.2021 – 10 S 141/20; VGH Hessen, Beschl. v. 15.08.2019 – 4 B 1303/19; VG Lüneburg, Urt. v. 06.05.2021 – 2 A 6/20; VG Neustadt a.d. Weinstraße, Urt. v. 19.06.2020 – 4 K 981/19.NW; VG Düsseldorf, Urt. v. 24.01.2018 – 6 K 12341/17; die prokuratorische Klagebefugnis ausdrücklich nicht mehr geprüft hat OVG Berlin-Brandenburg Urt. v. 30.11.2023 – OVG 11 A 11/22; nicht geprüft auch VG Schleswig Urt. v. 20.2.2023 – VG 3 A 113/18, so wie es die Rechtssache „Protect“ des EuGH m.E. vorsieht.
[57] VGH BW, Urt. v. 14.07.2021 – 10 S 141/20, Rn. 76; VG Neustadt a.d. Weinstraße, Urt. v. 19.06.2020 – 4 K 981/19.NW, Rn. 41; so wohl auch VG Lüneburg, Urt. v. 06.05.2021 – 2 A 6/20, Rn. 40; offenlassend VGH Hessen, Beschl. v. 15.08.2019 – 4 B 1303/19.
[58] VGH BW, Urt. v. 14.07.2021 – 10 S 141/20, Rn. 75.
[59] VG Lüneburg, Urt. v. 06.05.2021 – 2 A 6/20, Rn. 41.
[60] Schoch/Schneider/Wahl, Vorb. § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 43; Schlacke, DVBl. 2015, 929; Rennert Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 3.
[61] Schoch/Schneider/Wahl/Schütz, § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 37; BeckOK VwGO/ Schmidt-Kötters § 42 Rn. 108.
[62] VwGO/v. Albedyll, § 42 Rn. 68; Gluding, S. 308.
[63] Schoch/Schneider/Wahl, Vorb. § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 42.
[64] VG Düsseldorf, Urt. v. 24.01.2018 – 6 K 12341/17, Rn. 237; BeckOK VwGO/Schmidt-Kötters, § 42 Rn. 108; Schoch/Schneider/Wahl, Vorb. § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 14; Rennert Funktionswandel, S. 4.
[65] BeckOK VwGO/Schmidt-Kötters, § 42 Rn. 108; Schoch/Schneider/Wahl/Schütz, § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 7.
[66] Schoch/Schneider/Wahl/Schütz, § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 8.
[67] Schoch/Schneider/Wahl/Schütz, § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 7.
[68] Kintz, Rn. 227.
[69] Kintz, Rn. 229 ff.
[70] Siehe BeckOK VwGO/Schmidt-Kötters, § 42 Rn. 153.
[71] Betrachtet man die europäischen Mitgliedstaaten, so hat nur Österreich noch das klassische Verletztenklagemodell, Schlacke, DVBl. 2015, 929, 936 und Rennert Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 7.
[72] EuGH, Urt. v. 15.10.2015, C-137/14, EU:C:2015:683.
[73] Vgl. Rennert Funktionswandel, S. 5.
[74] Vgl. Franzius, UPR 2016, 281.
[75] Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2478).
[76] VG Düsseldorf, Urt. v. 24.01.2018 – 6 K 12341/17, Rn. 250;
[77] Schoch/Schneider/Wahl, Vorb. § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 33.
[78] Vgl. Schoch/Schneider/Wahl, Vorb. § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 16.
[79] Siehe zur „Mindestanforderung“ Schoch/Schneider/Wahl/Schütz, § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 38 und Schoch/Schneider/Wahl, Vorb. § 42 Abs. 2 VwGO Rn. 16.
[80] Die zur Klage Befugten können also erweitert werden, Kloepfer, § 8 Rn. 44.
[81] Siehe auch Guckelberger/Mitschang, NJW 2022, 3747, 3750.
[82] Vgl. Rennert Funktionswandel, S. 3; Rennert, DVBl. 2015, 793, 801; wohl auch Mangold/Wahl, Die Verwaltung 48 (2015), 1, 24 ff.; siehe auch BeckOK VwGO/Schmidt-Kötters, § 42 Rn. 170.
[83] Nach Mangold/Wahl, Die Verwaltung 48 (2015), 1, 16 handelt es sich bei prokuratorischen Rechten um eine Systemausnahme.
[84] Siehe zu deren Rechtsschutzsystem oben Fn. 71.
[85] Siehe oben B. VI.
[86] Siehe oben Fn. 56.
[87] Kahl/Ludwigs/Kahl, § 94 Rn. 68.
[88] Siehe zu möglichen Voraussetzungen Rennert Funktionswandel, S. 6 f.
[89] Siehe Franzius, UPR 2016, 281.
[90] Erst einmal nur eine Regelung für das Umweltrecht fordernd Schlacke, DVBl. 2015, 929, 937.
[91] Vgl. Franzius, DVBl. 2018, 410, 416.
[92] Kahl/Ludwigs/Schenke, § 92 Rn. 77; siehe hierzu auch GG/Schmidt-Aßmann, Art. 19 Abs. 4 GG Rn. 117a.
[93] Kahl/Ludwigs/Schenke, § 92 Rn. 78.
[94] Siehe zu Vollzugsdefiziten Fn. 93.
[95] Kahl/Ludwigs/Kahl, § 94 Rn. 67.
[96] Dafür Franzius, DVBl. 2014, 543, 546 und Franzius, ZUR 2024, 195, 197; wohl auch Kahl/Ludwigs/Schenke, § 92 Rn. 76; dagegen Kahl/Ludwigs/Kahl, § 94 Rn. 69.
[97] Vgl. GG/Schmidt-Aßmann, Art. 19 Abs. 4 GG Rn. 117c; Schlacke, DVBl. 2015, 929, 937; Rennert, DVBl. 2015, 793, 795.
[98] Guckelberger/Mitschang, NJW 2022, 3747, 3749 (lediglich begrenzt auf das Umweltrecht); Schlacke, DVBl. 2015, 929, 936 f.; Rennert, DVBl. 2015, 793, 796; wohl auch Kahl/Ludwigs/Schenke, § 92 Rn. 76 ff.; Stüer, DVBl. 2016, 829, 833; primär auf § 42 Abs. 2 Hs. 2 VwGO beziehend Franzius, UPR 2016, 281.
[99] Schlacke, DVBl. 2015, 929, 937.
[100] Gegen ein Sonderprozessrecht für Verbandsklagen Rennert Funktionswandel, S. 11.
[101] Für eine Erweiterung Rennert Funktionswandel, S. 6, Franzius, UPR 2016, 281; grds. wohl auch Mangold/Wahl, Die Verwaltung 48 (2015), 1, 24 ff.; BeckOK VwGO/Schmidt-Kötters, § 42 Rn. 170.1.
[102] Franzius, UPR 2016, 281.
[103] Bei der es sich um eine rechtssystematische Verfehlung handelt, vgl. Franzius, DVBl. 2018, 410, 416.
[104] Die Dogmatik ist eben ein bewegliches System, siehe Franzius, DVBl. 2014, 543, 546.
[105] Dafür Franzius, DVBl. 2018, 410, 416.
[106] Als Fortentwicklung verstehend Franzius, ZUR 2024, 195, Fn. 34; als Aufbruch verstehend Schlacke, DVBl. 2015, 929, 930.
[107] Johannes Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts – Europäische Impulse für eine Revision der Lehre vom subjektiv-öffentlichen Recht, Berlin 1997.
[108] Siehe nur Rennert Funktionswandel.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Entwicklung der prokuratorischen Rechtsstellung des Bürgers"?
Der Text beschäftigt sich mit der Entwicklung der prokuratorischen Rechtsstellung des Bürgers, insbesondere im Umweltrecht. Es wird untersucht, wie sich diese Rechtsstellung in der Rechtsprechung entwickelt hat, was sie ausmacht und ob eine Übertragung auf das allgemeine Verwaltungsprozessrecht möglich und sinnvoll ist. Abschließend werden Vorschläge für eine solche Übertragung entwickelt.
Was ist eine prokuratorische Rechtsstellung?
Eine prokuratorische Rechtsstellung ist eine Kategorie subjektiv-öffentlicher Rechte, die es Umweltschutzverbänden ermöglicht, objektives Umweltrecht zu verteidigen. Es handelt sich nicht um eine Verbandsklage.
Welche Gerichtsurteile werden in Bezug auf die Entwicklung der prokuratorischen Rechtsstellung im Umweltrecht behandelt?
Der Text behandelt u.a. folgende Urteile des EuGH und des BVerwG: EuGH, Urt. v. 25.7.2008 – C-237/07 (Janecek), EuGH, Urt. v. 8.3.2011 – C-240/09 (slowakischer Braunbär), EuGH, Urt. v. 12.5.2011 – C-115/09 (Trianel), BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12, BVerwG, Urt. v. 19.12.2013 – 4 C 14/12, EuGH, Urt. v. 20.12.2017 – C-664/15 (Protect).
Ist eine Übertragung der prokuratorischen Rechtsstellung auf das allgemeine Verwaltungsprozessrecht möglich?
Ja, eine Übertragung ist grundsätzlich möglich, da weder das Europarecht noch das Verfassungsrecht dem entgegenstehen. Das deutsche Verwaltungsprozessrecht kann durch prokuratorische Rechte ergänzt werden.
Ist eine Übertragung der prokuratorischen Rechtsstellung auf das allgemeine Verwaltungsprozessrecht sinnvoll?
Ja, die Übertragung ist sinnvoll, wenn auch überlegt und in Grenzen. Auch wenn viele Fälle im Bereich des Unionsrechts über die Verbandsklage abgedeckt sind, kann es außerhalb des Umweltrechts Fälle geben, die eine prokuratorische Rechtsstellung erfordern, z.B. im Informationsfreiheitsrecht.
Wie könnte eine Übertragung der prokuratorischen Rechtsstellung auf das allgemeine Verwaltungsprozessrecht erfolgen?
Es wird überwiegend vertreten, dass der Gesetzgeber tätig werden müsste. Konkret wird vorgeschlagen, in § 42 VwGO einen neuen Absatz 3 einzufügen, in dem die allgemeinen Voraussetzungen einer prokuratorischen Klagebefugnis geregelt werden könnten.
Spielen prokuratorische Rechte noch eine Rolle in der aktuellen Rechtsprechung?
Mittlerweile wird die prokuratorische Rechtsstellung nach neueren Entscheidungen der deutschen Verwaltungsgerichte meist verneint, da sie subjektive Rechte von natürlichen Personen voraussetzen soll, die in der jeweiligen Entscheidung nicht gegeben seien.
- Quote paper
- Pascal Bayer (Author), 2024, Die prokuratorische Rechtsstellung des Bürgers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1514641