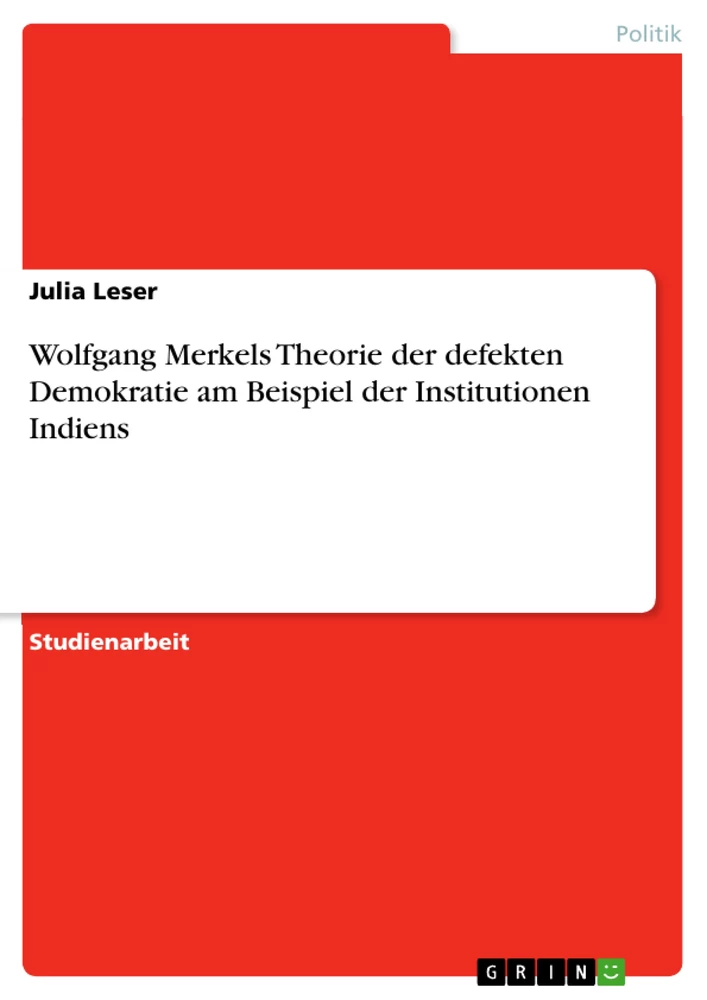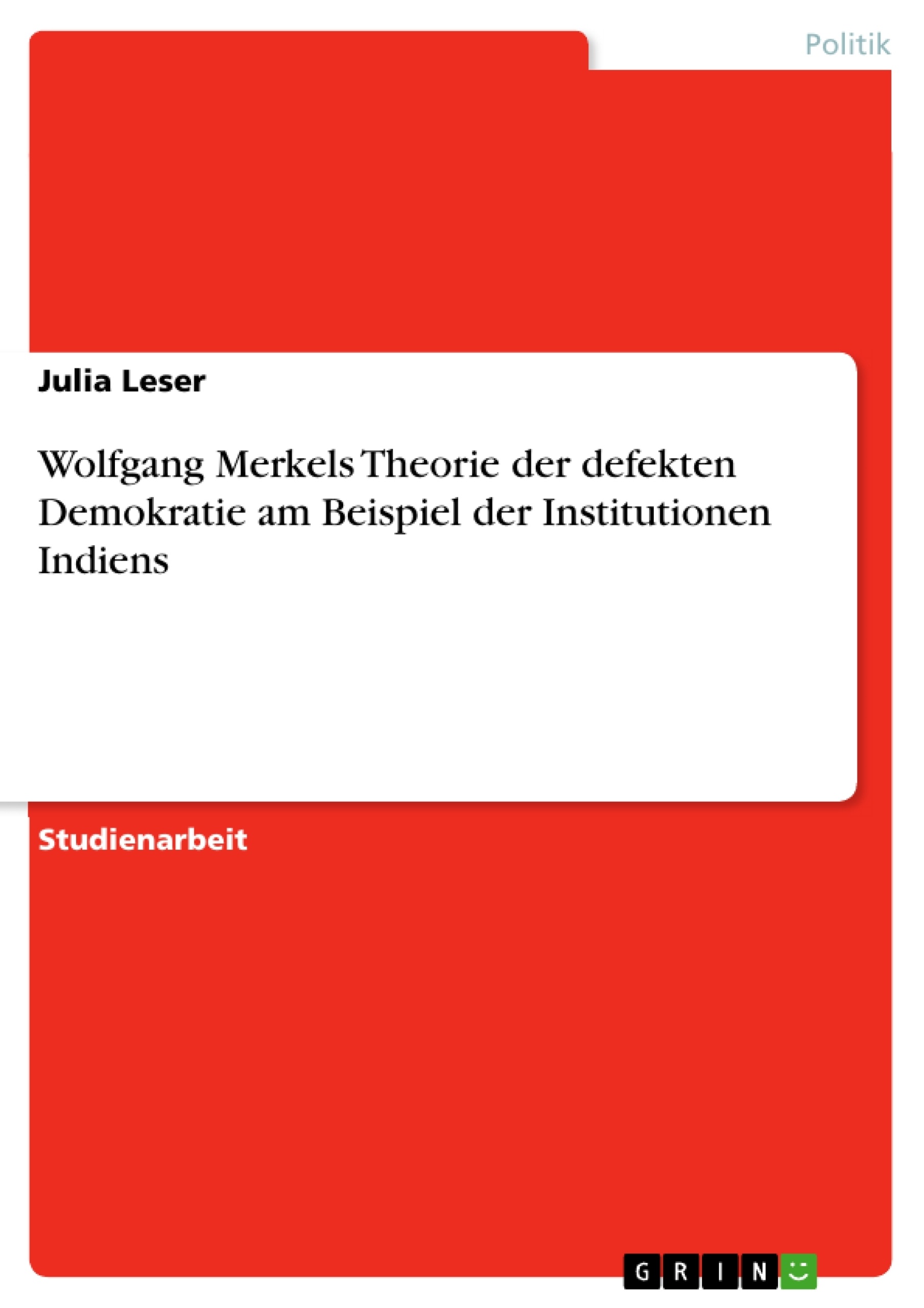Die indische Demokratie gleicht einem Mythos. Wie konnte sich ein Land, in dem die industrialisierte Wirtschaft weitgehend fehlt, in dem Armut und Analphabetismus vorherrschen und dessen ethnische, religiöse und kulturelle Vielfalt ohne Beispiel ist auf diesem Planeten, zu einer der ältesten und größten Demokratien der Welt entwickeln? Und warum kann eine solche Demokratie, dessen Gesellschaft sich entlang tiefster Konfliktlinien organisiert, auf Dauer überleben?
Eine Antwort darauf sucht man besonders im Bereich der Internationalen Beziehungen komparativer Politikwissenschaften, die eine Fülle an Theorien zur Analyse und zur Erklärung dieser Fragen hervorgebracht haben. Die vorliegende Arbeit wird sich mit einer für die Politikwissenschaft, insbesondere für die Transitionsforschung, sehr relevanten Theorie beschäftigen: mit der Theorie der Defekten Demokratie Wolfgang Merkels.
Wolfgang Merkel, Professor für Politikwissenschaft am Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin, untersucht seit Beginn der 1990er Jahre Transitionsländer auf ihrem Weg zur Demokratie. Sein kritisches und innovatives Konzept der „Defekten Demokratie“ ist bestrebt, politische Regimetypen, die sich in einer Grauzone zwischen Autoritarismus und Demokratie befinden, zu analysieren und zu kategorisieren. In zahlreichen Werken hat Merkel theoretische Grundlagen gelegt und verschiedenste Fallbeispiele geprüft, unter anderem auch Indien.
In dieser Arbeit wird die indische Demokratie unter Anwendung der Theorie von Wolfgang Merkel untersucht. Aufgrund der fast unüberschaubaren Menge an Analysemöglichkeiten werde ich mich an dieser Stelle auf den Bereich der Institutionen des politischen Regimes Indiens beschränken.
Diese Arbeit ist in zwei Kapitel unterteilt. Im ersten möchte ich die Theorie Merkels kurz darstellen und besonders den Untersuchungsansatz verfolgen, der die Ursachen defekter Demokratien in politischen Institutionen sucht. Im zweiten Teil soll nach einer kurzen Darstellung der Besonderheiten und Entstehungshintergründe der indischen Institutionen untersucht werden, wie das Konzept Merkels darauf angewendet werden kann, welche Lösungen es findet und welche Probleme sich dabei ergeben.
Ob diese Theorie allerdings ausreicht, um alle Fragen und Konflikte zu lösen, die die Vielfalt und Widersprüchlichkeiten rund um die Demokratie Indiens betreffen, bleibt frag- und kritikwürdig. Dies zu veranschaulichen ist Ziel der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wolfgang Merkels Theorie der Defekten Demokratie
- Das Konzept der "embedded democracy"
- Das Konzept der Defekten Demokratie
- Merkels Institutionenbegriff
- Anwendung der Theorie Merkels auf die politischen Institutionen Indiens
- Hauptcharakteristika und Entstehungshintergrund der Institutionen Indiens
- Indien - Eine defekte Demokratie?
- Kritik am Merkelschen Konzept
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die indische Demokratie anhand der Theorie der Defekten Demokratie von Wolfgang Merkel. Sie analysiert, ob die indischen politischen Institutionen den Kriterien einer funktionierenden Demokratie entsprechen und ob die Theorie Merkels zur Erklärung der Herausforderungen der indischen Demokratie beitragen kann.
- Die Theorie der Defekten Demokratie von Wolfgang Merkel
- Die politischen Institutionen Indiens und ihre Entstehung
- Die Anwendung der Theorie Merkels auf die indische Demokratie
- Kritikpunkte und Limitationen der Theorie Merkels im Kontext Indiens
- Die Bedeutung der indischen Demokratie für die Transitionsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der indischen Demokratie ein und stellt die Relevanz der Theorie der Defekten Demokratie für die Analyse des indischen Falls dar. Kapitel 2 präsentiert die Theorie der Defekten Demokratie von Wolfgang Merkel, einschließlich des Konzepts der "embedded democracy" und der Definition defekter Demokratien. Kapitel 3 untersucht die Anwendung der Theorie Merkels auf die politischen Institutionen Indiens, beleuchtet die Besonderheiten des indischen Systems und analysiert, inwiefern die Theorie zur Erklärung der Herausforderungen der indischen Demokratie beiträgt. Die Schlussbetrachtung fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und diskutiert die Grenzen der Theorie Merkels im Kontext Indiens.
Schlüsselwörter
Defekte Demokratie, "embedded democracy", Wolfgang Merkel, Indien, politische Institutionen, Transitionsforschung, Demokratie, Autoritarismus, Wahlregime, Politische Teilhaberechte, Rechtsstaatlichkeit, Horizontale Gewaltenkontrolle, Effektive Regierungsgewalt, Staatlichkeit, Markt, Säkularisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Wolfgang Merkels Theorie der „defekten Demokratie“?
Es ist ein Konzept zur Kategorisierung von Regimetypen, die sich in einer Grauzone zwischen Autoritarismus und voll entwickelter Demokratie befinden.
Warum wird Indien als Fallbeispiel untersucht?
Indien gilt als „Demokratie-Mythos“, da es trotz Armut und enormer ethnischer Vielfalt eine der stabilsten Demokratien der Welt ist, aber dennoch institutionelle Defekte aufweisen könnte.
Was bedeutet „embedded democracy“?
Es beschreibt eine Demokratie, die durch ein Geflecht von internen Kontrollen (Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung) und externen Bedingungen (Zivilgesellschaft, Markt) gestützt wird.
Welche Defekte können in einer Demokratie auftreten?
Mögliche Defekte liegen in der Einschränkung von Teilhaberechten, mangelnder Rechtsstaatlichkeit oder fehlender effektiver Regierungsgewalt.
Gibt es Kritik an Merkels Theorie im Kontext Indiens?
Ja, die Arbeit hinterfragt, ob das westlich geprägte Konzept ausreicht, um die komplexen Widersprüchlichkeiten der indischen Gesellschaft und Politik vollständig zu erklären.
- Arbeit zitieren
- Julia Leser (Autor:in), 2009, Wolfgang Merkels Theorie der defekten Demokratie am Beispiel der Institutionen Indiens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151528