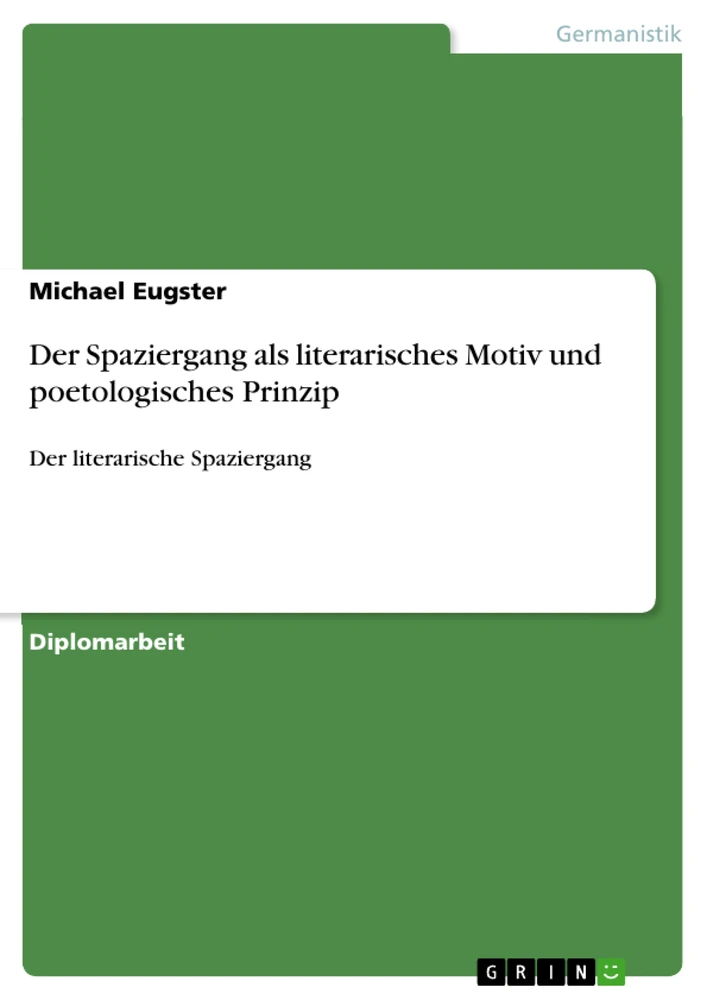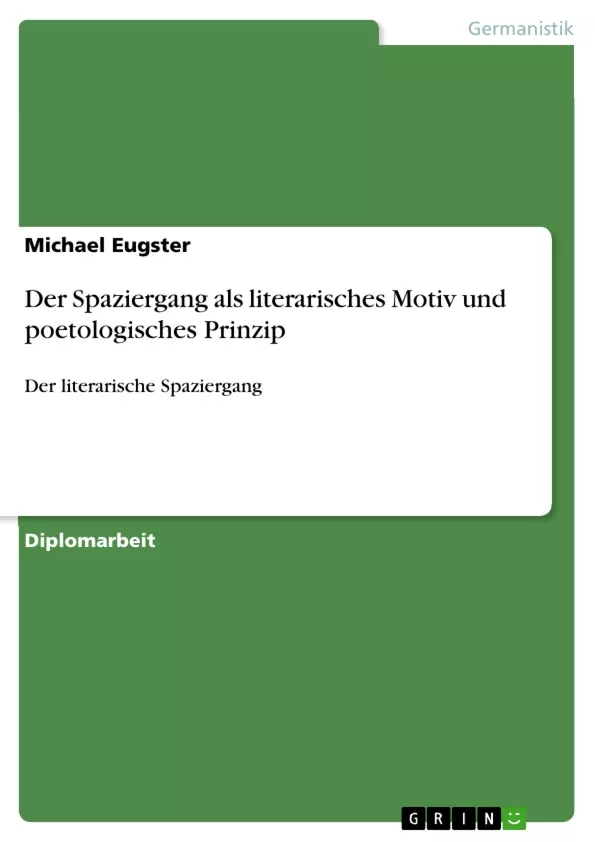„Die Erde klingt meinem harten Tritt auf schweigenden Wegen –
Was ist mir noch an der lauen Welt, an mir selber gelegen?
Was ich gewesen, was ich gelebt, war Jammer und Schwäche.
Mir spannt sich die Faust, auf dass ich den Tand mit Fäusten zerbreche.
Ich wachse, ich steige, ich werde frei, Sturm werde mein Wille! –
Mein Denken fliegt wie ein Jubelschrei durch die Winterstille.“
(Otto Ernst, Auszug aus dem Gedicht Spaziergang, 1907)
Ich werde mich in dieser Arbeit dem Thema des poetischen Spaziergangs widmen und eine kleine Analyse seiner literarischen Motive und poetischen Prinzipien durchführen. Für den angewandten Teil werde ich mich etwas ausführlicher auf die Erzählung Gehen von Thomas Bernhard konzentrieren, um vorgängig in der Theorie gewonnene Thesen und Resultate am Text zu argumentieren und zu rechtfertigen. Kenntnis der weiterführenden Literatur von diversen Autoren, sowie ein gewisses Verständnis der technischen Begrifflichkeiten setze ich für den Leser dieser Arbeit voraus.
Man darf getrost behaupten, dass in unseren Breitengraden wohl die meisten Menschen ziemlich klare Vorstellungen von einem Spaziergang haben. Mag es nun ein Familienspaziergang sein oder ein Flanieren an der Seepromenade, ein Verdauungsspaziergang oder ein gemütliches Schlendern durch die Felder; es gibt verschiedenste Varianten, aber sie scheiden sich im Detail. Wenn es sich jedoch um den literarischen Spaziergang handelt, dann gibt es einige ganz klare Kriterien und Merkmale. Meine Ambition in dieser Arbeit ist es, verschiedene kennzeichnende Motive und Prinzipien des poetologischen Spaziergangs herauszuarbeiten. Hierfür werde ich im folgenden Kapitel die Terminologie und wichtige Unterscheidungen zu anderen Arten des Gehens, wie sie für den Gang dieser Untersuchung relevant sind, definieren. Ich möchte nicht nur den historischen Hintergrund beleuchten, sondern auch den Zusammenhang mit dem Spaziergang als kulturelle Praxis in den Vordergrund holen. Ich werde mich hingegen nicht weiter auf alltagsgebräuchliche Verwendungen der Fortbewegungsterminologie wie „Liebesleute gehen miteinander“, und Sprichwörter wie „das war ein Spaziergang“, einlassen. Es wird sich hier auch zeigen, dass die Umgebung für die entsprechende Art des Gehens von zentraler Bedeutung ist.
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung & Fragestellung
- Terminologie & Motivik
- Poetik des Spaziergangs
- ,,Gehen“ von Thomas Bernhard
- Abschliessende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das literarische Motiv des Spaziergangs und seine poetologischen Prinzipien. Der Fokus liegt auf der Erarbeitung kennzeichnender Motive und Prinzipien des poetologischen Spaziergangs, unter Einbezug des historischen Hintergrunds und des Zusammenhangs mit dem Spaziergang als kulturelle Praxis. Die Analyse wird anhand von Thomas Bernhards Erzählung „Gehen“ veranschaulicht.
- Der Spaziergang als literarisches Motiv
- Die Poetik des Spaziergangs: Antinomien von Bewegung und Nicht-Bewegung, Nähe und Ferne
- Der Spaziergang als kulturelle Praxis und sein gesellschaftlicher Kontext
- Textanalyse von Thomas Bernhards „Gehen“
- Der Spaziergang als Ausdruck von Freiheit und Suche
Zusammenfassung der Kapitel
Gliederung & Fragestellung: Dieses einleitende Kapitel skizziert die Forschungsfrage der Arbeit: die Analyse des poetischen Spaziergangs als literarisches Motiv und poetologisches Prinzip. Es wird die Methodik der Arbeit erläutert, die auf einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema und einer anschließenden Textanalyse von Thomas Bernhards „Gehen“ basiert. Die Autorin betont die Notwendigkeit eines Verständnisses der relevanten Terminologie und setzt ein gewisses Vorwissen beim Leser voraus. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung von kennzeichnenden Motiven und Prinzipien des literarischen Spaziergangs, wobei alltagsgebräuchliche Interpretationen des Begriffs ausgeschlossen werden.
Terminologie & Motivik: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung und die kulturelle Bedeutung des Spaziergangs. Es wird der Ursprung im aristokratischen Lustwandeln des 18. Jahrhunderts hervorgehoben, sowie der soziale Aspekt und die Verbindung zur Entwicklung von Parkanlagen und Promenaden. Die Autorin differenziert zwischen verschiedenen Arten des Gehens und definiert den Spaziergang als eine Form der zweckfreien Bewegung, die der Erholung, Entspannung, Beobachtung und gedanklicher Musse dient. Der Zusammenhang zwischen dem Spaziergang als kulturelle Praxis und dem verkehrstechnologischen Fortschritt wird analysiert, wobei der Spaziergang als progressives und regressives Moment dargestellt wird: progressiv, da er ein Heraustreten aus gesellschaftlichen Zwangsstrukturen symbolisiert, und regressiv, da er eine Absage an den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt darstellen kann.
Poetik des Spaziergangs: In diesem Kapitel wird die spezifische Poetik des literarischen Spaziergangs untersucht. Es werden die Antinomien von Bewegung und Nicht-Bewegung sowie Nähe und Ferne des Erzählers hervorgehoben, die den Kern dieser literarischen Form ausmachen und gleichzeitig die schöpferische Kraft der Sprache in Frage stellen. Die Autorin betont das Potential, aber auch die Nähe zum Wahn, die in dieser Form des Gehens liegt. Die permanente Nähe des Lesers zum Text wirft Fragen nach dem Fortschreiten des Textes selbst auf. Der literarische Spaziergang wird als ein außergewöhnlicher Rahmen für die eigene Bewegungsfreiheit betrachtet, wobei die Suche nicht unbedingt verzweifelt sein muss, sondern auch als positives Ziel verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Spaziergang, literarisches Motiv, Poetik, Thomas Bernhard, Gehen, Bewegung, Nicht-Bewegung, Nähe, Ferne, kulturelle Praxis, Gesellschaft, Natur, Antinomien, Textanalyse, Bewegungsfreiheit, Suche.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des literarischen Motivs des Spaziergangs in Thomas Bernhards „Gehen“
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert das literarische Motiv des Spaziergangs und seine poetologischen Prinzipien. Der Fokus liegt auf der Erarbeitung kennzeichnender Motive und Prinzipien des poetologischen Spaziergangs, unter Einbezug des historischen Hintergrunds und des Zusammenhangs mit dem Spaziergang als kulturelle Praxis. Die Analyse wird anhand von Thomas Bernhards Erzählung „Gehen“ veranschaulicht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Spaziergang als literarisches Motiv; Die Poetik des Spaziergangs (Antinomien von Bewegung und Nicht-Bewegung, Nähe und Ferne); Der Spaziergang als kulturelle Praxis und sein gesellschaftlicher Kontext; Textanalyse von Thomas Bernhards „Gehen“; Der Spaziergang als Ausdruck von Freiheit und Suche.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Gliederung & Fragestellung; Terminologie & Motivik; Poetik des Spaziergangs; „Gehen“ von Thomas Bernhard; Abschließende Bemerkungen.
Was wird im Kapitel „Gliederung & Fragestellung“ behandelt?
Dieses Kapitel skizziert die Forschungsfrage (Analyse des poetischen Spaziergangs als literarisches Motiv und poetologisches Prinzip) und die Methodik (theoretische Auseinandersetzung und Textanalyse von Bernhards „Gehen“). Es wird die Relevanz der Terminologie betont und ein gewisses Vorwissen beim Leser vorausgesetzt. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung von kennzeichnenden Motiven und Prinzipien des literarischen Spaziergangs, wobei alltagsgebräuchliche Interpretationen ausgeschlossen werden.
Was wird im Kapitel „Terminologie & Motivik“ behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung und kulturelle Bedeutung des Spaziergangs, seinen Ursprung im aristokratischen Lustwandeln, den sozialen Aspekt und die Verbindung zur Entwicklung von Parkanlagen und Promenaden. Es differenziert zwischen verschiedenen Arten des Gehens und definiert den Spaziergang als zweckfreie Bewegung zur Erholung, Entspannung, Beobachtung und gedanklicher Musse. Der Zusammenhang zwischen Spaziergang als kulturelle Praxis und verkehrstechnologischem Fortschritt wird analysiert, wobei der Spaziergang als progressives und regressives Moment dargestellt wird.
Was wird im Kapitel „Poetik des Spaziergangs“ behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die spezifische Poetik des literarischen Spaziergangs, insbesondere die Antinomien von Bewegung und Nicht-Bewegung sowie Nähe und Ferne des Erzählers. Es betont das Potential und die Nähe zum Wahn in dieser literarischen Form. Die permanente Nähe des Lesers zum Text wirft Fragen nach dem Fortschreiten des Textes auf. Der literarische Spaziergang wird als außergewöhnlicher Rahmen für die eigene Bewegungsfreiheit betrachtet, wobei die Suche nicht unbedingt verzweifelt sein muss.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spaziergang, literarisches Motiv, Poetik, Thomas Bernhard, Gehen, Bewegung, Nicht-Bewegung, Nähe, Ferne, kulturelle Praxis, Gesellschaft, Natur, Antinomien, Textanalyse, Bewegungsfreiheit, Suche.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit richtet sich an Leser mit einem gewissen Vorwissen im Bereich Literaturwissenschaft und ist für akademische Zwecke konzipiert.
- Citation du texte
- Liz. Phil. Michael Eugster (Auteur), 2010, Der Spaziergang als literarisches Motiv und poetologisches Prinzip, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151537