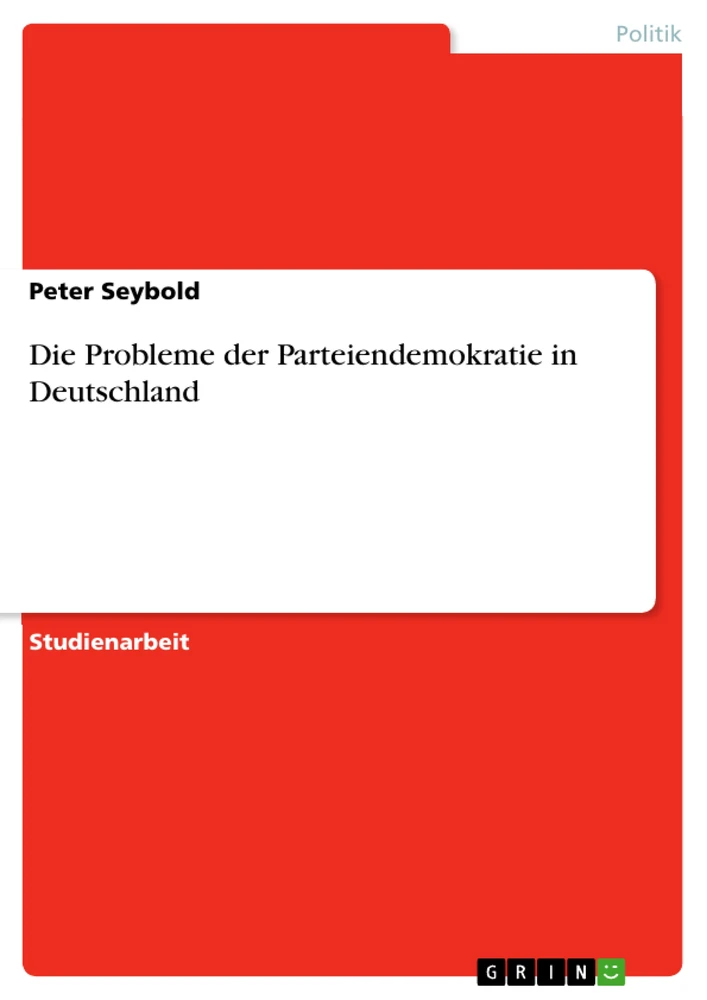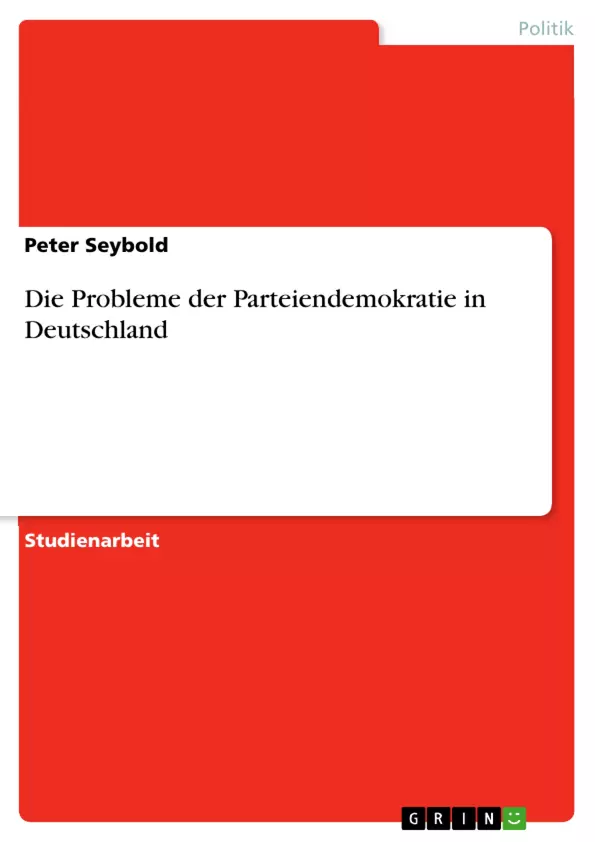Die Stimmung in der säschischen SPD ist erschüttert. Entsetzen und Ratlosigkeit macht sich in den Fluren der sozialdemokratischen Fraktion im Dresdner Landtag breit. "Die Unruhe ist groß", schreibt das Nachrichtenmagazin Spiegel. Das Umfrageinstitut Forsa hat soeben eine repräsentative Umfrage veröffentlicht, nach der die SPD bei der nächsten Wahl zum säschischen Landtag nur noch mit acht Prozent der Stimmen rechnen kann. Die NPD mit neun Prozent - ein Prozentpunkt mehr als die Sozialdemokraten. Die amtierende große Koalition hat in der Umfrage keine Mehrheit mehr. Die Linkspartei hingegen ist mit prognostizierten 27 Prozent stark wie noch nie.
Deutschland im September 2007. Für die säschischen Genossen ist diese Umfrage nicht die erste Hiobsbotschaft. Im Gründungsland der SPD sind sie seit der Wiedervereinigung nie richtig auf die Beine gekommen, gegenwärtig werden sie zwischen dem Koalitionspartner CDU und der oppositionellen Linkspartei zerrieben. Und nun das. "Die Situation ist dramtisch", sagt der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt.
Auch wenn sich die Zahlen nur aus einer Umfrage beziehen, und in den kommenden Jahren wieder zu Missgunsten der NPD ändern werden: Die Verhältnisse in Dresden stehen beispielhaft für den Umbruch in der deutschen Parteiendemokratie. Politische Parteien verlieren durch sinkende Wahlbeteiligungen, Mitgliederzahlen und Partizipationen sowie dem Erfolg rechtsextremer Parteien massiv an Bedeutung. Das Parteiensystem wandelt sich kontinuierlich, statt ehemals vier Parteien sitzen nun in manchen Parlamenten derer sechs oder gar sieben. Das Wahlverhalten vieler Milieus ändert sich fortlaufend, auch das zwischen den alten und neuen Bundesländern. Hinzu kommt die große Einflussnahme der EU und der Medien. Die andauernde Wahlabfolge von Kommunal- ,Landtags- ,Europa- und Bundestagswahlen und das wachsende Problem der Parteienfinanzierung sind ebenfalls nicht gerade förderlich für eine Demokratie.
Die Nachfolger von Nationalsozialisten stärker als Sozialdemokraten, die beiden ehemaligen Volksparteien CDU und SPD selbst zusammen nicht stark genug für eine Regierung, die Wahlbeteiligung nicht weit über 50%. Noch ist die Situation nicht überall so dramatisch wie in Sachsen, doch steckt die deutsche Parteiendemokratie in einer tiefen Krise. Es lohnt sich daher ein genauer Blick auf die gegenwärtige Situation der Parteiendemokratie: Wie gestalten sich die einzelnen Probleme der Parteien genau - und welche Folgen haben sie?
Inhaltsverzeichnis
- A) Einführung
- B) Die Probleme der Parteiendemokratie in Deutschland
- 1. Bedeutungsverlust politischer Parteien
- 1.1 Weniger Mitglieder und Partizipation
- 1.2 Sinkende Wahlbeteiligung
- 1.3 Erfolg rechtsextremer Parteien
- 2. Tiefgreifender Wandel des Parteiensystems
- 2.1 Vom 4- zum 6-7 Parteiensystem
- 2.2 Auflösung der parteilichen Millieus
- 2.3 Unterschiedliches Wahlverhalten Ost-West
- 3. Zu große Einflussnahme bestimmter Faktoren auf die Parteiendemokratie
- 3.1. Andauernde Wahlabfolge
- 3.2 Problem der Finanzierung und Geldgeber
- 3.3 Einfluss der Medien und der EU
- C) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Probleme der Parteiendemokratie in Deutschland. Sie untersucht die Gründe für den Bedeutungsverlust politischer Parteien, den Wandel des Parteiensystems und den Einfluss bestimmter Faktoren auf die Parteiendemokratie.
- Bedeutungsverlust politischer Parteien durch sinkende Mitgliederzahlen, Wahlbeteiligung und Partizipation sowie dem Erfolg rechtsextremer Parteien
- Wandel des Parteiensystems von einem Vier- zu einem Sechs- oder Sieben-Parteien-System
- Auflösung der parteilichen Milieus und unterschiedliches Wahlverhalten in Ost- und Westdeutschland
- Einflussnahme von Faktoren wie andauernde Wahlabfolge, Parteienfinanzierung, Medien und EU auf die Parteiendemokratie
- Die Folgen der Probleme für die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Situation der Parteiendemokratie in Deutschland dar und beleuchtet die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht. Sie zeigt anhand des Beispiels der sächsischen SPD, wie sich die Probleme der Parteiendemokratie konkret auswirken können.
Das Kapitel "Bedeutungsverlust politischer Parteien" analysiert den Rückgang der Mitgliederzahlen, die sinkende Wahlbeteiligung und den Erfolg rechtsextremer Parteien. Es zeigt, wie sich die Parteien von der Gesellschaft entwurzeln und an Einfluss verlieren.
Das Kapitel "Tiefgreifender Wandel des Parteiensystems" beschreibt die Veränderungen im deutschen Parteiensystem, die sich durch die Entstehung neuer Parteien und die Auflösung traditioneller Milieus auszeichnen. Außerdem werden die Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Ost- und Westdeutschland betrachtet.
Das Kapitel "Zu große Einflussnahme bestimmter Faktoren auf die Parteiendemokratie" untersucht die Auswirkungen von Faktoren wie andauernde Wahlabfolge, Parteienfinanzierung, Medien und EU auf die Parteiendemokratie.
Schlüsselwörter
Parteiendemokratie, Bedeutungsverlust, Wahlbeteiligung, Mitgliederzahlen, Partizipation, Rechtsextremismus, Wandel des Parteiensystems, Parteienfinanzierung, Medien, EU, Demokratie, politische Kultur
- Citation du texte
- Peter Seybold (Auteur), 2009, Die Probleme der Parteiendemokratie in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151560