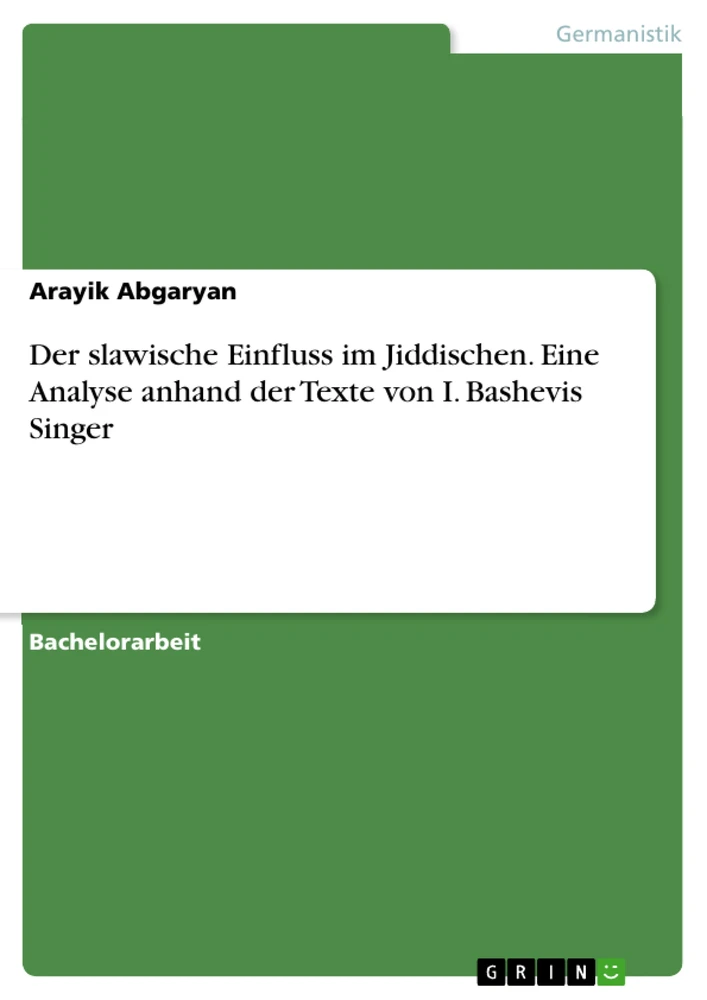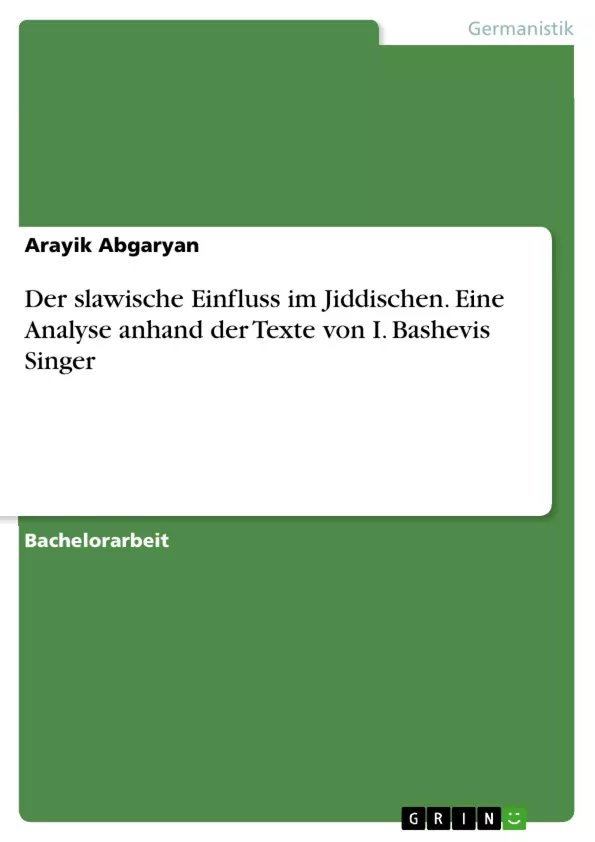Die Erforschung der jiddischen Sprache hat sich seit dem letzten Jahrhundert entwickelt und das Interesse an der jiddischen Sprache sowohl selbst bei Juden als auch bei Nichtjuden gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit.
Das Jiddische, das für fast tausend Jahre die Muttersprache der aschkenasischen Juden war, wurde in verschiedenen historischen und kulturellen Lebensbereichen von anderen Sprachen stark beeinflusst. Durch die Zerstreuung der Juden in die verschiedenen Länder kam es zu einem Sprachwechsel in neuer Sprachumgebung. Diese Sprachen haben in der Entwicklung des Jiddischen auf fast alle Spracheebenen ihre Spur hinterlassen, weswegen das Jiddische zahlreiche Sprachmerkmale aufweist, die für die jeweilige Sprache typisch sind (Simon).
Der Begriff „jiddisch“ ist ein neues Kunstwort und tritt erst im 20. Jahrhundert in deutschsprachigen Kontexten auf. Der Begriff geht auf die englische Form „Yiddish“ zurück, welcher eine Anglisierung des Deutschen „jüdisch“ ist (Simon, S 27). Bei der Anglisierung wurde der Konsonant „d“ verdoppelt, um die Aussprache „i“ zu erhalten und der sonst im Englischen naheliegenden Aussprache „ai“ vorzubeugen. Von da aus wurde das Wort in der Form „jiddisch“ auch ins Deutsche übernommen.
Unter Jiddisch versteht man die Sprache der nicht– assimilierten jüdischen Bevölkerung Ost– und (zum Teil auch) Mitteleuropas und zählt wie das Deutsche, das Englische oder das Niederländische, zu den westgermanischen Sprachen. In dieser Gruppe nimmt es jedoch eine besondere Position ein. Einerseits wird es nicht in lateinischen, sondern in hebräischen Schriftzeichen notiert, andererseits ist es von zahlreichen Einflüssen aus anderen Sprachfamilien geprägt, wobei die slawischen Sprachen eine besonders bedeutende Rolle spielen (Bihari).
In den slawischen Ländern kam die Sprache der Juden in enge Berührung mit den slawischen Sprachen und somit begann eine direkte, starke Einwirkung dieser Sprachen auf das Jiddische. Aus diesen Sprachen wurden hauptsächlich Wörter des täglichen Gebrauchs übernommen, die sich hauptsächlich auf das tägliche Leben, insbesondere auf Ernährung, Kleidung, Beruf und Familie beziehen. Mehr als ein Zehntel des Gesamtwortschatzes wurde übernommen (Birnbaum).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Internationale Slawismen im Jiddischen
- Abweichendes Genus von Internationalismen
- Abweichendes Genus von Substantiven germanischer Herkunft
- Die Plural von Nomen im Jiddischen
- Andere morphologische Merkmale
- Im Bereich der Syntax
- Doppelte Negation
- Steigerungsformen im Jiddischen
- Flektierte Adjektive
- Wortstellung
- Partizip 2 am Ende des Satzes
- Im Bereich des Wortschatzes
- Die Konjunktion und Partikel „chotsch”
- Die Konjunktion „zi”
- Slawisches „nu” im Jiddischen
- Andere slawische Wörter im Jiddischen
- Pronomen im Jiddischen
- Reflexivpronomen „sich”
- Possessivpronomen „sein”
- Relativpronomen „wos”
- Weglassen des Personalpronomens
- Hybride Formen im Jiddischen
- Deutsch-slawische hybride Formen
- Slawisch-hebräische hybride Formen
- Slawisch-deutsche hybride Formen
- Verben im Jiddischen
- Verben im Plusquamperfekt
- Verben mit ge-, et- Konjugation
- Verben mit „hobn” Konjugation
- Infinitivsätze
- Weglassen des Partizip Perfekts
- Starker Gebrauch reflexiven Formen
- Slawische Verbalpräfixe im Jiddischen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den slawischen Einfluss auf die jiddische Sprache, insbesondere anhand von Texten von I. Bashevis Singer. Die Zielsetzung ist es, die morphologischen, syntaktischen und lexikalischen Spuren slawischer Sprachen im Jiddischen aufzuzeigen und zu analysieren.
- Morphologische Besonderheiten des Jiddischen unter slawischem Einfluss
- Syntaktische Strukturen im Jiddischen mit slawischen Parallelen
- Slawische Lehnwörter und hybride Formen im jiddischen Wortschatz
- Der Einfluss verschiedener slawischer Sprachen (Polnisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Russisch)
- Unterschiede im slawischen Einfluss zwischen West- und Ostjiddisch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Jiddischen und seinen Kontakt zu slawischen Sprachen. Es werden die Quellen des slawischen Einflusses sowie die Bedeutung von I. Bashevis Singer für die Untersuchung herausgestellt. Die folgenden Kapitel untersuchen den slawischen Einfluss in den Bereichen Morphologie (Genus, Pluralbildung, Verbkonjugation), Syntax (Wortstellung, Negation) und Lexik (Lehnwörter, hybride Formen). Es wird auf die unterschiedliche Präsenz slawischer Elemente in West- und Ostjiddisch eingegangen.
Schlüsselwörter
Jiddisch, slawische Sprachen, Morphologie, Syntax, Lexik, Lehnwörter, hybride Formen, I. Bashevis Singer, Ostjiddisch, Westjiddisch, Polnisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Russisch.
- Citation du texte
- Arayik Abgaryan (Auteur), 2023, Der slawische Einfluss im Jiddischen. Eine Analyse anhand der Texte von I. Bashevis Singer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1516242