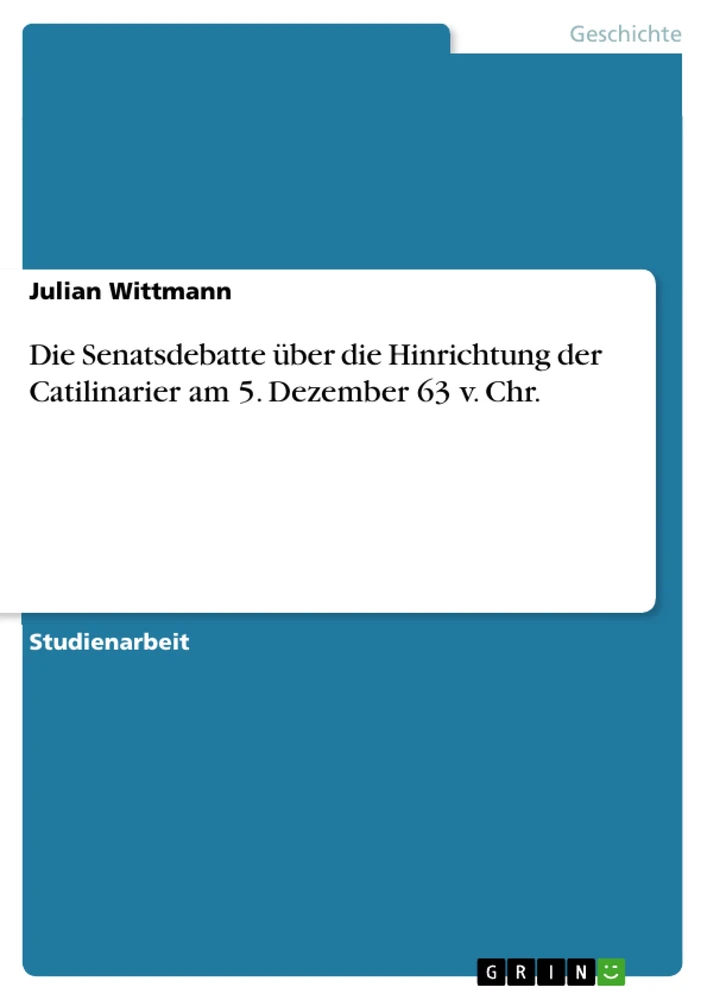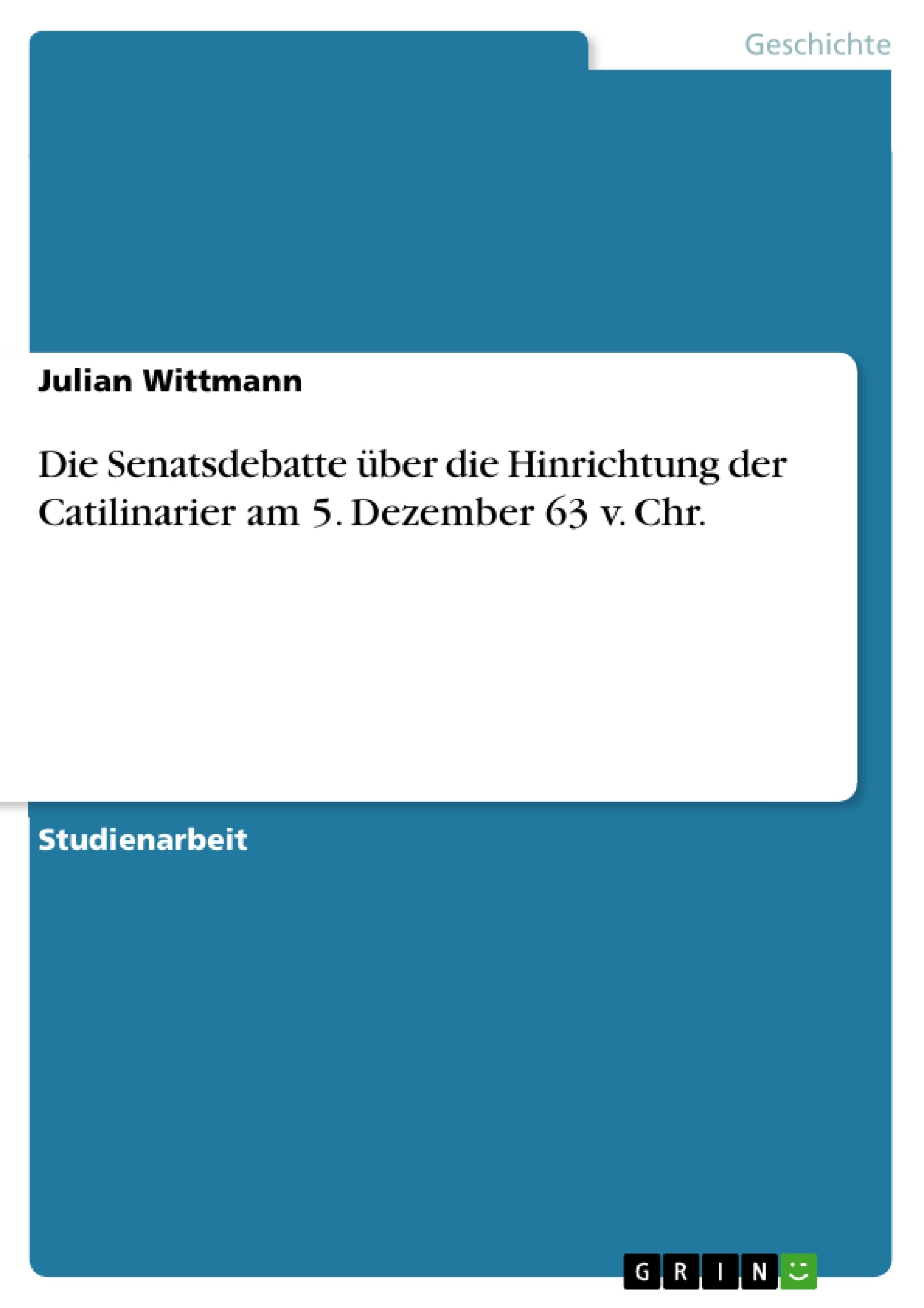Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich speziell mit der Senatssitzung vom 5. Dezember 63 v. Chr. Catilina weilte zum fraglichen Zeitpunkt zwar nicht mehr in Rom, doch einige seiner Gefolgsleute hielten sich noch immer in der Stadt auf, um von dort aus weiter an der Verschwörung zu arbeiten. Nachdem Cicero jene Männer auf frischer Tat ertappen konnte und sie festnehmen ließ, stellte er im Senat an jenem Tag Anfang Dezember die Frage zur Diskussion, was mit ihnen zu geschehen habe. Schließlich wurde darauf entschieden, sie hinzurichten, was dann auch unverzüglich vollzogen wurde.
Im Weiteren soll es nun darum gehen, wieso Cicero die Catilinarier nicht schon unmittelbar nach deren Festnahme mit Berufung auf das Senatus Consultum Ultimum vom 21. Oktober töten ließ. Damit zusammenhängend ist zu betrachten, auf welcher Rechtsgrundlage die Todesurteile vom 5. Dezember beruhen, wenn es nicht das Senatus Consultum Ultimum war und was bezüglich dessen die Bürgerrechte der Angeklagten galten – es stellt sich somit auch die Schuldfrage. Als letzter Punkt interessiert, ob die Hinrichtungen nicht anderen Umständen als dem Verbrechen des Hochverrats geschuldet waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte
- Die Senatssitzung am 5. Dezember 63 v. Chr.
- Die Rede Caesars
- Die Rede Ciceros
- Die Rede Catos
- Rechtliche Grundlagen, Probleme und mögliche Gründe für die Todesstrafe
- Cicero, der Senat und das Senatus Consultum Ultimum
- Die Schuldfrage
- Mögliche Gründe für eine sofortige Hinrichtung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Senatssitzung vom 5. Dezember 63 v. Chr., in welcher über das Schicksal der Catilinarier entschieden wurde. Sie untersucht die Hintergründe der Entscheidung, die rechtlichen Grundlagen der Hinrichtung und die möglichen Gründe für die sofortige Vollstreckung der Todesstrafe. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wieso Cicero die Catilinarier nicht schon nach deren Festnahme mit Berufung auf das Senatus Consultum Ultimum hinrichten ließ.
- Die Senatsdebatte vom 5. Dezember 63 v. Chr.
- Die rechtlichen Grundlagen der Hinrichtung der Catilinarier
- Die Rolle des Senatus Consultum Ultimum
- Die Schuldfrage und die Bürgerrechte der Angeklagten
- Mögliche Gründe für die Hinrichtung der Catilinarier
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Catilinarische Verschwörung als eines der am besten dokumentierten Ereignisse der späten römischen Republik vor und beleuchtet die Quellenlage, insbesondere die Reden Ciceros und die Werke Sallusts.
Das Kapitel „Vorgeschichte“ schildert die Ereignisse vor der Senatssitzung vom 5. Dezember, wobei die Bedeutung des Senatus Consultum Ultimum und die Festnahme der Catilinarier durch Cicero im Vordergrund stehen.
Das Kapitel „Die Senatssitzung am 5. Dezember 63 v. Chr.“ beschreibt die Reden von Caesar, Cicero und Cato und analysiert deren Argumentation.
Das Kapitel „Rechtliche Grundlagen, Probleme und mögliche Gründe für die Todesstrafe“ befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Hinrichtung, der Schuldfrage und möglichen Motiven für die Entscheidung des Senats.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Senatsdebatte, Catilinarische Verschwörung, Todesstrafe, Senatus Consultum Ultimum, Bürgerrechte, Rechtliche Grundlagen, Schuldfrage, politische Motive und historische Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Catilinarische Verschwörung?
Ein Umsturzversuch von Lucius Sergius Catilina im Jahr 63 v. Chr. gegen die Römische Republik, der von Konsul Cicero aufgedeckt wurde.
Warum war die Senatssitzung am 5. Dezember 63 v. Chr. so wichtig?
An diesem Tag debattierte der Senat über das Schicksal der festgenommenen Verschwörer, insbesondere über die Frage der Todesstrafe ohne ordentliches Gerichtsverfahren.
Welche Position vertrat Caesar in der Debatte?
Caesar sprach sich gegen die Hinrichtung aus und plädierte stattdessen für lebenslange Haft und Konfiszierung des Vermögens, um das Gesetz nicht zu brechen.
Was ist das "Senatus Consultum Ultimum"?
Es war ein Notstandsbeschluss des Senats, der den Konsuln weitreichende Vollmachten zur Rettung des Staates gab, dessen rechtliche Tragweite für Hinrichtungen jedoch umstritten war.
Warum ließ Cicero die Verschwörer sofort hinrichten?
Cicero argumentierte, die Männer seien durch ihr Handeln zu Staatsfeinden (hostes) geworden und hätten damit ihre Bürgerrechte verwirkt.
- Citar trabajo
- Julian Wittmann (Autor), 2010, Die Senatsdebatte über die Hinrichtung der Catilinarier am 5. Dezember 63 v. Chr., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151625