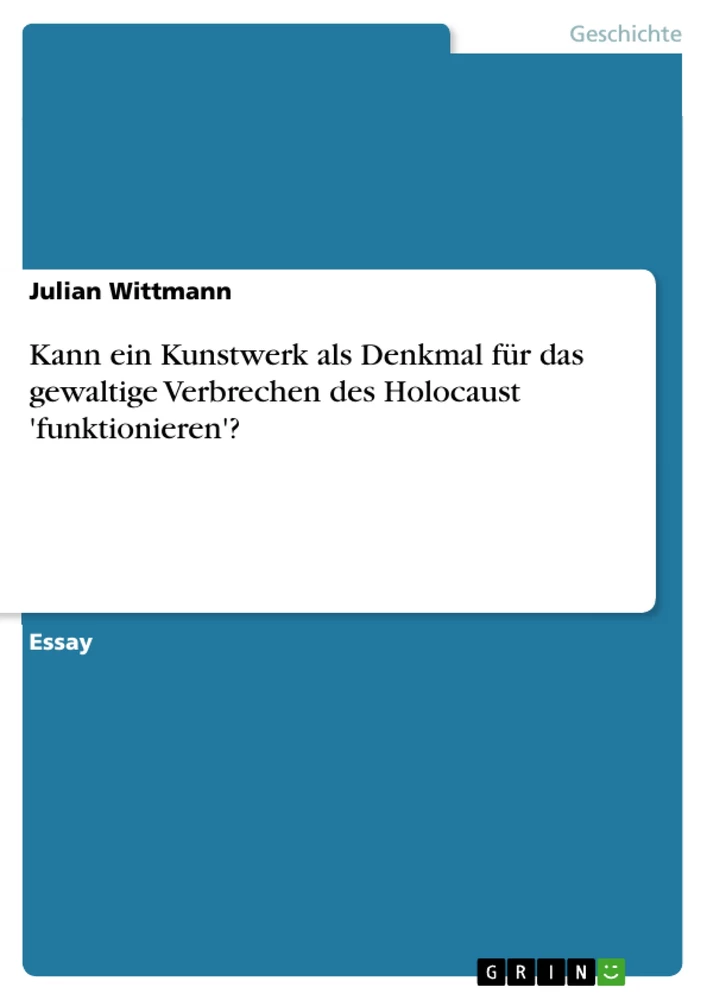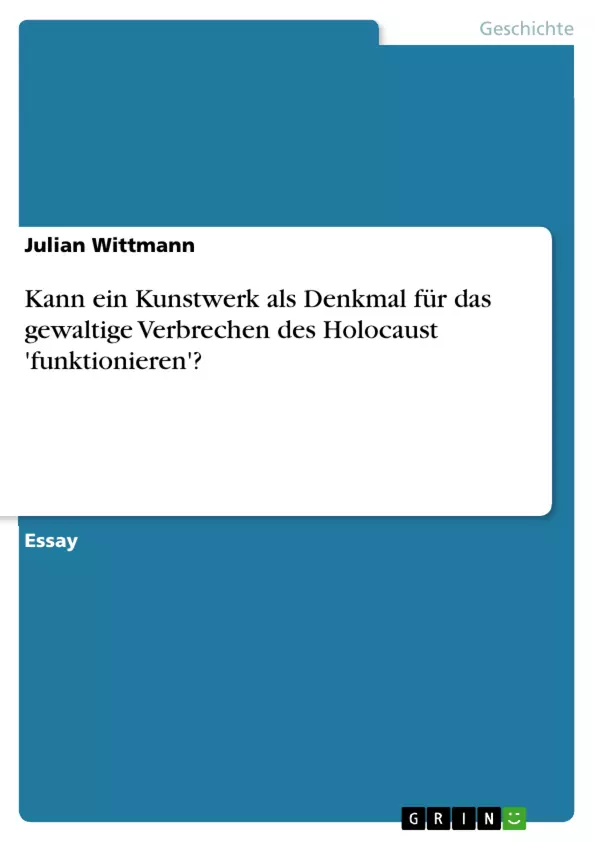Am 10. Mai 2005 wurde das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, auch unter dem Namen Holocaust-Mahnmal bekannt, vom damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse in einer feierlichen Veranstaltung eingeweiht. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten knapp 17 Jahre vergehen. Jener Zeitraum war geprägt von zahlreichen Diskussionen, Skandalen und Kontroversen um Notwendigkeit, Nutzen, Gestaltung und Bau des Denkmals. Dies allein, so mancher Kommentar, habe Deutschland und der deutschen Gesellschaft mehr gebracht als die letztendliche Errichtung. Gemeint ist hier die Bewusstwerdung von Standpunkten eines Einzelnen im Bezug auf das grausame Erbe, welches wir als Deutsche von unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern verantwortet bekommen haben. Gerade die ''Walser-Bubis-Debatte'' erregte, auch international, ein enormes Aufsehen, was ohne ein zu errichtendes Holocaust-Mahnmal nicht zustande gekommen wäre. Doch es sollte nicht soweit gegangen werden und das Denkmal als vielleicht sogar überflüssig zu bezeichnen, denn das ist es in keiner Weise.
Im Folgenden soll die Berichterstattung der größten und wichtigsten Berliner Tageszeitungen um die Eröffnung des Denkmals herum betrachtet werden – Der Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Berliner Morgenpost, Berliner Kurier und B.Z. – , um eine mögliche innerstädtische Debatte herauszustellen. Wie reflektierten die Kommentatoren die Einweihung und welche Kritik wurde genannt? Wie haben die Menschen nach der Übergabe an die Öffentlichkeit das Denkmal angenommen und wie sind sie ihm begegnet? Mit welchen Erwartungen gehen die Menschen zu und in dieses Denkmal und können diese Erwartungen überhaupt befriedigt werden? Ist es möglicherweise überhaupt sinnvoll, solch ein Mahnmal so zu gestalten, dass es Ansprüche und Erwartungen mit Leichtigkeit und auf den ersten Blick erfüllt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Einweihung des Denkmals
- Reaktionen auf das Denkmal
- Wolfgang Thierse
- Paul Spiegel
- Nachum Flug
- Berliner Presse
- Reaktionen der Berliner Bevölkerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die öffentliche Reaktion auf die Einweihung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin im Jahr 2005. Sie analysiert die Berichterstattung der Berliner Presse sowie die Stellungnahmen wichtiger Persönlichkeiten und die öffentliche Meinung, um die Bedeutung und Wirkung des Denkmals zu beleuchten.
- Die öffentliche Debatte um das Holocaust-Mahnmal vor und nach seiner Einweihung
- Die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen des Denkmals
- Die Rolle der Medien in der Gestaltung des öffentlichen Diskurses
- Die Bedeutung des Denkmals als Ort der Erinnerung und des Gedenkens
- Die Frage nach der Angemessenheit der Gestaltung des Denkmals
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den historischen Kontext der Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Sie benennt die zentralen Fragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden, darunter die öffentliche Wahrnehmung und die mediale Berichterstattung um die Einweihung des Denkmals. Die "Walser-Bubis-Debatte" wird als ein Beispiel für die vorangegangene kontroverse Diskussion um das Denkmal genannt, welche die Notwendigkeit eines solchen Denkmals hervorhob und die breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Holocaust unterstrich. Der Fokus liegt auf der Analyse der Berliner Presseberichterstattung und der Reaktionen der Bevölkerung.
Die Einweihung des Denkmals: Dieses Kapitel beschreibt die feierliche Einweihung des Denkmals am 10. Mai 2005 durch Wolfgang Thierse. Es wird detailliert auf die Reden von Thierse und Paul Spiegel eingegangen, wobei die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen des Denkmals hervorgehoben werden. Thierses Rede betont die Schwierigkeit, das Unfassbare des Holocaust künstlerisch darzustellen, während Spiegel sowohl Lob als auch Kritik ausspricht und die fehlende Konfrontation mit Schuld und Verantwortung bemängelt. Die Einweihungszeremonie wird als wichtiger Moment der deutschen Geschichtsbewältigung dargestellt, der jedoch gleichzeitig auch kontrovers diskutiert wurde.
Reaktionen auf das Denkmal: Dieses Kapitel analysiert die Reaktionen auf das Denkmal aus verschiedenen Perspektiven. Es werden die Meinungen von Wolfgang Thierse, Paul Spiegel und Nachum Flug gegenübergestellt, die unterschiedliche Bewertungen des Denkmals vertreten. Weiterhin wird die Berichterstattung der Berliner Presse – vom Tagesspiegel über die Berliner Zeitung bis zur B.Z. – untersucht, wobei sowohl positive als auch kritische Stimmen berücksichtigt werden. Die Bandbreite der Reaktionen verdeutlicht die vielschichtige und kontroverse Wahrnehmung des Denkmals in der Öffentlichkeit.
Reaktionen der Berliner Bevölkerung: Abschließend wird die Reaktion der Berliner Bevölkerung auf das Denkmal beleuchtet. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa wird herangezogen, um das Interesse der Berliner am Besuch des Mahnmals zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen ein differenziertes Bild mit sowohl positivem Interesse als auch Ablehnung. Es wird darauf hingewiesen, dass das Interesse bei jungen Menschen größer ist als bei älteren. Diese Ergebnisse werden im Kontext der Gesamtdiskussion um das Denkmal eingeordnet und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die deutsche Erinnerungskultur reflektiert.
Schlüsselwörter
Holocaust-Mahnmal, Erinnerungskultur, öffentliche Meinung, Medienberichterstattung, Geschichtsbewältigung, Berlin, Wolfgang Thierse, Paul Spiegel, Kontroverse, Kunstwerk als Denkmal, authentische Orte, deutsche Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Öffentliche Reaktion auf die Einweihung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert die öffentliche Reaktion auf die Einweihung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin im Jahr 2005. Es untersucht die Berichterstattung der Berliner Presse, Stellungnahmen wichtiger Persönlichkeiten und die öffentliche Meinung, um die Bedeutung und Wirkung des Denkmals zu beleuchten.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die öffentliche Debatte um das Holocaust-Mahnmal, die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen des Denkmals, die Rolle der Medien, die Bedeutung des Denkmals als Ort der Erinnerung, die Frage nach der Angemessenheit der Gestaltung und die Reaktionen der Berliner Bevölkerung.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Einweihung des Denkmals, ein Kapitel zu den Reaktionen auf das Denkmal (inkl. Meinungen von Thierse, Spiegel, Flug und der Berliner Presse) und ein Kapitel zu den Reaktionen der Berliner Bevölkerung (inkl. einer Forsa-Umfrage).
Wer wird im Dokument zitiert?
Das Dokument zitiert insbesondere Wolfgang Thierse, Paul Spiegel und Nachum Flug hinsichtlich ihrer Meinungen und Interpretationen des Denkmals. Die Berichterstattung verschiedener Berliner Zeitungen (Tagesspiegel, Berliner Zeitung, B.Z.) wird ebenfalls analysiert.
Welche Methoden werden zur Analyse verwendet?
Das Dokument analysiert die Reden der Einweihungszeremonie, die Berichterstattung der Berliner Presse und bezieht die Ergebnisse einer Meinungsforschungsstudie (Forsa) zur öffentlichen Meinung in Berlin mit ein.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Dokument zeigt die vielschichtige und kontroverse Wahrnehmung des Denkmals in der Öffentlichkeit auf. Es beleuchtet unterschiedliche Interpretationen und Reaktionen, die sowohl positive als auch kritische Bewertungen des Denkmals umfassen. Die Analyse der öffentlichen Meinung und der Medienberichterstattung verdeutlicht die Bedeutung des Denkmals für die deutsche Erinnerungskultur und die anhaltende Auseinandersetzung mit dem Holocaust.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Holocaust-Mahnmal, Erinnerungskultur, öffentliche Meinung, Medienberichterstattung, Geschichtsbewältigung, Berlin, Wolfgang Thierse, Paul Spiegel, Kontroverse, Kunstwerk als Denkmal, authentische Orte, deutsche Gesellschaft.
Für wen ist dieses Dokument bestimmt?
Das Dokument ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit dem Holocaust-Mahnmal und der deutschen Erinnerungskultur.
- Citation du texte
- Julian Wittmann (Auteur), 2009, Kann ein Kunstwerk als Denkmal für das gewaltige Verbrechen des Holocaust 'funktionieren'?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151632