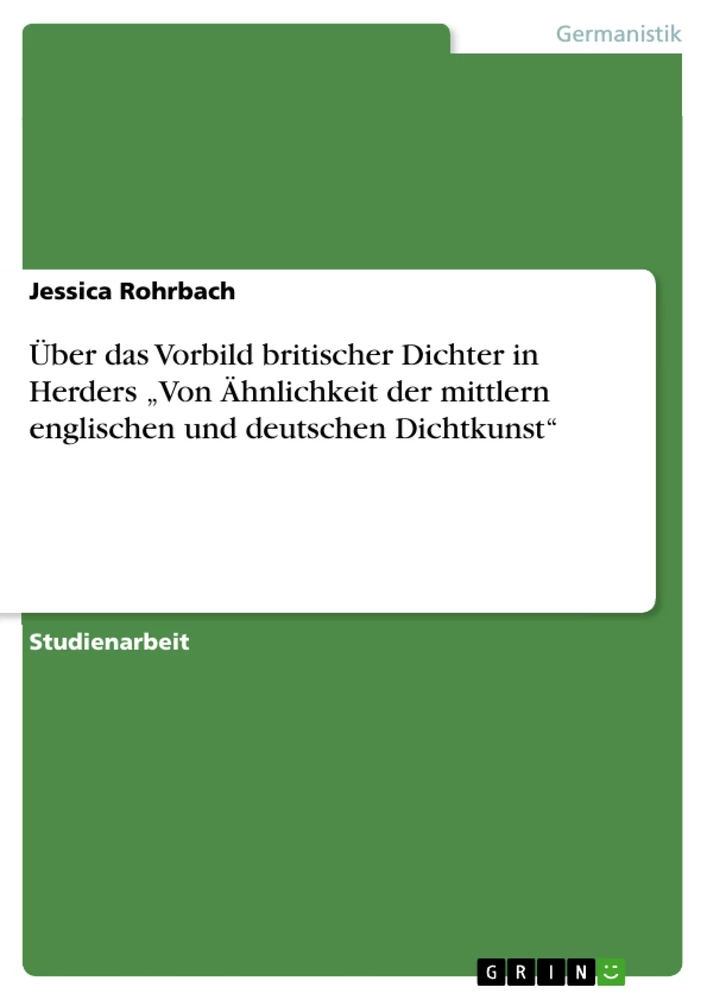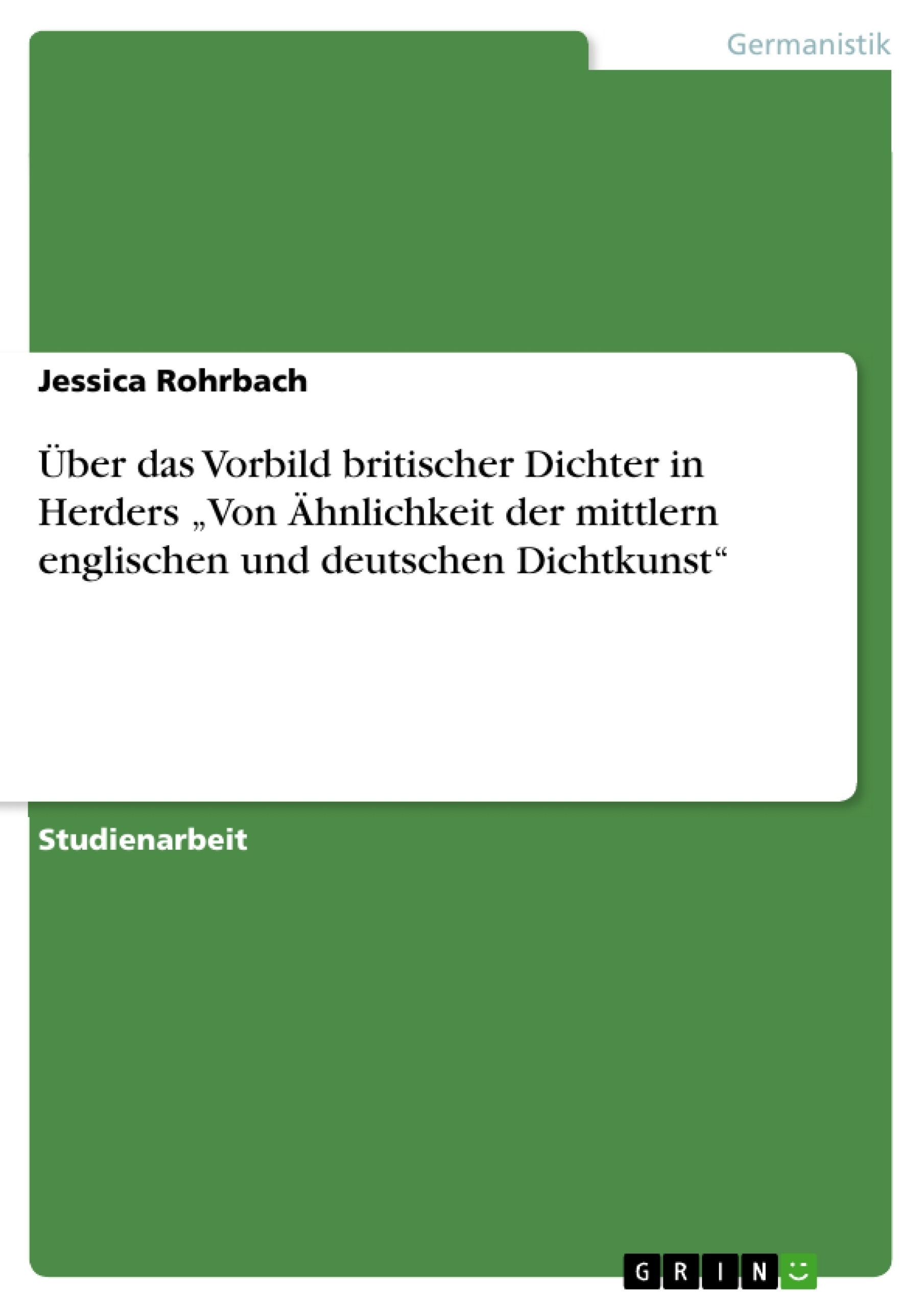Johann Gottfried Herder hat in seinem Aufsatz „Von Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst, nebst Verschiednem, das daraus folget.“ ein umfassendes Bild von der gemeinsamen Entstehung deutscher und englischer Sprache und Literatur gezeichnet und ausdrückliche Kritik an der Entwicklung der deutschen Dichtkunst geübt.
Er bemängelt die fehlende Nationalität in der deutschen Dichtung und vergleicht diese mit der englischen, die er den Deutschen als Vorbild voranstellt: „Wie wär uns Deutschen das Studium dieser Sprache, Literatur und Poesie nützlich! – (…) Wie weit stehen wir, in Anlässen der Art, den Engländern nach!“
In dieser Arbeit soll nun erläutert werden, wie genau dieses britische Vorbild aussieht. Zuerst will ich, wie Herder in seinem Aufsatz, bei den Anfängen der deutschen und englischen Sprache und Literatur beginnen, deren Gemeinsamkeiten aufzeigen, sowie ihre unterschiedliche Entwicklung darstellen. Im zweiten Schritt soll Herders Kritik an der deutschen Dichtkunst sowie die Gegenüberstellung zur von ihm hoch gelobten englischen Dichtung herausgearbeitet werden. Der letzte Teil dieser Arbeit ist Herders Lösungsvorschlag zum Problem der mangelnden Nationalität in der deutschen Literatur gewidmet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Verwandtschaft deutscher und englischer Sprache und Literatur
- Kritik an der deutschen Dichtung
- Lob der englischen Dichtkunst und Abgrenzung zur französischen
- Die Vorbildfunktion der Briten nach Herder
- Abgrenzung zur französischen Dichtkunst
- Herders Entwurf einer zukünftigen deutschen Dichtkunst
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Johann Gottfried Herders Aufsatz „Von Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst, nebst Verschiednem, das daraus folget.“ Ziel ist es, Herders Vorstellung vom britischen Vorbild für die deutsche Dichtung zu erläutern. Dabei werden seine Argumentationslinien nachvollzogen und analysiert.
- Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung der deutschen und englischen Sprache und Literatur.
- Herders Kritik an der mangelnden Nationalität in der deutschen Dichtung.
- Das positive Beispiel der englischen Dichtkunst und deren Abgrenzung zur französischen Dichtkunst.
- Herders Entwurf einer zukünftigen, national geprägten deutschen Dichtkunst.
- Die Bedeutung des „Volks“ und der „Volksmeinung“ für Herders Dichtungstheorie.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in Herders Aufsatz „Von Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst, nebst Verschiednem, das daraus folget.“ ein und beschreibt dessen zentrale These: Herder sieht in der englischen Dichtkunst ein Vorbild für die deutsche, da diese stärker im Volk verwurzelt ist und nationale Eigenheiten widerspiegelt, im Gegensatz zur seiner Meinung nach künstlichen und von ausländischen Einflüssen geprägten deutschen Dichtung. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an, indem sie die historische Entwicklung der Sprachen und Literaturen, Herders Kritik an der deutschen und sein Lob der englischen Dichtung sowie seinen Lösungsvorschlag für die deutsche Literatur skizziert.
Die Verwandtschaft deutscher und englischer Sprache und Literatur: Herder beginnt mit der Darstellung der germanischen Einflüsse auf die englische Sprache und Literatur, beginnend bei den Angelsachsen. Er betont die Ähnlichkeiten zwischen beiden Literaturen in Stilmitteln, Motiven und Denkweisen und legt damit die Grundlage für seinen Vergleich und die Behauptung eines gemeinsamen Ursprungs. Seine historischen Ausführungen sind jedoch teilweise ungenau, besonders im Hinblick auf die Normannen und die Bezeichnung der Briten. Trotz dieser Ungenauigkeiten untermauert er seine These von der verwandtschaftlichen Beziehung zwischen deutscher und englischer Sprache und Literatur, was als Ausgangspunkt für den Vergleich der jeweiligen Dichtkunst dient.
Kritik an der deutschen Dichtung: Herder kritisiert die mangelnde Nationalität der deutschen Dichtung. Für ihn bedeutet nationale Dichtung, dass sie sich aus dem Glauben und Geschmack des Volkes, aus Resten alter Zeiten gebildet hat. Die deutsche Dichtung hingegen sieht er als von humanistischen Gelehrten geschaffen und vom Volk losgelöst. Sie orientiert sich an französischen Vorbildern und ignoriert die „Stimme des Volks“. Herder kritisiert die Literaturreform des 17. Jahrhunderts, die seiner Ansicht nach die letzten Züge von Nationalgeist in der deutschen Literatur zerstört hat. Seine Kritik zielt auf die mangelnde Verankerung der deutschen Dichtung im Volk und ihre Abhängigkeit von ausländischen Einflüssen.
Lob der englischen Dichtkunst und Abgrenzung zur französischen: Herder lobt die englische Dichtung als Vorbild für die deutsche, da sie auf Volksmeinungen und Sagen aufbaut und nationale Elemente integriert. Er nennt zahlreiche bedeutende britische Dichter als Beispiele. Im Gegensatz dazu sieht er die französische Dichtkunst als künstlich und oberflächlich, als "klassische Luftblase", an. Die englische Dichtung wird als authentisch und organisch dargestellt, die deutsche und französische als künstlich und an den Bedürfnissen des Volkes vorbei.
Schlüsselwörter
Johann Gottfried Herder, Englische Dichtkunst, Deutsche Dichtkunst, Nationalität, Volksdichtung, Französische Dichtkunst, Vorbildfunktion, Literaturvergleich, Sprachverwandtschaft, Germanische Einflüsse.
Häufig gestellte Fragen zu Herders Aufsatz "Von Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst"
Was ist der zentrale Gegenstand von Herders Aufsatz?
Herders Aufsatz vergleicht die englische und deutsche Dichtkunst und argumentiert, dass die englische Dichtkunst aufgrund ihrer stärkeren Verwurzelung im Volk und der Integration nationaler Eigenheiten ein Vorbild für die deutsche Dichtung darstellt. Der Aufsatz untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung beider Literaturen und kritisiert die mangelnde Nationalität der deutschen Dichtung.
Welche Methode wendet Herder in seinem Aufsatz an?
Herder verfolgt einen vergleichenden Ansatz, indem er die historische Entwicklung der englischen und deutschen Sprache und Literatur untersucht. Er analysiert die Stärken und Schwächen beider Literaturen, wobei er die englische Dichtkunst lobt und die deutsche kritisiert. Seine Argumentation stützt sich auf historische Ausführungen, stilistische Vergleiche und die Bewertung der jeweiligen Verankerung im Volk.
Welche Kritik übt Herder an der deutschen Dichtung?
Herder kritisiert die mangelnde Nationalität der deutschen Dichtung. Er sieht sie als von humanistischen Gelehrten geschaffen und vom Volk losgelöst an, beeinflusst von französischen Vorbildern und ohne Bezug zur "Stimme des Volkes". Die Literaturreform des 17. Jahrhunderts wird als Zerstörung des letzten Nationalgeistes in der deutschen Literatur dargestellt.
Warum sieht Herder die englische Dichtkunst als Vorbild?
Herder lobt die englische Dichtkunst, weil sie auf Volksmeinungen und Sagen basiert und nationale Elemente integriert. Im Gegensatz zur künstlichen und oberflächlichen französischen Dichtkunst betrachtet er die englische als authentisch und organisch, eng verbunden mit dem Volk und seinen Traditionen.
Welche Rolle spielt das "Volks" in Herders Argumentation?
Das "Volks" und die "Volksmeinung" sind zentral für Herders Dichtungstheorie. Er argumentiert, dass eine authentische nationale Dichtung aus dem Glauben und Geschmack des Volkes entstehen muss und die Traditionen und Sagen des Volkes widerspiegeln sollte. Die Abkehr vom Volk in der deutschen Dichtung wird als Hauptgrund für deren Mängel gesehen.
Wie ist der Aufsatz strukturiert?
Der Aufsatz gliedert sich in eine Einleitung, die die zentrale These vorstellt, Kapitel zur Verwandtschaft deutscher und englischer Sprache und Literatur, zur Kritik an der deutschen und zum Lob der englischen Dichtkunst sowie eine Schlussbetrachtung. Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf und entwickeln Herders Argumentation schrittweise.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Aufsatz?
Schlüsselwörter sind: Johann Gottfried Herder, Englische Dichtkunst, Deutsche Dichtkunst, Nationalität, Volksdichtung, Französische Dichtkunst, Vorbildfunktion, Literaturvergleich, Sprachverwandtschaft, Germanische Einflüsse.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet der Text?
Der Text bietet eine Kapitelzusammenfassung, welche die Argumentationslinie jedes Kapitels kurz beschreibt. Die Einleitung präsentiert die These, die folgenden Kapitel entwickeln diese These anhand von Literaturvergleichen und Kritik an der deutschen Dichtung, um schließlich in der Schlussbetrachtung zu einem Fazit zu gelangen.
- Quote paper
- Jessica Rohrbach (Author), 2006, Über das Vorbild britischer Dichter in Herders „Von Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151633