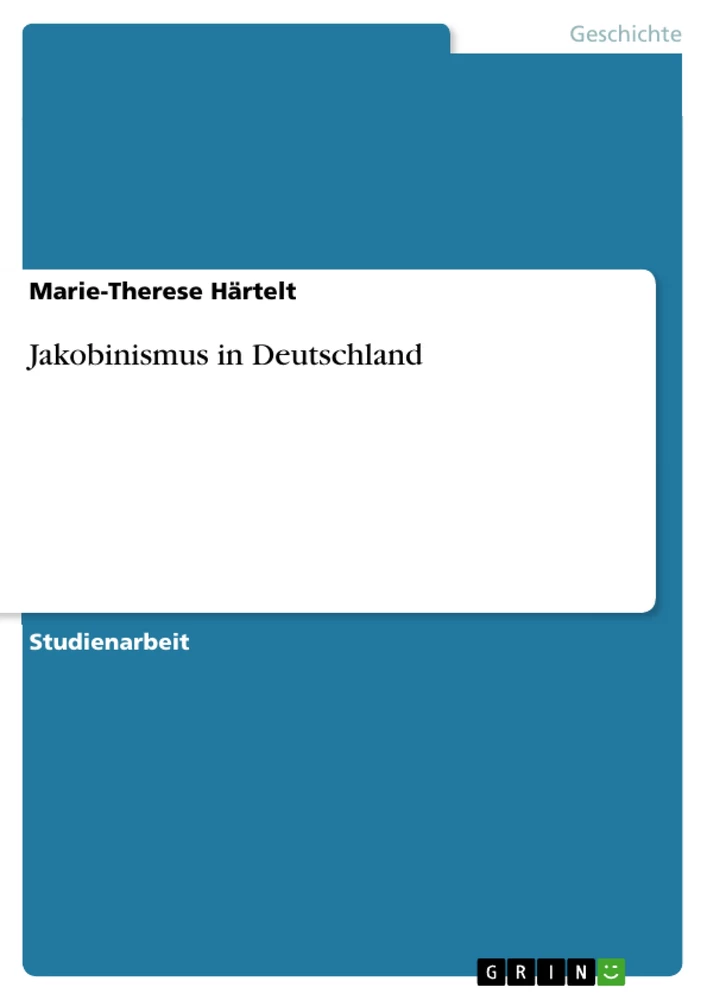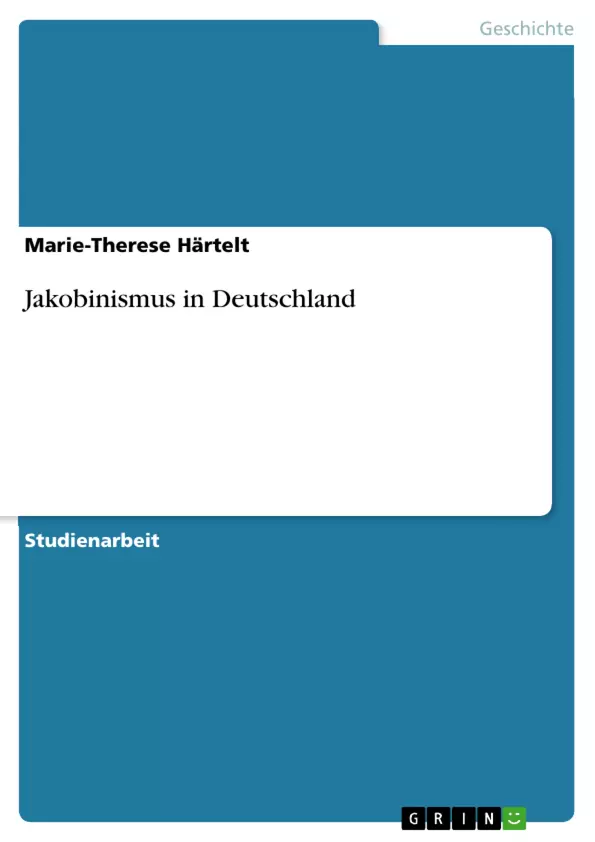Eines der bedeutungsvollsten Ereignisse des 18. Jahrhunderts war die Französische Revolution. Begründet lag diese Bedeutung in deren Auswirkungen über Frankreichs Grenzen hinweg, denn europaweit nahmen sich die mittleren und unteren Schichten die Franzosen zum Vorbild um für die Freiheit zu kämpfen und die zentralistische Herrschaft zu besiegen. Bauern, Handwerker, Beamte und Ärzte forderten nun von den vorher bestimmendem Adel und Klerus mehr Rechte und Freiheiten, sodass neue Gesellschaftsformen in ganz Europa entstehen konnten. Beschäftigt man sich mit der Revolution und ihren Ausläufern, stößt man immer wieder auf den Begriff der Jakobiner. Er bezeichnet die Mitglieder des französischen Clubs, die sich zu den drei populären Idealen der Revolution bekannten und eine republikanische Staatsform anstrebten. Diese politische Strömung kam auch auf deutschen Boden und blieb ebenso hier nicht bedeutungslos. In der Geschichtswissenschaft war das Werden und Wirken der deutschen Jakobiner in den 1790er Jahren ein kaum beachtetes Thema. Erst in den 1950er Jahren wurde es in der DDR und einige Zeit später auch in der BRD aufgegriffen. Bis heute sind die Pioniere der deutschen Jakobinerforschung Heinrich Scheel und Walter Grab, deren Veröffentlichungen auch in dieser Hausarbeit beachtet werden, da man bei der Analyse des Phänomens der Deutschen Jakobiner an diesen Forschern nicht vorbei kommt. Untersuchungsgegenstand dieser Hausarbeit wird deshalb die Entwicklung, sowie das Wirken der Jakobiner in Deutschland. Zusätzlich soll beschrieben werden, worin der Unterschied zwischen deutschen und französischen Jakobinern bestand. Dabei soll insbesondere geklärt werden, warum die deutschen Jakobiner erfolglos blieben und ihre Ziele nie verwirklichen konnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Verbreitung des Jakobinismus in Deutschland
- 3. Die Organisationsformen der deutschen Jakobiner
- 3.1 Die Lesegesellschaften
- 3.2 Die Jakobinerclubs
- 3.3 Die Konstitutionellen Zirkel
- 4. Der Vergleich mit Frankreich
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und das Wirken der Jakobiner in Deutschland im 18. Jahrhundert und vergleicht sie mit ihren französischen Pendants. Das Hauptziel ist es, die Gründe für das Scheitern der deutschen Jakobinerbewegung zu ergründen und einen Überblick über die wichtigsten historischen Fakten zu liefern. Die Arbeit konzentriert sich auf eine umfassende Darstellung der Entwicklung, der Organisationsformen und des letztendlichen Scheiterns der Bewegung.
- Die Verbreitung des Jakobinismus in Deutschland
- Die Organisationsformen der deutschen Jakobiner (Lesegesellschaften, Clubs, konstitutionelle Zirkel)
- Der Vergleich zwischen deutschen und französischen Jakobinern
- Die Gründe für das Scheitern der deutschen Jakobinerbewegung
- Die Rolle des Bürgertums und der Unterschichten in der Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Französische Revolution als bedeutendes Ereignis des 18. Jahrhunderts und deren europaweite Auswirkungen. Sie führt den Begriff der Jakobiner ein und betont die bisherige geringe Beachtung der deutschen Jakobiner in der Geschichtswissenschaft. Die Arbeit fokussiert sich auf die Entwicklung und das Wirken der deutschen Jakobiner, den Vergleich mit Frankreich und die Ursachen ihres Scheiterns. Sie versteht sich als Überblicksdarstellung, die die wichtigsten historischen Fakten in diesem Zusammenhang darstellt und gliedert sich in drei Kapitel.
2. Die Verbreitung des Jakobinismus in Deutschland: Dieses Kapitel untersucht die Ausbreitung jakobinischer Ideen in Deutschland im Kontext des ersten Koalitionskriegs. Es differenziert zwischen Konservativen, Liberalen und den radikalen Jakobinern, die die Revolution und ihre Radikalisierung von 1792 unterstützten. Die wissenschaftliche Unterscheidung der deutschen Jakobiner in drei Gruppen wird erläutert: bürgerliche Aufklärer, spontane Protestbewegungen der Unterschichten und die konstitutionellen Clubs im besetzten Rheinland (Neojakobinismus). Das Kapitel zeigt, wie unterschiedliche soziale Schichten und Bewegungen zum Jakobinismus beitrugen, jedoch mit unterschiedlichen Zielen und Vorgehensweisen.
3. Die Organisationsformen der deutschen Jakobiner: Das Kapitel analysiert die Organisationsstrukturen der deutschen Jakobiner, die sich oft aus Vorläuferorganisationen wie Lesegesellschaften oder Freimaurerbünden entwickelten. Es wird hervorgehoben, dass die Mitglieder überwiegend aus der gebildeten Schicht stammten und dass die günstigen Rahmenbedingungen in bestimmten Regionen (Hamburg, Altona, Süddeutschland, linksrheinisches Gebiet) zur Entstehung von Klubs beitrugen. Die Zusammensetzung der Jakobiner (Ärzte, Erzieher, Lehrer, Geistliche etc.) und ihre Fähigkeit zur rhetorischen Mobilisierung werden diskutiert. Das Kapitel beleuchtet auch die Schwierigkeiten der Jakobiner, sich aufgrund der staatlichen Überwachung und der Zensur zu artikulieren und ihre Ideen zu verbreiten. Es wird deutlich, dass die Abhängigkeit von den jeweiligen Obrigkeiten und die damit verbundenen Repressalien die Aktivitäten der Jakobiner stark einschränkten.
Schlüsselwörter
Jakobinismus, Französische Revolution, Deutschland, Revolutionäre Bewegungen, Organisationsformen, Bürgertum, Unterschichten, Koalitionskriege, Scheitern der Revolution, Vergleich Frankreich, Lesegesellschaften, Jakobinerclubs, Konstitutionelle Zirkel, Neojakobinismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Die deutschen Jakobiner"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und dem Wirken der Jakobiner in Deutschland während des 18. Jahrhunderts. Sie untersucht deren Organisationsformen, vergleicht sie mit den französischen Jakobinern und analysiert die Gründe für das Scheitern der deutschen Jakobinerbewegung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Verbreitung des Jakobinismus in Deutschland, die verschiedenen Organisationsformen der deutschen Jakobiner (Lesegesellschaften, Clubs, konstitutionelle Zirkel), einen Vergleich zwischen deutschen und französischen Jakobinern, die Ursachen für das Scheitern der deutschen Jakobinerbewegung und die Rolle des Bürgertums und der Unterschichten in dieser Bewegung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Die Verbreitung des Jakobinismus in Deutschland, Die Organisationsformen der deutschen Jakobiner, Der Vergleich mit Frankreich und Schluss. Kapitel 3 ist weiter unterteilt in Unterkapitel zu Lesegesellschaften, Jakobinerclubs und Konstitutionellen Zirkeln.
Wie wird der Jakobinismus in Deutschland dargestellt?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Gruppen: bürgerliche Aufklärer, spontane Protestbewegungen der Unterschichten und die konstitutionellen Clubs im besetzten Rheinland (Neojakobinismus). Sie zeigt, wie unterschiedliche soziale Schichten mit verschiedenen Zielen und Vorgehensweisen zum Jakobinismus beitrugen.
Welche Rolle spielten die Organisationsformen der deutschen Jakobiner?
Die Arbeit analysiert die Organisationsstrukturen der deutschen Jakobiner, die oft aus Vorläuferorganisationen wie Lesegesellschaften oder Freimaurerbünden entstanden. Es wird die Zusammensetzung der Mitglieder (Ärzte, Erzieher, Lehrer, Geistliche etc.) und ihre rhetorischen Fähigkeiten beleuchtet, sowie die Schwierigkeiten aufgrund staatlicher Überwachung und Zensur.
Warum scheiterte die deutsche Jakobinerbewegung?
Die Arbeit untersucht die Gründe für das Scheitern der deutschen Jakobinerbewegung. Ein wichtiger Aspekt sind die staatlichen Repressalien und die Abhängigkeit von den jeweiligen Obrigkeiten, welche die Aktivitäten der Jakobiner stark einschränkten.
Wie werden deutsche und französische Jakobiner verglichen?
Die Arbeit vergleicht die deutsche Jakobinerbewegung explizit mit ihrer französischen Entsprechung, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die spezifischen Bedingungen in Deutschland zu beleuchten, die zum Scheitern der Bewegung führten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jakobinismus, Französische Revolution, Deutschland, Revolutionäre Bewegungen, Organisationsformen, Bürgertum, Unterschichten, Koalitionskriege, Scheitern der Revolution, Vergleich Frankreich, Lesegesellschaften, Jakobinerclubs, Konstitutionelle Zirkel, Neojakobinismus.
- Arbeit zitieren
- Marie-Therese Härtelt (Autor:in), 2009, Jakobinismus in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151652