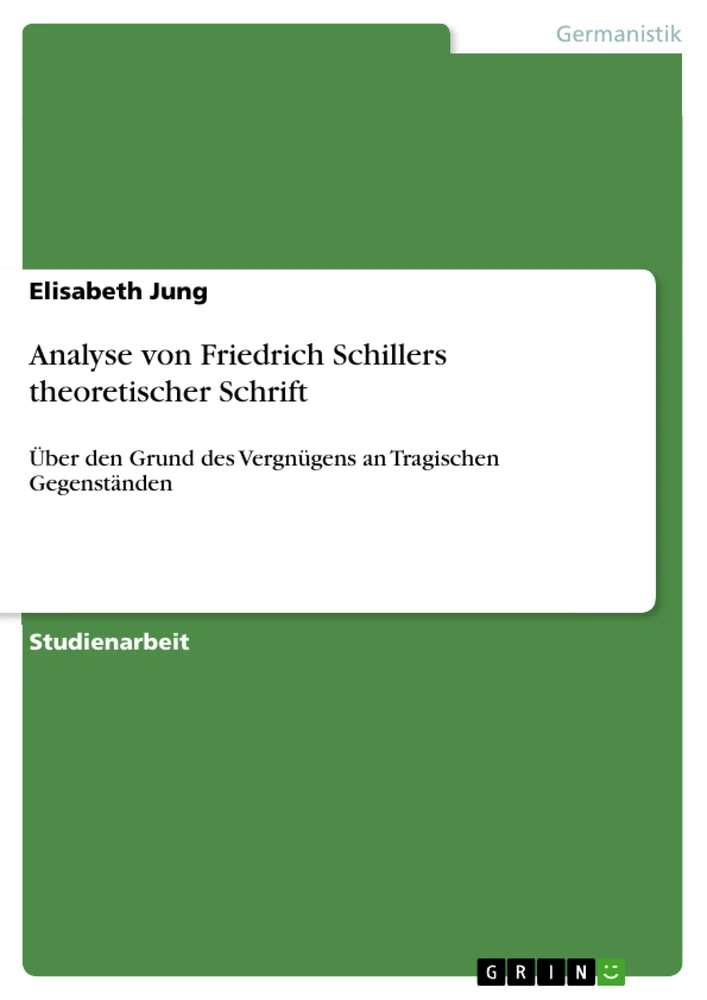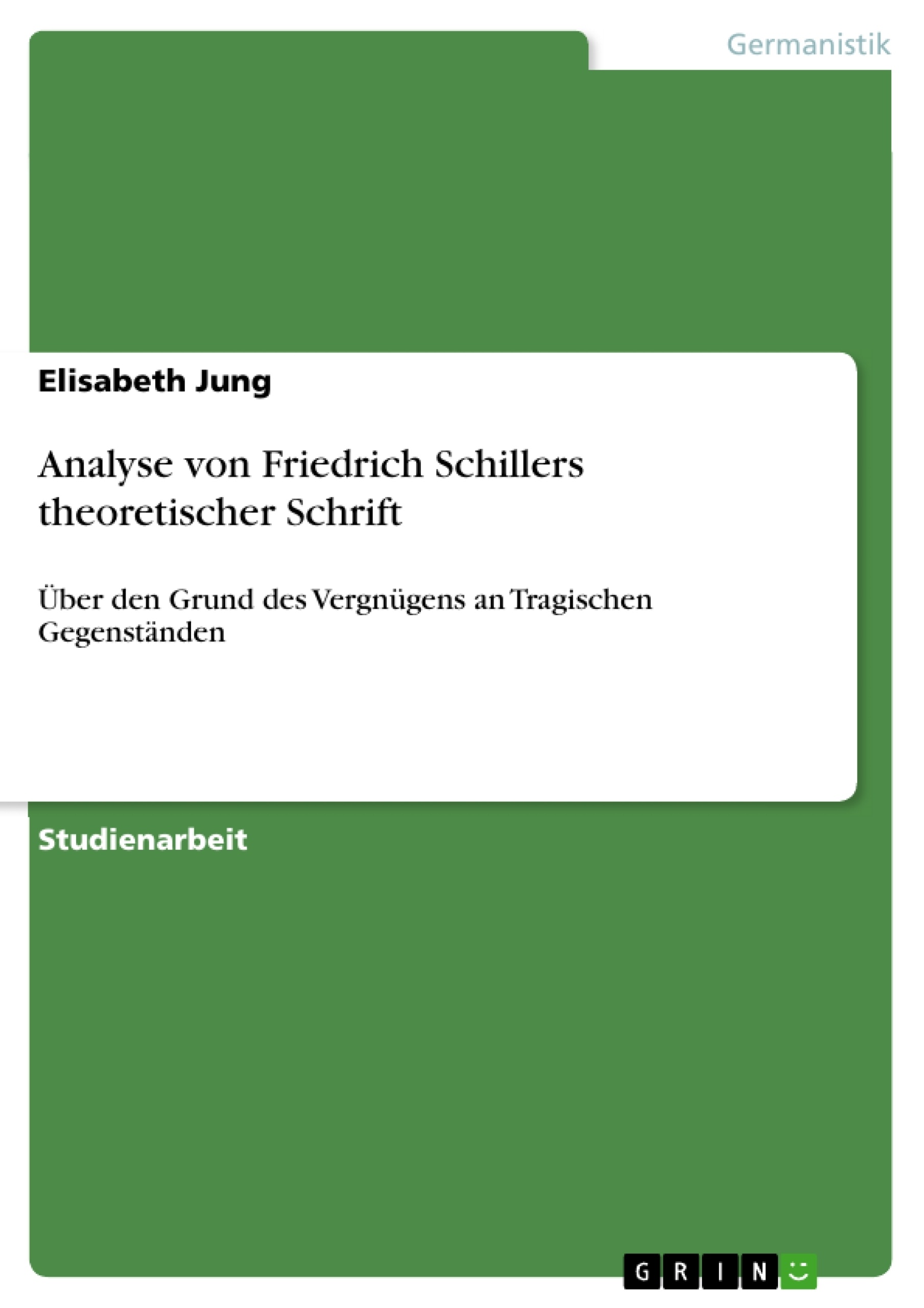Johann Christoph Friedrich von Schiller ist neben Goethe eine zentrale Gestalt der Literaturgeschichte. Obwohl vor allem Schillers Dramen zur Weltliteratur gehören, erlangte er zugleich ansehnlichen Ruhm mit einer Vielzahl theoretischer Schriften. Von daher ist das Werk "Über den Grund des Vergnügens an Tragischen Gegenständen" Thema der vorliegenden Analyse. Die Abhandlung über das Ästhetische in der Tragödie ist insofern von beträchtlichem Interesse, da durch sie eine kennzeichnende Weltanschauung zum Vorschein kommt. Welche für die damalige Zeit typischen Begrifflichkeiten und Darstellungsfragen aufgegriffen werden und inwiefern diese Themenbereiche in einem ethisch aufklärenden Kontext zu betrachten sind, wird ferner verdeutlicht. Somit kann sich nun der Leser dieser Arbeit auf einen ästhetischen Diskurs einlassen, um Schillers anregende Überlegungen auch tatsächlich nachzuvollziehen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- VORÜBERLEGUNGEN ZUM HISTORISCHEN KONTEXT UND ZUM AUFBAU DER SCHRIFT
- ANALYSE
- Die Zweckmäßigkeit in der Kunst
- Das Freie Vergnügen und die Sinnliche Lust
- Über den Grund des Erhabenen
- Über die Zweckmäßigkeit und Zweckwidrigkeit als Grund für die Rührung
- Über den Grund der Faszination am Bösen in der Kunst
- SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Friedrich Schillers theoretische Schrift „Über den Grund des Vergnügens an Tragischen Gegenständen“ und beleuchtet die von Schiller aufgegriffenen ästhetischen und ethischen Aspekte der Tragödie. Besondere Aufmerksamkeit wird auf den historischen Kontext und Schillers Bezug zu Immanuel Kant gelegt.
- Die Beziehung zwischen Ethik und Ästhetik in Schillers Analyse
- Der Begriff des „freien Vergnügens“ und dessen Verbindung zur Zweckmäßigkeit
- Die Rolle des Erhabenen und die Einordnung tragischer Elemente in den ästhetischen Diskurs
- Das Konzept der Zweckmäßigkeit und Zweckwidrigkeit in Bezug auf die Rührung
- Schillers Analyse der menschlichen Faszination für das Böse in der Tragödie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Schiller als zentrale Gestalt der Literaturgeschichte vor und erläutert die Bedeutung seiner theoretischen Schriften, insbesondere „Über den Grund des Vergnügens an Tragischen Gegenständen“. Die Arbeit beleuchtet die Relevanz der Schrift für die damalige Zeit und die Bedeutung der aufgegriffenen Begrifflichkeiten und Darstellungsfragen im Kontext der Aufklärung.
Das zweite Kapitel widmet sich dem historischen Kontext und dem Aufbau von Schillers Schrift. Es wird deutlich, dass Schillers Abhandlung im Kontext des umfassenden Studiums von Immanuel Kants zu sehen ist und zahlreiche Elemente der Kantischen Ästhetik aufgreift. Der Einfluss Kants auf Schillers Denken wird anhand von Briefen und Zitaten verdeutlicht.
Im dritten Kapitel werden verschiedene Aspekte der Tragödie analysiert. Schiller erläutert den Begriff der „Zweckmäßigkeit in der Kunst“ und setzt ihn in Beziehung zum „freien Vergnügen“. Er behandelt das „Erhabene“ und dessen Rolle in der Tragödie, untersucht die Verbindung zwischen Zweckmäßigkeit und Rührung und schließlich analysiert er die Faszination des Menschen am Bösen in der Kunst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Ästhetik, Ethik, Tragödie, Zweckmäßigkeit, freies Vergnügen, Erhabenes, Rührung, Schiller, Kant, Aufklärung, moralische Zweckmäßigkeit, historischer Kontext, Begrifflichkeiten, Darstellungsfragen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Schillers Schrift „Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen“?
Schiller untersucht die ästhetische Frage, warum Menschen beim Betrachten von traurigen oder schmerzhaften Ereignissen in einer Tragödie Vergnügen empfinden.
Welchen Einfluss hatte Immanuel Kant auf diese Schrift?
Schiller stützte sich stark auf Kants Ästhetik, insbesondere auf die Begriffe der Zweckmäßigkeit ohne Zweck und das Erhabene.
Was versteht Schiller unter „freiem Vergnügen“?
Es ist ein Vergnügen, das nicht aus sinnlicher Lust, sondern aus der moralischen und ästhetischen Freiheit des Geistes entspringt.
Warum fasziniert das Böse in der Kunst laut Schiller?
Die Faszination rührt daher, dass die Kunst es ermöglicht, die Kraft des menschlichen Willens und die ästhetische Form auch in moralisch verwerflichen Charakteren zu bewundern.
Was ist der Unterschied zwischen Rührung und Erhabenem?
Rührung entsteht durch Mitleid und Zweckmäßigkeit, während das Erhabene den Menschen über seine sinnliche Natur erhebt und seine moralische Größe zeigt.
- Citation du texte
- Elisabeth Jung (Auteur), 2008, Analyse von Friedrich Schillers theoretischer Schrift , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151787