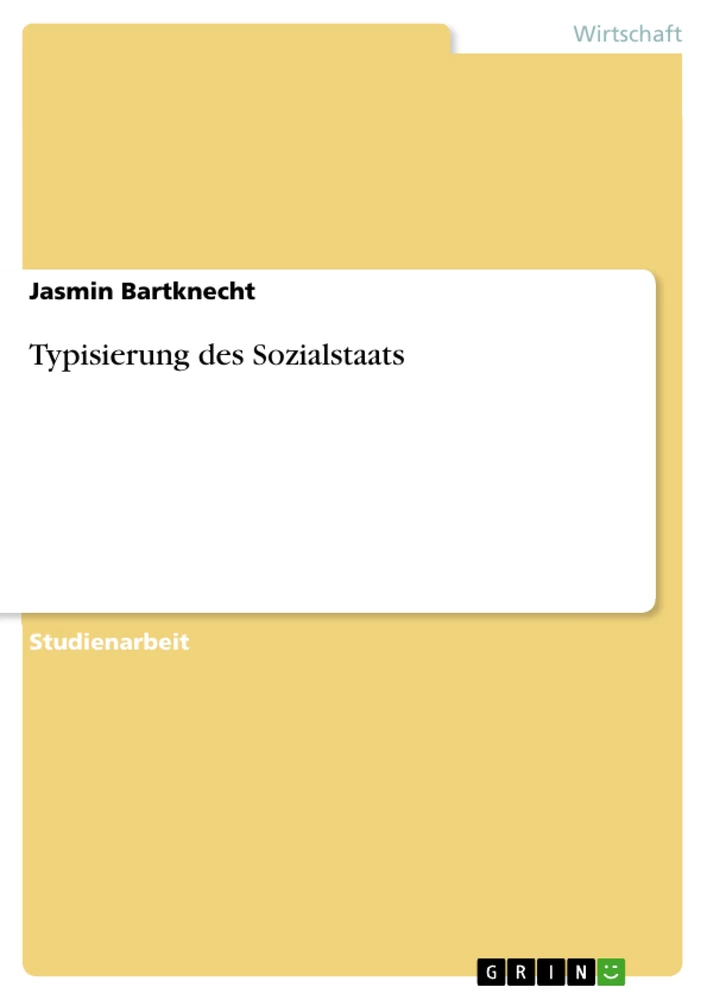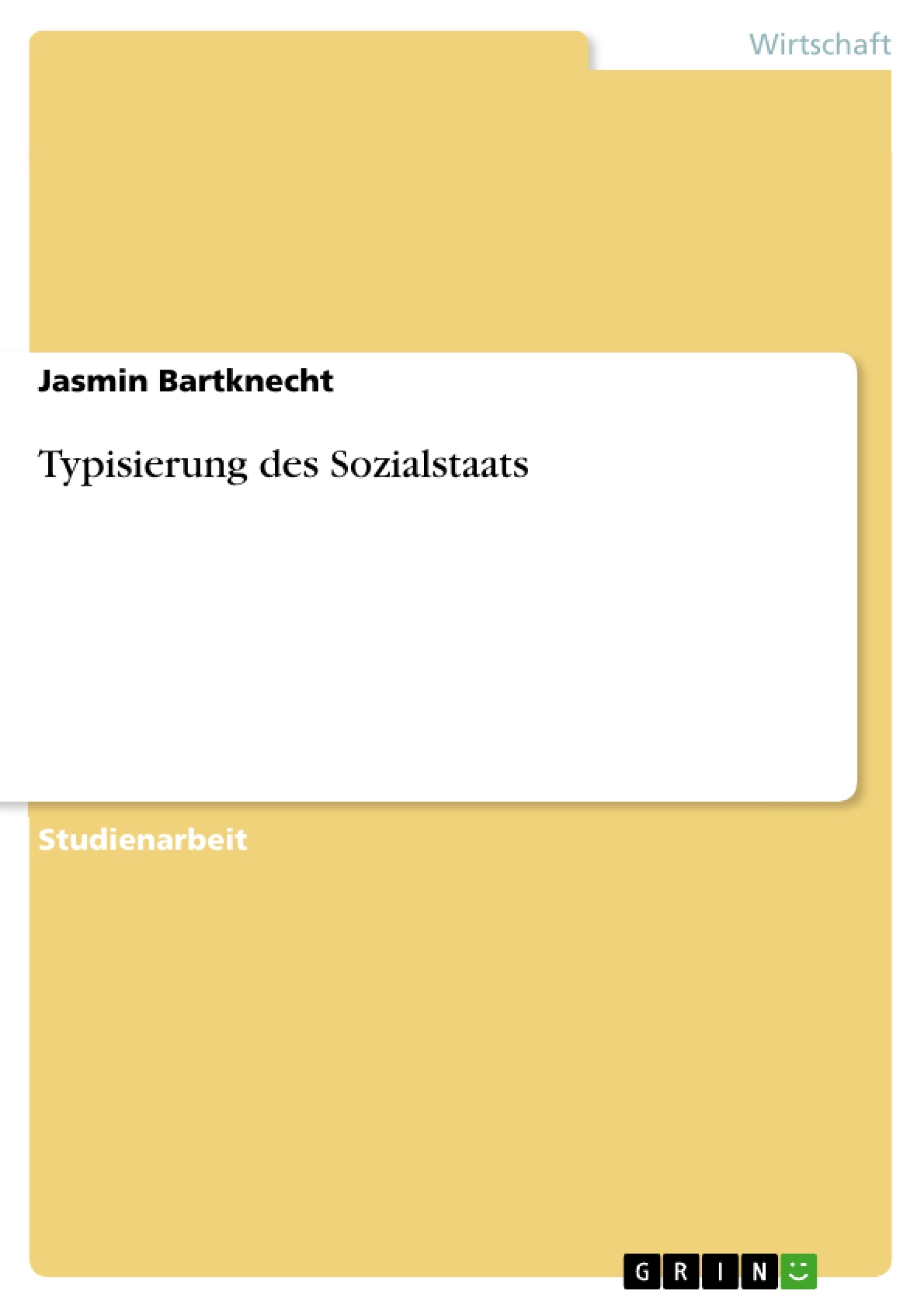„Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.“ Das sind die Worte des Philosophen Søren Aabye Kierkegaard. Doch liegt dies wohl eher daran, mit wem man sich vergleicht. Und ist es überhaupt sinnvoll sich zu vergleichen? Können wir aus Vergleichen lernen? Diese Fragen lassen sich auch im Bezug auf Wohlfahrtstaaten stellen. Ist es möglich zu sagen, Schweden ist wohlfahrtstaatlicher als die USA, aufgrund seiner höheren Sozialleistungsquote? Solche Fragen lassen sich nicht ohne weiteres beantworten. Länder sind durch verschiedene Normen und Werte geprägt. Der Sozialstaat eines Landes hat sich aufgrund unterschiedlicher Ereignisse in der Vergangenheit entwickelt. Deshalb treten in der Realität die verschiedensten Maßnahmen auf, um die Probleme, denen sich ein Sozialstaat stellen muss zu bewältigen. Müssen wir also tatsächlich ernüchternd feststellen, dass Vergleiche von Wohlfahrtstaaten im schlimmsten Fall nur Unzufriedenheit hervorrufen, aber keinerlei Lernerfolge liefern? Einen großen Beitrag zur vergleichenden Wohlfahrtsforschung lieferte die Typisierung von Sozialstaaten. Sie gruppiert Länder anhand verschiedener Indikatoren. Doch inwieweit ist eine solche Gruppierung reeller Staaten möglich, insbesondere da der Sozialstaat ein sich veränderndes Konstrukt ist?
Im Rahmen dieser Hausarbeit soll zunächst der Begriff des Sozialstaats analysiert werden. Danach werden die Gründe für eine Typisierung näher betrachtet. Im dritten Teil wird das bedeutende Konzept von Esping-Andersen zur Typisierung dargestellt. Eine Auswahl von Erweiterungen dieser Theorie ist Bestandteil des vierten Abschnitts. Schlussendlich soll dargestellt werden, inwieweit sich das Konzept der Typisierung für die vergleichende Wohlfahrtsforschung eignet und ob sie in der Lage ist, den Wandel des Sozialstaats zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Der Sozialstaat
- Der Begriff des Sozialstaats
- Die Notwendigkeit einer Typisierung
- Das Konzept von Esping-Andersen
- Die drei Wohlfahrtswelten
- Zuordnung der Regime zu reellen Wohlfahrtstaaten
- Macht-Ressourcen-Theorie
- Kritik und Erweiterung der drei Wohlfahrtswelten
- Berücksichtigung von Institutionen
- Feministische Kritik an der De-Kommodifizierung
- Weitere Regimetypen
- Einfluss des bestehenden Wirtschaftsmodells
- Evaluation der Typisierung
- Aussagekraft in der vergleichenden Wohlfahrtsforschung
- Wandel des Wohlfahrtstaats
- Stabilitätsanalyse
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Typisierung des Sozialstaats und analysiert verschiedene Konzepte, die zur Einordnung und zum Vergleich von Wohlfahrtsstaaten entwickelt wurden. Ziel ist es, die Notwendigkeit und die Aussagekraft der Typisierung im Kontext der vergleichenden Wohlfahrtsforschung zu beleuchten. Dabei werden die zentralen Elemente des Sozialstaatsbegriffs, die Gründe für eine Typisierung und die Entwicklung des Konzepts von Esping-Andersen dargestellt. Darüber hinaus werden kritische Anmerkungen und Erweiterungen der Typisierung diskutiert, um die Grenzen und Potenziale des Konzepts zu erörtern.
- Der Begriff des Sozialstaats und seine Bedeutung für die soziale Sicherung
- Die Notwendigkeit einer Typisierung zur Vergleichbarkeit von Wohlfahrtsstaaten
- Das Konzept von Esping-Andersen und die drei Wohlfahrtswelten
- Kritik und Erweiterungen der Typisierung, insbesondere im Hinblick auf die Berücksichtigung von Institutionen und die feministische Perspektive
- Die Aussagekraft der Typisierung für die vergleichende Wohlfahrtsforschung und die Erklärung des Wandels des Sozialstaats
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit beschäftigt sich mit der Problemstellung der Typisierung von Sozialstaaten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit Vergleiche von Wohlfahrtsstaaten sinnvoll sind und welche Herausforderungen sich dabei stellen. Die Notwendigkeit einer Typisierung wird im zweiten Kapitel erläutert, wobei die fehlende einheitliche Definition des Sozialstaats und die Notwendigkeit einer systematischen Einordnung von Wohlfahrtsstaaten hervorgehoben werden. Das dritte Kapitel widmet sich dem Konzept von Esping-Andersen, das die drei Wohlfahrtswelten „liberale“, „konservative“ und „sozialdemokratische“ Wohlfahrtsstaaten unterscheidet. Es werden die zentralen Merkmale dieser Regimetypen dargestellt und die Zuordnung von realen Ländern zu den idealtypischen Regimen erläutert. Die Machtressourcentheorie, die die Entstehung der unterschiedlichen Regimetypen erklärt, wird ebenfalls behandelt.
Das vierte Kapitel befasst sich mit Kritik und Erweiterungen des Konzepts von Esping-Andersen. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, die die Typisierung des Sozialstaats erweitern und die Grenzen des ursprünglichen Konzepts aufzeigen. Dazu gehören die Berücksichtigung von Institutionen, die feministische Kritik an der De-Kommodifizierung und die Einbeziehung weiterer Regimetypen. Darüber hinaus wird der Einfluss des bestehenden Wirtschaftsmodells auf die Ausgestaltung des Sozialstaats beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Sozialstaat, die Typisierung von Sozialstaaten, die Wohlfahrtswelten nach Esping-Andersen, die vergleichende Wohlfahrtsforschung, die De-Kommodifizierung, die Machtressourcentheorie, die feministische Kritik an der Typisierung, die Berücksichtigung von Institutionen und den Wandel des Sozialstaats.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Sozialstaaten typisiert?
Typisierungen helfen dabei, die Vielfalt realer Sozialstaaten systematisch zu ordnen und vergleichbar zu machen, um Lernerfolge aus verschiedenen Modellen zu ziehen.
Was sind die "drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus" nach Esping-Andersen?
Esping-Andersen unterscheidet zwischen liberalen, konservativen (korporatistischen) und sozialdemokratischen Wohlfahrtsregimen.
Was bedeutet De-Kommodifizierung?
Es beschreibt den Grad, in dem soziale Leistungen die Bürger vom Arbeitsmarkt unabhängig machen, sodass sie einen Lebensstandard ohne Verkauf ihrer Arbeitskraft sichern können.
Welche Kritik gibt es aus feministischer Sicht?
Kritikerinnen bemängeln, dass das Konzept der De-Kommodifizierung unbezahlte Sorgearbeit (meist von Frauen) und die Rolle der Familie oft vernachlässigt.
Kann Typisierung den Wandel des Sozialstaats erklären?
Sie dient als Analyseraster, stößt aber an Grenzen, da reale Sozialstaaten dynamische Konstrukte sind, die sich ständig verändern und oft Mischformen bilden.
- Citation du texte
- Jasmin Bartknecht (Auteur), 2010, Typisierung des Sozialstaats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151870