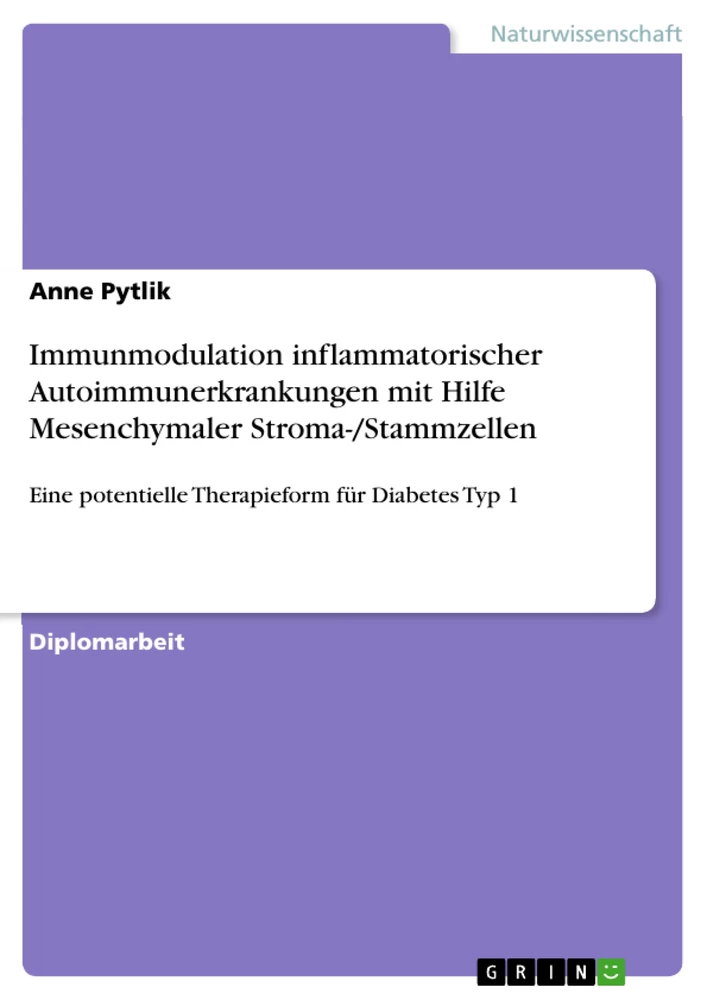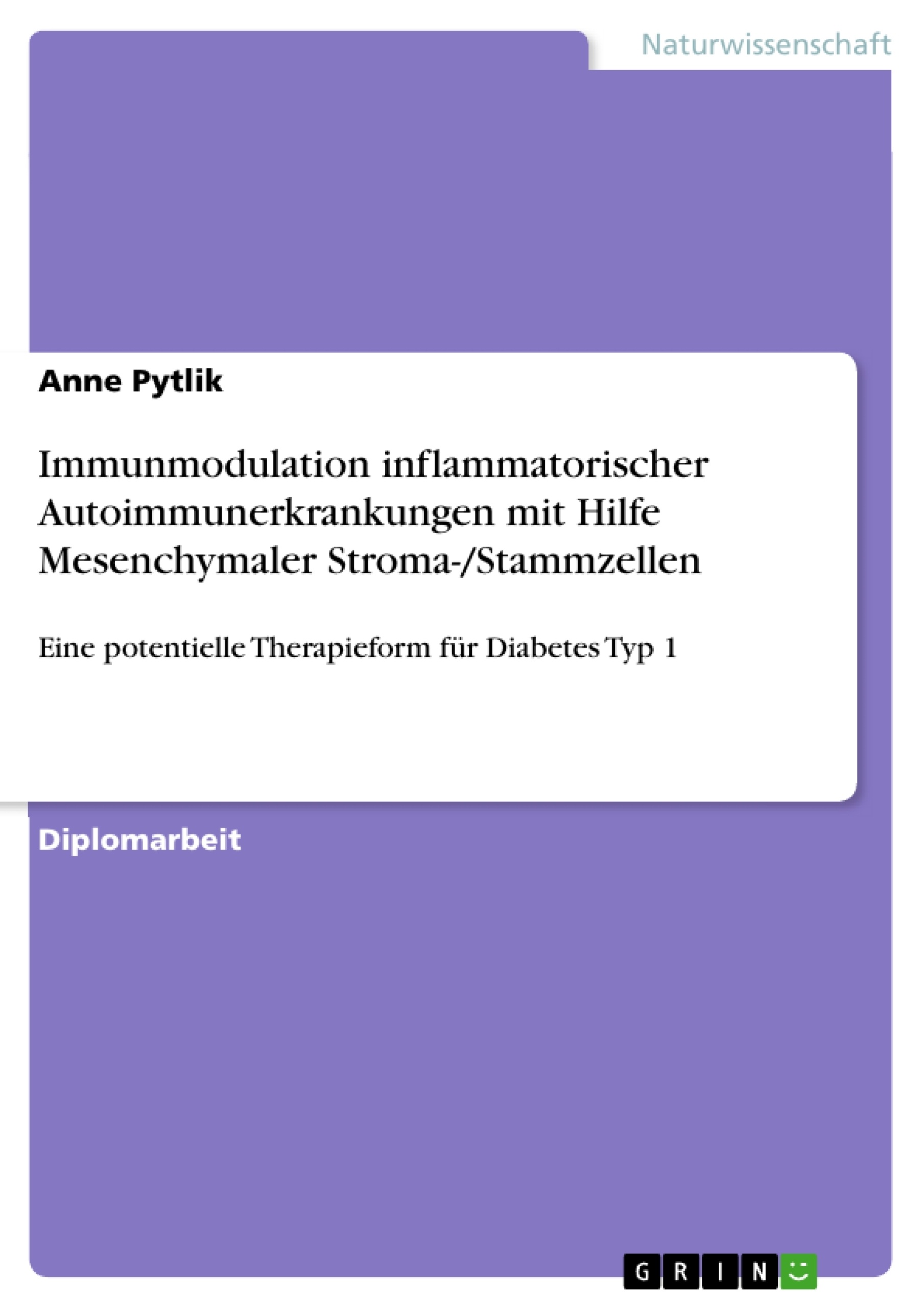Stichwortartige Zusammenfassung der potentiellen Mechanismen über die MSC nach momentanem Wissensstand in das Immungeschehen eingreifen können, eigene Darstellung:
(1) MSC interagieren sowohl mit ruhenden als auch aktivierten NKZ. Bei ruhenden NKZ verhindern sie u.a. durch lösliche Faktoren deren Aktivierung. Bei bereits aktivierten NKZ können sie sowohl über Oberflächenmoleküle als auch sekretierte Faktoren Proliferation und Cytotoxizität der MSC vermindern. Außerdem bleibt durch MSC die wechselseitige Stimulation von NKZ mit DC aus.
(2) a) MSC hemmen die Ausdifferenzierung zu iDC b) MSC hemmen die Proliferation von iDC. In der weiteren Konsequenz kann die so erreichte, fehlerhafte AG-Präsentation die T-Zellreaktionen beeinflußen und ggf. so zu einer Toleranzinduktion führen. c) MSC hemmen die Maturation von iDC zu mDC bzw. machen sogar eine Rückführung vom reifen ins unreife DC-Stadium möglich d) MSC regen DC dazu an Mediatoren zu bilden, die z.B. Treg induzieren.
(3) a) MSC stimulieren die Treg-Generation b) MSC hemmen CTL in Proliferation und Cytotoxizität c) MSC hemmen die Aktivierung von Th. Sie verschieben das Gleichgewicht in Richtung Th2-Antwort, in dem sie Th2 stimulierende / Th1-hemmende Mediatoren induzieren und die Proliferation von Th1 inhibieren.
(4) MSC hemmen die Differenzierung von B-Zellen zu Plasmazellen und können die AK-Produktion (IgG, M, A) herabsetzen. Sie vermindern die B-Zellproliferation und die von ihnen ausgehende Chemotaxis durch Herabregulation bestimmter Oberflächenmoleküle (CXCR4, 5, CCR).
(5) Aktivierte MSC wirken stark chemotaktisch auf ihre Umgebung. Dies konnte nicht nur für T- und Endothelzellen gezeigt werden, sondern gilt wahrscheinlich auch für B-Zellen, DC und Makrophagen. Durch Adhäsionsmoleküle wird die Interaktion zwischen den Zellen verstärkt bzw. am Endothel das „homing“ ermöglicht.
(6) MSC können IL-6-abhängig Apoptose und „respiratory burst“ von Neutrophilen vermindern.
(7) Für viele der dargestellten Reaktionen ist eine Aktivierung der MSC notwendig. Diese kann durch IFNg zusammen mit einem oder mehreren anderen Faktoren wie TNFa oder IL-1 erfolgen
(8) Allgemein werden durch Präsenz von MSC u.a. diese Faktoren verstärkt gebildet: PGE2, HGF, HO1, iNOS, VEGF, TGFß1, IDO, sHLA-G5, IL-6, IL-8...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Typ-1-Diabetes (T1D)
- Historie, Verbreitung
- Nomenklatur des Diabetes mellitus
- Krankheitsbild & Diagnose des T1D
- In vivo-Modelle von T1D
- Ätiologie und Pathogenese des T1D
- Einführung in die Stammzellforschung
- Mesenchymale Stroma-/Stammzellen (MSC)
- In vitro
- In vivo
- Immunmodulation mit MSC
- Immunogenität von MSC selbst
- MSC und Antigen-präsentierende Zellen (APC)
- MSC und B-Zellen
- MSC und Makrophagen
- MSC und dendritische Zellen (DC)
- MSC und T-Zellen
- MSC und regulatorische T-Zellen
- MSC und T-Helferzellen / cytotoxische T-Zellen
- MSC und natürliche Killerzellen
- MSC und neutrophile Granulozyten
- MSC und lösliche Faktoren
- In vivo - Potential von MSC in T1D und Autoimmunerkrankungen
- Diskussion
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem vielversprechenden therapeutischen Potential mesenchymaler Stroma-/Stammzellen (MSC) zur Immunmodulation bei Typ-1-Diabetes (T1D). Der Fokus liegt auf der Analyse der immunmodulatorischen Eigenschaften von MSC und deren möglichen Einsatz zur Behandlung von T1D.
- Die Pathogenese von T1D und die Rolle der Autoimmunität
- Die Eigenschaften und das immunmodulatorische Potenzial von MSC
- Die Interaktion von MSC mit verschiedenen Immunzellen, insbesondere T-Zellen und Antigen-präsentierenden Zellen
- Die vielversprechenden In-vivo-Studien zu MSC-basierten Therapien bei T1D und anderen Autoimmunerkrankungen
- Die ethischen und regulatorischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Anwendung von MSC in der klinischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung bietet eine kurze Einführung in die Thematik der Immunmodulation bei T1D und das Potenzial von MSC als therapeutisches Mittel.
- Kapitel 2: Typ-1-Diabetes (T1D): Dieses Kapitel stellt die Geschichte, Verbreitung und die Nomenklatur von T1D vor. Es beleuchtet das Krankheitsbild und die Diagnostik, einschließlich In-vivo-Modellen, sowie die Ätiologie und Pathogenese der Krankheit.
- Kapitel 3: Einführung in die Stammzellforschung: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Grundlagen der Stammzellforschung und die verschiedenen Arten von Stammzellen.
- Kapitel 4: Mesenchymale Stroma-/Stammzellen (MSC): Dieses Kapitel beschreibt die Eigenschaften und die Gewinnung von MSC in vitro und in vivo.
- Kapitel 5: Immunmodulation mit MSC: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die immunmodulatorischen Eigenschaften von MSC und deren Interaktion mit verschiedenen Immunzellen, wie B-Zellen, Makrophagen, dendritischen Zellen, T-Zellen, natürlichen Killerzellen und neutrophilen Granulozyten.
- Kapitel 6: In vivo - Potential von MSC in T1D und Autoimmunerkrankungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den vielversprechenden In-vivo-Studien zur Anwendung von MSC bei T1D und anderen Autoimmunerkrankungen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Typ-1-Diabetes, T1D, Immunmodulation, Mesenchymale Stroma-/Stammzellen, MSC, Immunsuppression, Autoimmunität, Antigen-präsentierende Zellen, T-Zellen, regulatorische T-Zellen, dendritische Zellen, Makrophagen, natürliche Killerzellen, In-vivo-Studien, Therapieansatz, regenerative Medizin.
- Quote paper
- Anne Pytlik (Author), 2009, Immunmodulation inflammatorischer Autoimmunerkrankungen mit Hilfe Mesenchymaler Stroma-/Stammzellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151890