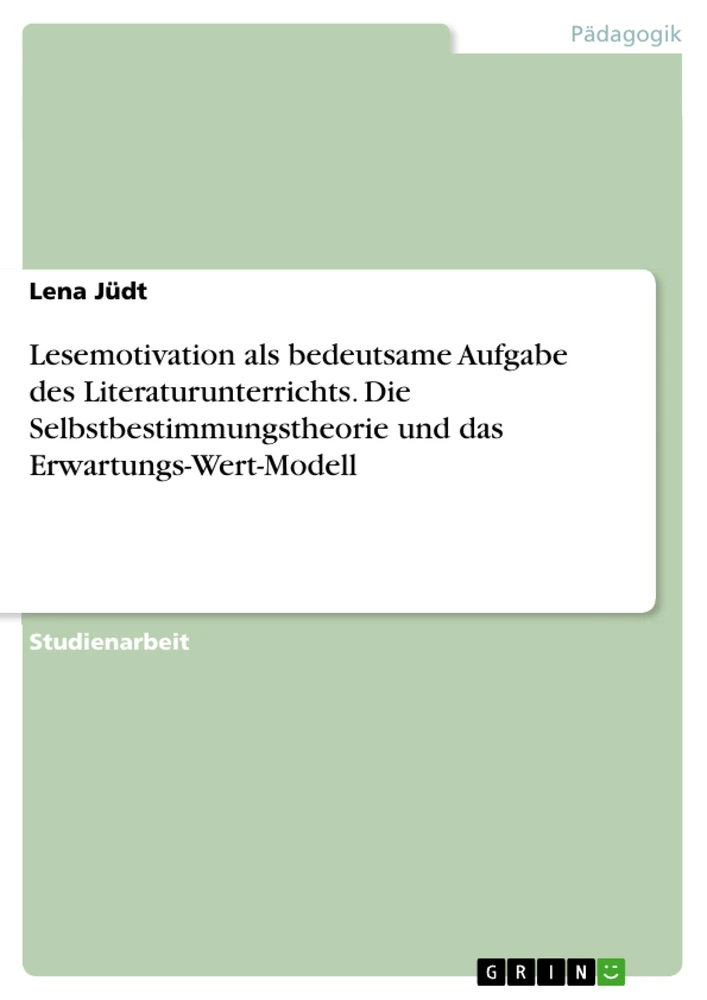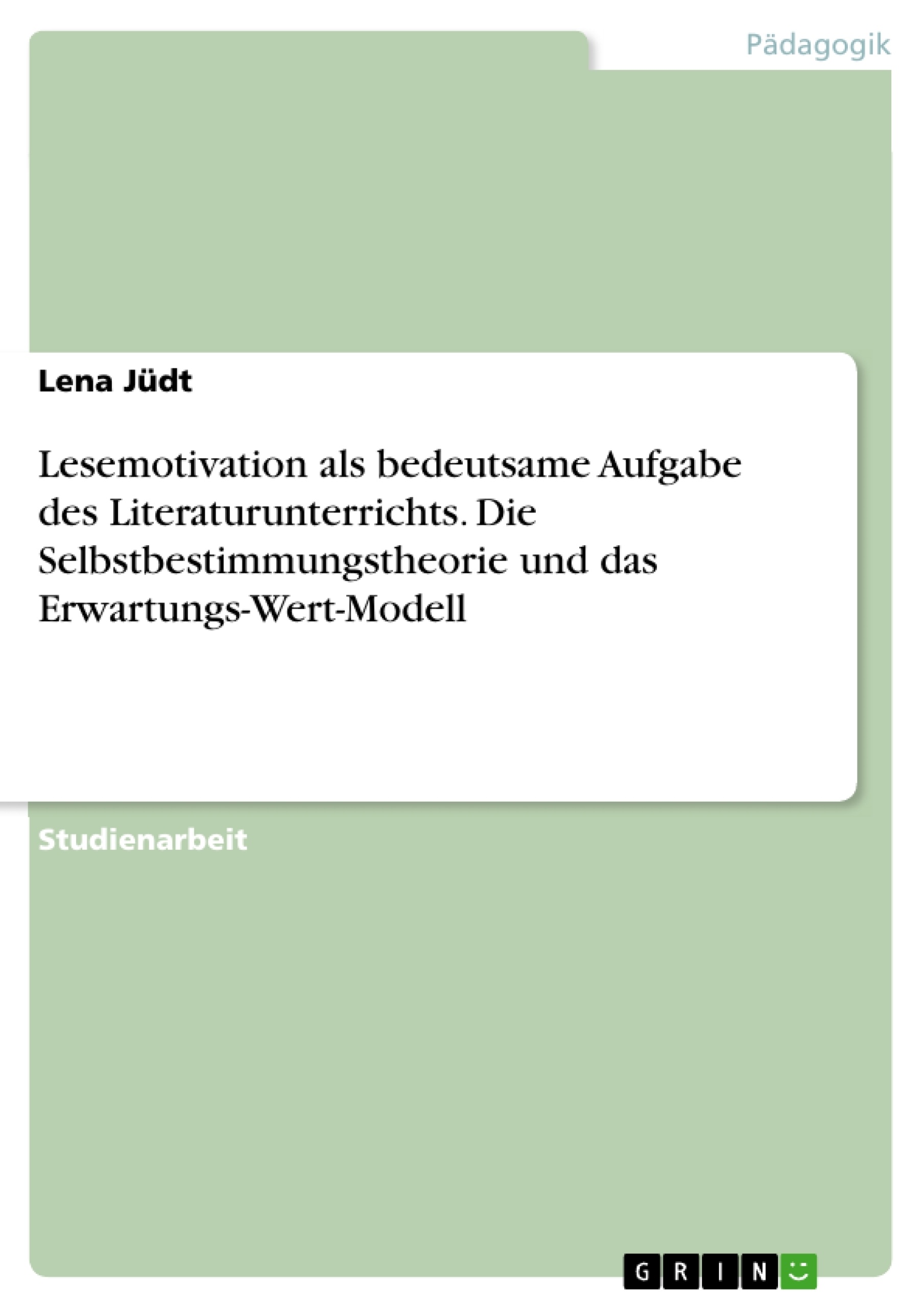Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung der Lesekompetenz und der Lesemotivation im Kontext des Bildungssystems, insbesondere vor dem Hintergrund des PISA-Schocks. Zunächst werden grundlegende Begriffe wie Lesekompetenz und Lesemotivation erläutert sowie deren Zusammenhang untersucht. Es wird gezeigt, dass eine hohe Lesemotivation eng mit einer guten Lesekompetenz verbunden ist und beide Faktoren für den Bildungserfolg entscheidend sind.
Im zweiten Teil werden zwei Motivationstheorien im Detail vorgestellt und miteinander verglichen: Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) sowie das Erwartungs-Wert-Modell von Möller & Schiefele (2004). Beide Theorien bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Entstehung und Förderung von Motivation, wobei der Vergleich auf ihre Relevanz für die Lesemotivation im schulischen Kontext eingeht.
Der dritte Abschnitt widmet sich der praktischen Bedeutung der Lesemotivation im Literatur- und Leseunterricht. Dabei werden soziale Einflussfaktoren und der sogenannte „Leseknick“ thematisiert, bevor konkrete Möglichkeiten zur Förderung der Lesemotivation, wie etwa durch gezielte Unterrichtsgestaltung, vorgestellt werden.
Abschließend wird ein Fazit gezogen, das die Wichtigkeit der Lesemotivation für den schulischen Erfolg unterstreicht und Ansätze zur effektiven Förderung dieser Motivation im Unterricht aufzeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen und Begriffserläuterung
- Die Bedeutung der Lesekompetenz hinsichtlich des PISA-Schocks
- Zum Begriff der (Lese)Motivation
- Der Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Lesemotivation
- Vorstellung und Vergleich zweier Motivationstheorien
- Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci und Ryan (1993)
- Das Erwartungs-Wert-Modell der Lesemotivation nach Möller & Schiefele (2004)
- Vergleich der vorgestellten Motivationstheorien
- Die Bedeutung der Lesemotivation im Literatur- und Leseunterricht
- Soziale Einflussfaktoren auf die Lesemotivation und der Leseknick
- Möglichkeiten für eine gezielte Lesemotivationsförderung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Lesemotivation und beleuchtet Möglichkeiten zur Förderung der Lesemotivation bei Kindern. Sie analysiert die Relevanz der Lesemotivation im Kontext des PISA-Schocks und der IGLU-Studie und vergleicht zwei relevante Motivationstheorien zur Erklärung der Lesemotivation.
- Der Einfluss des PISA-Schocks und der IGLU-Studie auf das Verständnis von Lesekompetenz.
- Vergleich der Selbstbestimmungstheorie und des Erwartungs-Wert-Modells der Motivation.
- Die Bedeutung sozialer Einflussfaktoren auf die Lesemotivation.
- Möglichkeiten zur gezielten Förderung der Lesemotivation im Unterricht.
- Der Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Lesemotivation.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem der sinkenden Lesekompetenz bei deutschen Kindern dar, wie es durch die IGLU-Studie 2021 belegt wird. Sie hebt die Bedeutung von Lesemotivation für den Erwerb von Lesekompetenz hervor und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit: die Analyse von Motivationstheorien und deren Implikationen für die Förderung der Lesemotivation im Unterricht. Die Einleitung betont die Notwendigkeit, frühzeitig, bereits in der Grundschule, eine stabile Lesemotivation zu fördern, um langfristige Erfolge im Lesen zu sichern.
Theoretische Grundlagen und Begriffserläuterung: Dieses Kapitel differenziert zwischen Lesekompetenz und Lesefertigkeiten, wobei Lesekompetenz über die bloße Dekodierung von Wörtern hinausgeht und Aspekte wie Informationsgewinnung, Interpretation und Bewertung von Texten umfasst. Es diskutiert das Literacy-Konzept und den Unterschied zwischen einer rein leistungsorientierten und einer umfassenderen Sichtweise von Lesekompetenz, welche auch emotionale und soziale Prozesse miteinbezieht. Das Kapitel vergleicht die PISA-Definition von Lesekompetenz mit der Lesesozialisationsforschung, die die Lesekompetenz als Fähigkeit zum Textverstehen im Kontext kultureller Praxis definiert.
Vorstellung und Vergleich zweier Motivationstheorien: Dieses Kapitel präsentiert und vergleicht die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) und das Erwartungs-Wert-Modell von Möller & Schiefele (2004). Es analysiert die zentralen Annahmen beider Theorien und untersucht ihre jeweiligen Stärken und Schwächen im Kontext der Lesemotivation. Der Vergleich dient dazu, ein umfassenderes Verständnis von den Einflussfaktoren auf die Lesemotivation zu entwickeln und die jeweiligen Vor- und Nachteile beider Ansätze für die pädagogische Praxis zu beleuchten.
Die Bedeutung der Lesemotivation im Literatur- und Leseunterricht: Dieses Kapitel erörtert die Rolle der Lesemotivation im Literatur- und Leseunterricht. Es analysiert soziale Einflussfaktoren, wie Familie und Schule, die die Lesemotivation beeinflussen können. Ein besonderer Fokus liegt auf dem "Leseknick", einem häufig auftretenden Problem im Anfangsunterricht. Schließlich werden verschiedene Möglichkeiten einer gezielten Lesemotivationsförderung vorgestellt und diskutiert, um die Lesemotivation und damit die Lesekompetenz der Schüler zu verbessern.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, Lesemotivation, PISA-Schock, IGLU-Studie, Selbstbestimmungstheorie, Erwartungs-Wert-Modell, Leseförderung, Grundschule, sozialer Einfluss, Leseknick.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Lesemotivation, insbesondere im Kontext des PISA-Schocks und der IGLU-Studie. Es werden zwei Motivationstheorien (Selbstbestimmungstheorie und Erwartungs-Wert-Modell) verglichen und Möglichkeiten zur Förderung der Lesemotivation im Unterricht untersucht.
Welche Motivationstheorien werden in dem Dokument verglichen?
Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci und Ryan (1993) und das Erwartungs-Wert-Modell der Lesemotivation nach Möller & Schiefele (2004) werden vorgestellt und verglichen.
Was ist der "Leseknick" und warum ist er wichtig?
Der "Leseknick" ist ein häufig auftretendes Problem im Anfangsunterricht, bei dem die anfängliche Lesemotivation der Schüler abnimmt. Das Dokument betont die Notwendigkeit, diesen Knick zu überwinden, um langfristige Erfolge im Lesen zu sichern.
Welche sozialen Einflussfaktoren beeinflussen die Lesemotivation?
Soziale Einflussfaktoren wie Familie und Schule werden als wichtige Faktoren genannt, die die Lesemotivation beeinflussen können. Das Dokument untersucht, wie diese Faktoren die Lesemotivation der Schüler positiv oder negativ beeinflussen können.
Welche Rolle spielt die IGLU-Studie in diesem Dokument?
Die IGLU-Studie wird als Beleg für die sinkende Lesekompetenz bei deutschen Kindern angeführt. Das Dokument untersucht, wie die Ergebnisse der IGLU-Studie das Verständnis von Lesekompetenz beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter werden in diesem Dokument verwendet?
Die Schlüsselwörter sind: Lesekompetenz, Lesemotivation, PISA-Schock, IGLU-Studie, Selbstbestimmungstheorie, Erwartungs-Wert-Modell, Leseförderung, Grundschule, sozialer Einfluss, Leseknick.
Was sind die Hauptziele des Dokuments?
Die Hauptziele sind: den Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Lesemotivation zu untersuchen, die Relevanz der Lesemotivation im Kontext des PISA-Schocks und der IGLU-Studie zu analysieren, zwei relevante Motivationstheorien zu vergleichen und Möglichkeiten zur Förderung der Lesemotivation bei Kindern zu beleuchten.
Welche Bedeutung hat die Lesemotivation im Literatur- und Leseunterricht?
Das Dokument betont die zentrale Rolle der Lesemotivation im Literatur- und Leseunterricht. Eine hohe Lesemotivation wird als entscheidend für die Entwicklung der Lesekompetenz angesehen.
Wie unterscheidet sich Lesekompetenz von Lesefertigkeiten?
Lesekompetenz geht über die bloße Dekodierung von Wörtern (Lesefertigkeiten) hinaus. Sie umfasst auch Aspekte wie Informationsgewinnung, Interpretation und Bewertung von Texten.
- Citar trabajo
- Lena Jüdt (Autor), 2023, Lesemotivation als bedeutsame Aufgabe des Literaturunterrichts. Die Selbstbestimmungstheorie und das Erwartungs-Wert-Modell, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1519412