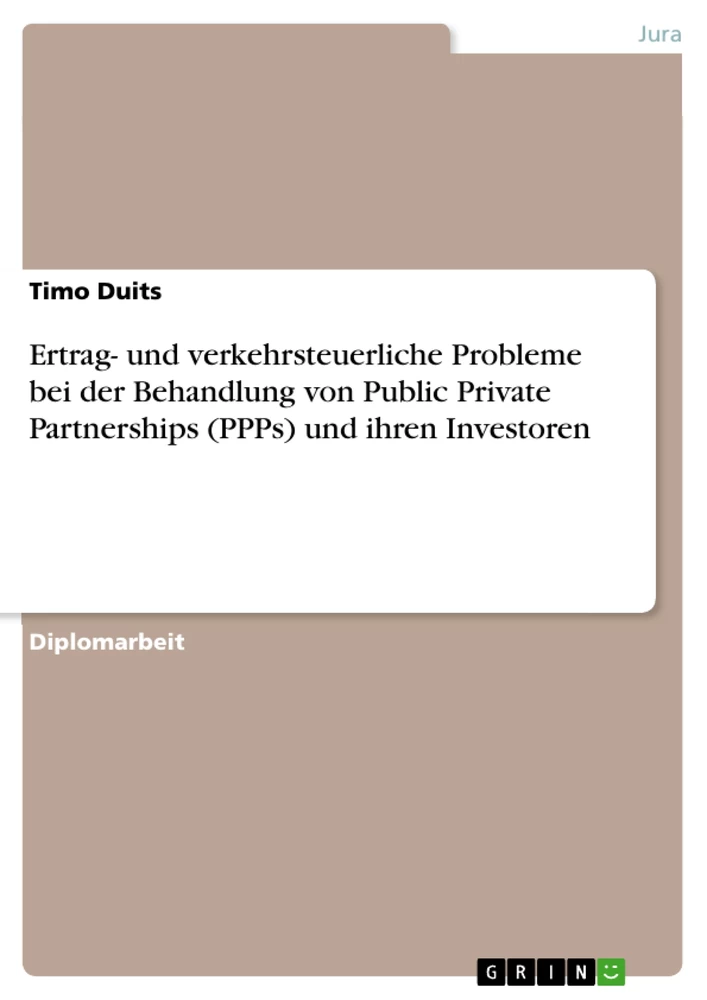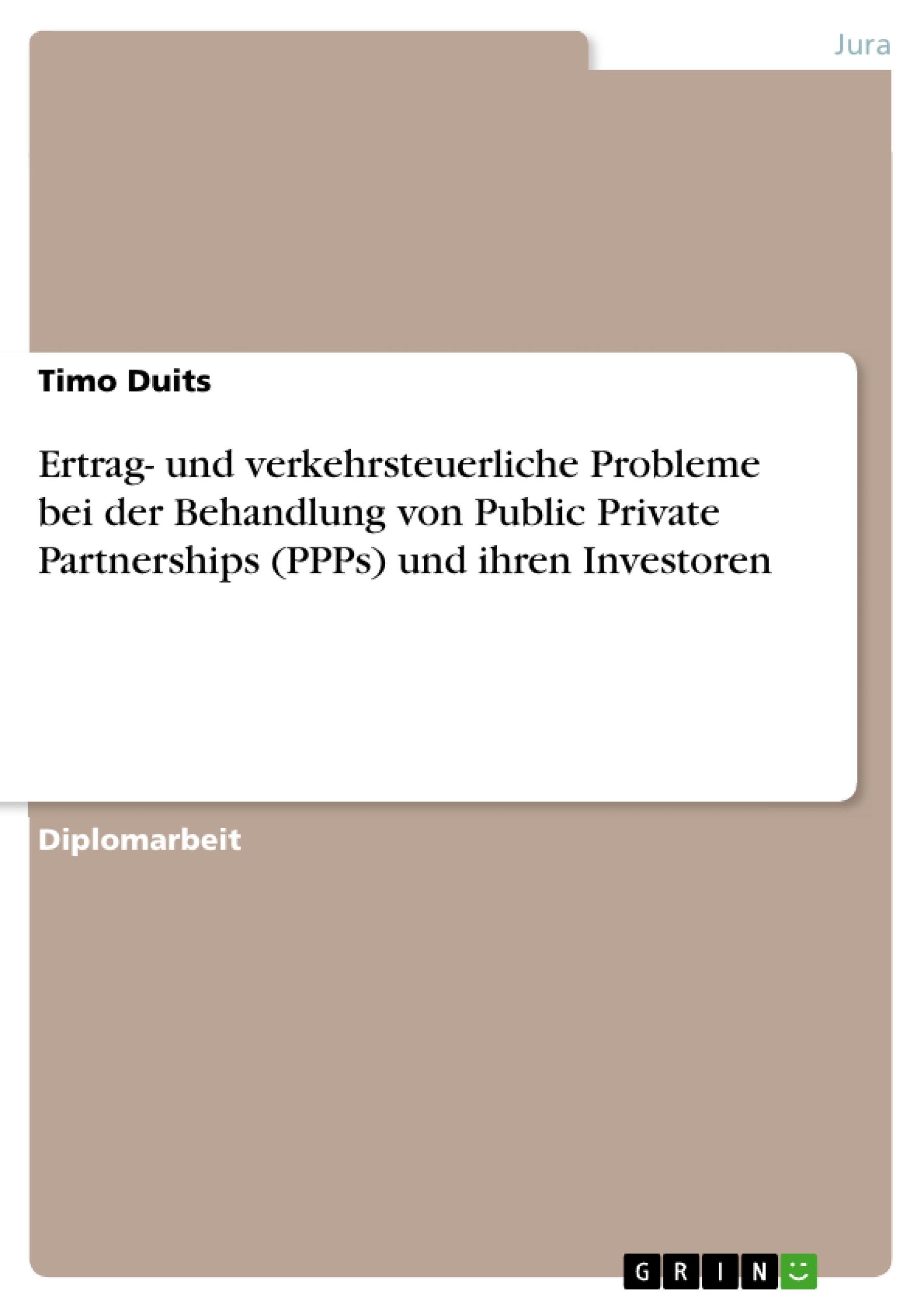Eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur ist im internationalen Standortwettbewerb ein zentraler Faktor, der im Zeitalter der Informations- und Kommunikationstechnologie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sie ist Voraussetzung für Wachstum und Effizienzsteigerungen in einer Volkswirtschaft. Angesichts der seit Jahren angespannten Haushaltslage der öffentlichen Verwaltung hat sich jedoch ein immenser Investitionsbedarf aufgestaut, der im Wesentlichen auf unterlassene und aufgeschobene Investitions- und Sanierungsvorhaben zurückzuführen ist. So schätzt das Deutsche Institut für Urbanistik den kommunalen Investitionsbedarf für die Jahre 2000 bis 2009 auf insgesamt 686 Milliarden Euro. Diesem Investitionsbedarf steht eine mehr als angespannte öffentliche Haushaltslage gegenüber. Besonders kritisch ist die finanzielle Situation der Kommunen, auf die ca. 60% der öffentlichen Bauin-vestitionen fallen.
Aufgrund des geringen finanziellen Spielraums und der bereits zu hohen Staatsverschuldung ist die Öffentliche Hand im Sinne einer effizienten Nutzung der begrenzten finanziellen Reserven gefordert, sich konsequent auf ihre Kernkompetenzen zu beschränken. Dies kann aber nur gelingen, wenn die öffentlichen Haushalte bereit sind, Kapital und Know-how von privaten Unternehmen mittels geeigneter Koopera-tionen vermehrt zu nutzen. Einen wichtigen in Deutschland bislang noch zu wenig genutzten Ansatz bilden hierzu PPPs bzw. ÖPPs. Die Öffentliche Hand verspricht sich, durch die Beauftragung Dritter Kosten- und Effizienzvorteile von bis zu 20% erzielen zu können. Dass solche Erwartungen keineswegs unberechtigt sind, zeigt eine Vielzahl erfolgreicher PPP-Projekte in Ländern wie Großbritannien oder Niederlande.
Allerdings wirft die Durchführung entsprechender Projekte in Deutschland zahl-reiche Rechtsprobleme auf. Während die kommunal-, vergabe-, haushalts- und zivil-rechtlichen Aspekte mittlerweile vergleichsweise gut aufgearbeitet wurden, haben die steuerrechtlichen Fragestellungen in der Diskussion bzgl. der Einsetzbarkeit von PPP-Konzepten nur wenig Beachtung gefunden. Die Wirtschaftlichkeit eines solchen Projekts hängt aber in hohem Maße von der steuerlichen Behandlung eines PPP-Modells ab. Zwar hat der Gesetzgeber mit dem ÖPP-Beschleunigungsgesetz vom 01. September 2005 einige steuerliche Unklarheiten beseitigen können, jedoch birgt die Besteuerung einer PPP weiterhin eine Vielzahl steuerrechtlicher Probleme, die der Klärung bedürfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konventionelle Durchführung von Hochbaumaßnahmen
- 3. Definition und Charakteristika einer PPP
- 4. PPP-Vertragsmodelle
- 4.1. Objekt im Eigentum des privaten Partners
- 4.1.1. PPP-Erwerbermodell
- 4.1.2. PPP-Leasingmodell
- 4.1.3. PPP-Vermietungsmodell
- 4.2. Objekt im Eigentum der Öffentlichen Hand
- 4.2.1. PPP-Inhabermodell (Betreibermodell)
- 4.2.2. PPP-Contractingmodell
- 4.3. Spezielle Vertragsmodelle
- 4.3.1. PPP-Konzessionsmodell
- 4.3.2. PPP-Gesellschaftsmodell (Kooperationsmodell)
- 4.1. Objekt im Eigentum des privaten Partners
- 5. Steuerneutralität als Ziel des Gesetzgebers
- 6. Darstellung der grundsätzlichen steuerlichen Rahmenbedingungen und Problembereiche bei PPP-Projekten
- 6.1. Ertragsteuerliche Grundlagen und Probleme
- 6.2. Umsatzsteuerliche Grundlagen und Probleme
- 6.3. Grunderwerbsteuerliche Grundlagen und Probleme
- 7. Steuerrechtliche Untersuchung des konventionellen Beschaffungsansatzes und der PPP-Vertragsmodelle
- 7.1. Konventionelle Realisierung von Hochbauprojekten
- 7.2. PPP-Erwerbermodell
- 7.3. PPP-Leasingmodell
- 7.4. PPP-Vermietungsmodell
- 7.5. PPP-Inhabermodell (Betreibermodell) und PPP-Contractingmodell
- 7.6. PPP-Konzessionsmodell
- 7.7. PPP-Gesellschaftsmodell (Kooperationsmodell)
- 8. Auftretende steuerliche Wettbewerbsverzerrungen und mögliche Lösungsansätze
- 8.1. Ertragsteuern
- 8.2. Umsatzsteuer
- 8.3. Grunderwerbsteuer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ertrag- und verkehrsteuerlichen Probleme bei Public Private Partnerships (PPPs) und deren Investoren. Ziel ist es, die steuerlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen bei verschiedenen PPP-Modellen zu analysieren und mögliche Wettbewerbsverzerrungen aufzuzeigen.
- Analyse verschiedener PPP-Vertragsmodelle
- Untersuchung der ertragsteuerlichen Implikationen von PPPs
- Bewertung der umsatzsteuerlichen Aspekte bei PPP-Projekten
- Beurteilung der grunderwerbsteuerlichen Problematik
- Identifizierung potenzieller Wettbewerbsverzerrungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Public Private Partnerships (PPPs) ein und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit. Sie beschreibt den wachsenden Einsatz von PPPs im Hochbau und die damit verbundenen steuerlichen Herausforderungen, die im Fokus der Untersuchung stehen. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden steuerrechtlichen Analyse dieser komplexen Finanzierungs- und Vertragsmodelle hervorgehoben.
2. Konventionelle Durchführung von Hochbaumaßnahmen: Dieses Kapitel beleuchtet die traditionelle Vorgehensweise bei Hochbauprojekten ohne Beteiligung privater Partner. Es dient als Vergleichsbasis für die spätere Analyse der PPP-Modelle und beschreibt die steuerlichen Implikationen der konventionellen Durchführung, insbesondere im Hinblick auf Ertrags-, Umsatz- und Grunderwerbsteuer.
3. Definition und Charakteristika einer PPP: Hier wird der Begriff der Public Private Partnership (PPP) präzise definiert und deren wesentliche Merkmale erläutert. Es werden verschiedene Charakteristika von PPPs herausgearbeitet, um die Besonderheiten dieser Finanzierungsform gegenüber konventionellen Projekten zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Verantwortung von öffentlicher Hand und privaten Partnern.
4. PPP-Vertragsmodelle: Dieses Kapitel stellt verschiedene PPP-Vertragsmodelle vor und differenziert diese hinsichtlich des Eigentumsverhältnisses am Bauobjekt und der jeweiligen Aufgabenverteilung zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Es werden die unterschiedlichen Modelle detailliert beschrieben und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile analysiert. Das Kapitel bildet die Grundlage für die nachfolgenden steuerlichen Analysen.
5. Steuerneutralität als Ziel des Gesetzgebers: Dieses Kapitel behandelt das allgemeine Ziel der Steuergesetzgebung, nämlich die Steuerneutralität. Es analysiert, inwiefern die Steuergesetzgebung die verschiedenen PPP-Modelle begünstigt oder benachteiligt und ob das Ziel der Steuerneutralität erreicht wird. Diese Analyse bildet einen wichtigen Bezugspunkt für die Bewertung der später beschriebenen steuerlichen Problemfelder.
6. Darstellung der grundsätzlichen steuerlichen Rahmenbedingungen und Problembereiche bei PPP-Projekten: Dieses Kapitel beleuchtet die steuerlichen Rahmenbedingungen für PPP-Projekte und identifiziert die wichtigsten Problemfelder im Ertrags-, Umsatz- und Grunderwerbsteuerrecht. Die einzelnen Steuerarten werden detailliert untersucht, wobei die komplexen Interaktionen der verschiedenen Steuerarten herausgestellt werden. Dies ist eine umfassende Einführung in die steuerlichen Schwierigkeiten im Bereich der PPPs.
7. Steuerrechtliche Untersuchung des konventionellen Beschaffungsansatzes und der PPP-Vertragsmodelle: Dieses Kapitel vergleicht die steuerliche Behandlung konventioneller Hochbauprojekte mit den verschiedenen PPP-Modellen. Es werden die ertragsteuerlichen, umsatzsteuerlichen und grunderwerbsteuerlichen Aspekte für jedes Modell einzeln untersucht und miteinander verglichen. Der Vergleich soll zeigen, welche steuerlichen Konsequenzen die Wahl eines bestimmten PPP-Modells mit sich bringt.
8. Auftretende steuerliche Wettbewerbsverzerrungen und mögliche Lösungsansätze: In diesem Kapitel werden mögliche Wettbewerbsverzerrungen aufgrund der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung der verschiedenen PPP-Modelle analysiert. Es werden Lösungsansätze für die identifizierten Probleme diskutiert, mit dem Ziel, eine gleichmäßigere und gerechtere steuerliche Behandlung aller Beteiligten zu erreichen.
Schlüsselwörter
Public Private Partnerships (PPPs), Hochbau, Ertragsteuer, Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer, Steuerneutralität, Wettbewerbsverzerrung, Vertragsmodelle, Finanzierung, Gewinnrealisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Steuerliche Aspekte von Public Private Partnerships (PPPs) im Hochbau
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ertrags- und umsatzsteuerlichen Probleme bei Public Private Partnerships (PPPs) und deren Investoren im Hochbau. Ziel ist die Analyse der steuerlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen bei verschiedenen PPP-Modellen und die Aufdeckung möglicher Wettbewerbsverzerrungen.
Welche PPP-Vertragsmodelle werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene PPP-Vertragsmodelle, differenziert nach dem Eigentumsverhältnis am Bauobjekt: Modelle, bei denen das Objekt im Eigentum des privaten Partners ist (Erwerber-, Leasing- und Vermietungsmodell), und Modelle, bei denen das Objekt im Eigentum der öffentlichen Hand verbleibt (Inhaber-/Betreibermodell und Contractingmodell). Zusätzlich werden spezielle Modelle wie das Konzessionsmodell und das Gesellschafts-/Kooperationsmodell betrachtet.
Welche Steuerarten werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die ertragsteuerlichen, umsatzsteuerlichen und grunderwerbsteuerlichen Aspekte von PPP-Projekten. Es wird analysiert, wie die verschiedenen Steuerarten die einzelnen PPP-Modelle beeinflussen und welche Probleme sich daraus ergeben.
Wie wird der konventionelle Beschaffungsansatz berücksichtigt?
Der konventionelle Beschaffungsansatz (ohne PPP) dient als Vergleichsbasis. Die steuerliche Behandlung konventioneller Hochbauprojekte wird mit der steuerlichen Behandlung der verschiedenen PPP-Modelle verglichen, um die Unterschiede und möglichen Wettbewerbsverzerrungen aufzuzeigen.
Welche steuerlichen Problemfelder werden identifiziert?
Die Arbeit identifiziert verschiedene steuerliche Problemfelder, die sich aus den unterschiedlichen PPP-Modellen ergeben. Diese Problemfelder betreffen die Ertrags-, Umsatz- und Grunderwerbsteuer und können zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Welche Wettbewerbsverzerrungen werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert mögliche Wettbewerbsverzerrungen, die durch die unterschiedliche steuerliche Behandlung der verschiedenen PPP-Modelle entstehen. Es wird untersucht, wie diese Verzerrungen entstehen und welche Auswirkungen sie haben.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit diskutiert mögliche Lösungsansätze, um die identifizierten Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen und eine gleichmäßigere und gerechtere steuerliche Behandlung aller Beteiligten zu erreichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, konventionelle Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Definition und Charakteristika einer PPP, PPP-Vertragsmodelle, Steuerneutralität als Ziel des Gesetzgebers, steuerliche Rahmenbedingungen und Problembereiche bei PPP-Projekten, steuerrechtliche Untersuchung des konventionellen Beschaffungsansatzes und der PPP-Vertragsmodelle, und auftretende steuerliche Wettbewerbsverzerrungen und mögliche Lösungsansätze.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Public Private Partnerships (PPPs), Hochbau, Ertragsteuer, Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer, Steuerneutralität, Wettbewerbsverzerrung, Vertragsmodelle, Finanzierung, Gewinnrealisierung.
- Citation du texte
- CPA, M.A. Timo Duits (Auteur), 2007, Ertrag- und verkehrsteuerliche Probleme bei der Behandlung von Public Private Partnerships (PPPs) und ihren Investoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151967