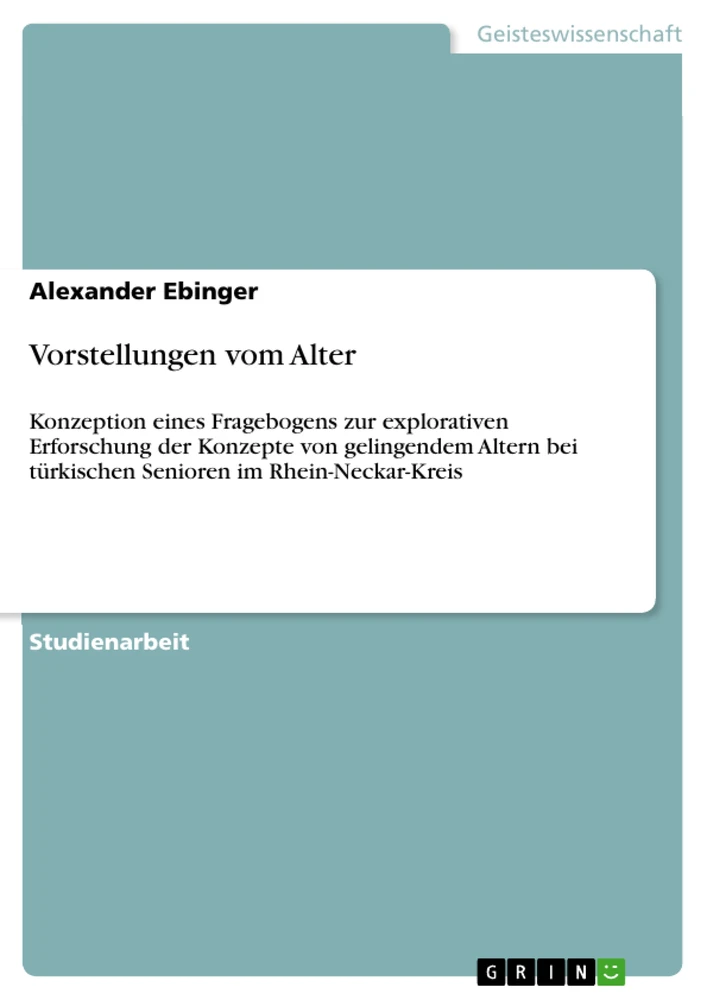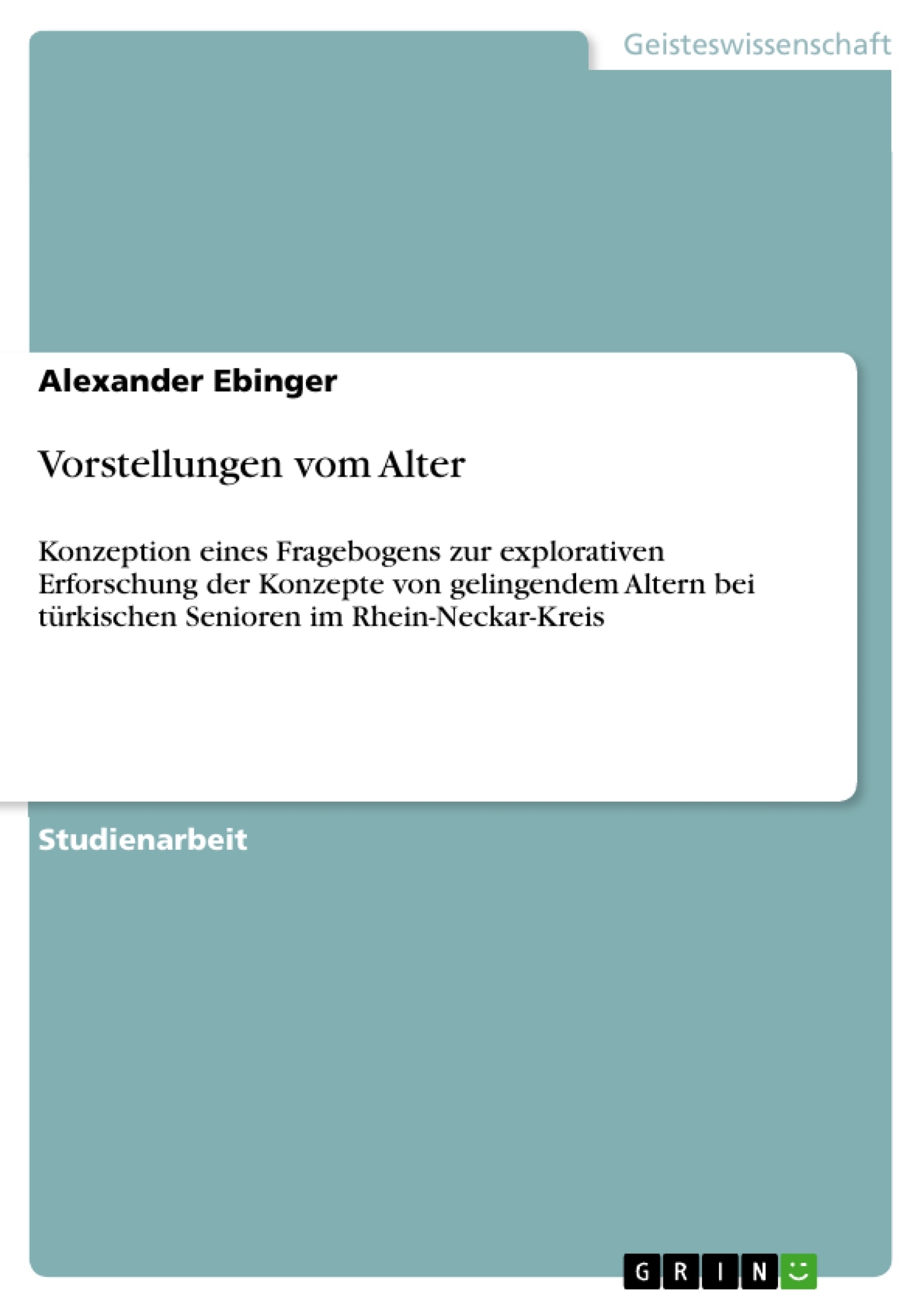Ausgehend von einem prototypisch deutschen und türkischen Verständnis von positivem Altern setzte sich unsere Arbeitsgruppe das Ziel, die Einstellungen und Wahrnehmungen der türkisch-deutschen Immigranten der ersten Generation im Hinblick auf das ‚Positive Altern‘ zu untersuchen und mit der mehrheitsdeutschen bzw. türkischen Wahrnehmung zu vergleichen. Zentral erschienen uns hierbei die Aspekte Enkulturation bzw. Retraditionalisierung. Die Auswahl der türkisch-deutschen Migranten erschien uns sinnvoll, weil sie sich als größte ethnische Gruppe in Deutschland mengenmäßig, wie auch verteilungstechnisch, gut für eine Erhebung eignen würde. Vom dargestellten Forschungsdesign mussten wir uns im Rahmen unserer Literatursichtung bald verabschieden. Weder erschloss sich uns eine prototypisch-deutsche oder -türkische Sichtweise von positivem Altern noch wäre es uns aufgrund der knappen Zeit möglich gewesen eine Erhebung zu konzipieren, die auf valide Weise vergleichbare Einstellungen und Konzepte bei türkischstämmigen Migranten in Deutschland zu Tage fördert. Die Idee eines Kulturvergleichs wurde somit zurückgestellt. Im Sinne der Machbarkeit und angesichts des fortgeschrittenen Projektplans entschieden wir uns dafür, unsere Forschung auf eine geeignete Voruntersuchung einzugrenzen. Ziel der nunmehr explorativen Studie sollte es sein, die Lebenssituation älterer türkischer Migranten im Rhein-Neckar-Gebiet anhand ausgewählter Lebensbereiche zu untersuchen und herauszufinden, welche Lebensaspekte in den Augen der Befragten die zentralen für ein gelingendes Altern sind. Die Literaturrecherche wurde auf das neue Forschungsthema ausgerichtet und konzentrierte sich auf ab diesem Zeitpunkt auf die Hintergründe und die Lebenswelt von türkischen Migranten der ersten Generation. Kapitel 1 stellt die Ergebnisse dieser Recherche dar. Nach einigen grundlegenden Informationen über türkische Migranten in Deutschland, werden die Lebenswelt und typische Problemlagen türkischer Senioren vorgestellt, die im Zuge einer Bewertung von Altern in Deutschland berücksichtigt werden müssen. Kapitel 2 stellt die wissenschaftliche Forschungsfrage dar. Kapitel 3 konkretisiert die Methode der Datenerhebung und das zu untersuchende Personenkollektiv. Kapitel 4 gibt eine Übersicht über die Themenbereiche der Untersuchung und erläutert den Fragebogen im Detail. Kapitel 5 widmet sich der kritischen Reflexion des Forschungsvorhabens, speziell der Forschungsprämissen sowie der Methodik.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort & Themenfindung
- Autorenschaft
- Themenfindung
- Türkische Einwanderer in Deutschland
- Gastarbeit und der Mythos der Rückkehr
- Türkischstämmige Senioren in Deutschland
- Problematisches Altern in der Fremde
- Forschungsanliegen
- Forschungsfrage
- Zum Begriff „Gelingendes Altern“
- Konzeption der Erhebung
- Forschungsmethode
- Zielgruppe
- Erläuterung des Fragebogens
- Inhaltliche Gliederung
- Einleitungstext
- Erläuterung der Auswahl von Fragen & Variablen
- Kritische Zusammenschau:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Fragebogens zur explorativen Erforschung von Konzepten „gelingenden Alterns“ bei türkischen Senioren im Rhein-Neckar-Kreis. Die Arbeit zielt darauf ab, die Lebenssituation älterer türkischer Migranten im Rhein-Neckar-Gebiet anhand ausgewählter Lebensbereiche zu untersuchen und herauszufinden, welche Lebensaspekte in den Augen der Befragten die zentralen für ein gelingendes Altern sind.
- Die Bedeutung von Kultur und Identität im Kontext des Alterns
- Die Herausforderungen und Chancen der Migration im Alter
- Die Rolle sozialer Unterstützungssysteme für türkische Senioren
- Die Bedeutung von Gesundheitsversorgung und Lebensqualität im Alter
- Das Verständnis von „gelingendem Altern“ aus der Perspektive türkischer Senioren
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel behandelt die Situation türkischer Einwanderer in Deutschland, inklusive der Aspekte der „Gastarbeit“ und des „Mythos der Rückkehr“, der Lebenswelt und typischen Problemlagen türkischer Senioren in Deutschland.
- Das zweite Kapitel stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor und erläutert den Begriff „Gelingendes Altern“.
- Das dritte Kapitel beschreibt die Forschungsmethode und die Zielgruppe der Untersuchung.
- Das vierte Kapitel gibt einen detaillierten Überblick über den Inhalt und die Struktur des Fragebogens.
- Das fünfte Kapitel beinhaltet eine kritische Reflexion der Forschungsvorhaben, mit besonderem Fokus auf die Forschungsprämissen und die Methodik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen „Alter“, „Migration“, „Ethnizität“, „Türkische Senioren“, „Gelingendes Altern“, „Explorative Forschung“, „Fragebogen“, „Rhein-Neckar-Kreis“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Studie über türkische Senioren?
Die explorative Studie untersucht die Lebenssituation und die Vorstellungen von „gelingendem Altern“ bei türkischen Migranten der ersten Generation im Rhein-Neckar-Gebiet.
Was bedeutet der Begriff „gelingendes Altern“ in diesem Kontext?
Es beschreibt die subjektive Wahrnehmung der Senioren darüber, welche Lebensaspekte (z. B. Gesundheit, soziale Unterstützung, Kultur) für ein zufriedenes Leben im Alter zentral sind.
Welche Rolle spielt der „Mythos der Rückkehr“?
Viele Migranten der ersten Generation lebten lange mit der Vorstellung, im Alter in die Türkei zurückzukehren. Das Verbleiben in Deutschland stellt sie vor neue Herausforderungen in der Identitätsfindung.
Welche Problemlagen sind typisch für türkische Senioren in Deutschland?
Häufige Themen sind sprachliche Barrieren im Gesundheitssystem, soziale Isolation, die Suche nach kulturell sensibler Pflege und wirtschaftliche Unsicherheiten.
Warum wurde ein Fragebogen für diese Zielgruppe entwickelt?
Da es kaum standardisierte Daten zu den spezifischen Bedürfnissen dieser Gruppe gab, dient der Fragebogen dazu, Lebensaspekte wie Enkulturation und soziale Netzwerke systematisch zu erfassen.
- Quote paper
- Alexander Ebinger (Author), 2008, Vorstellungen vom Alter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152139