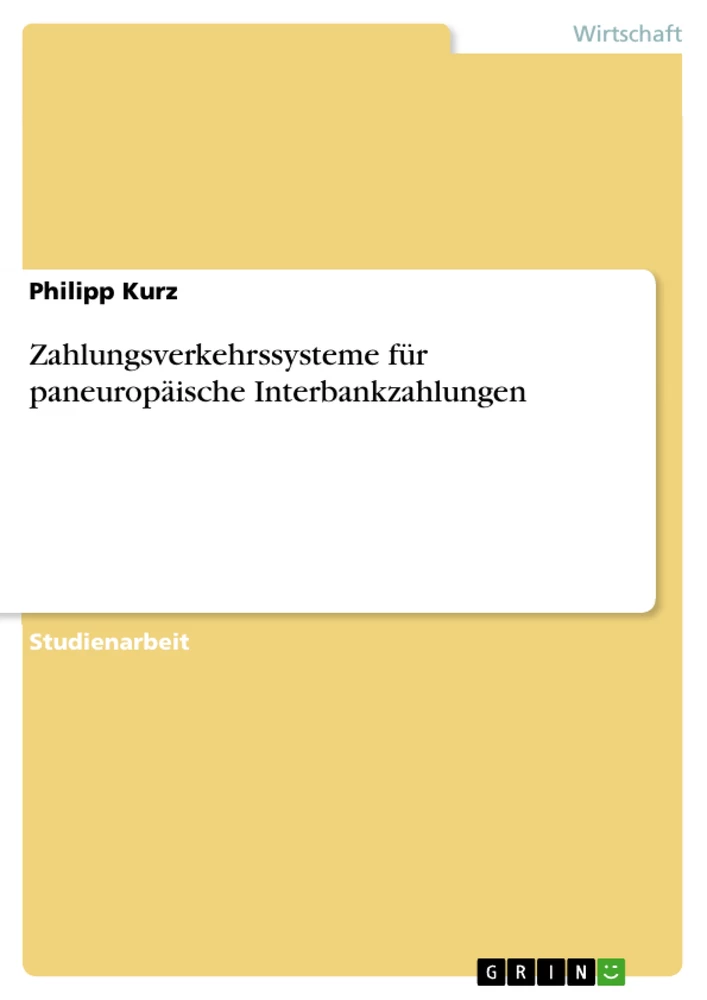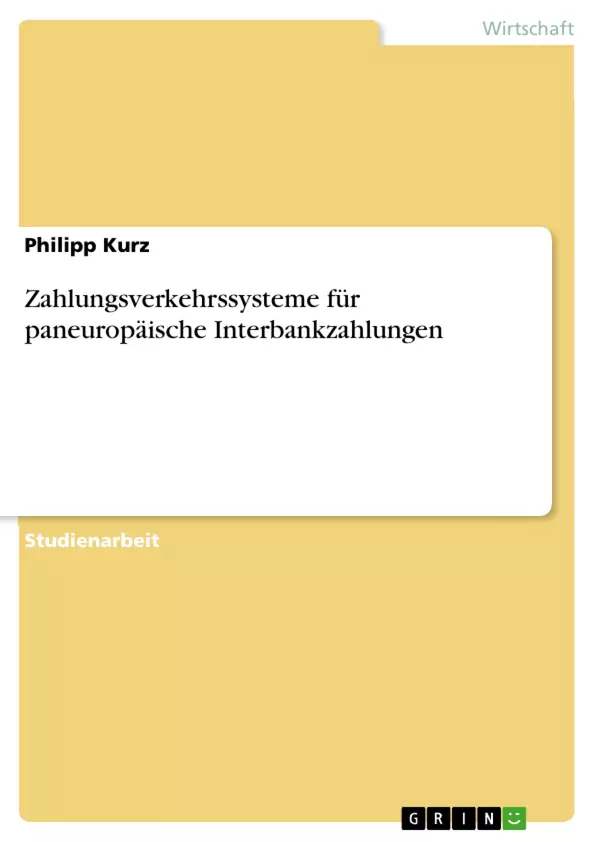Mit dem Beginn der 3. Stufe der EWU zum 01.01.1999 und der Errichtung eines einheitlichen Währungsraumes in Europa, begann auch im innereuropäischen Zahlungsverkehr ein neues Zeitalter. TARGET, das Zahlungsverkehrssystem der neuen Europäischen Zentralbank, das mit dem Start der 3. Stufe in Betrieb genommen wurde, tritt nun in den Wettbewerb mit anderen Zahlungsverkehrssystemen der nationalen Zentralbanken und der privaten Kreditwirtschaft.
Grund für die Entstehung dieses Wettbewerbs ist der Wegfall der nationalen Währungen. Die geographische Verknüpfung der Auftragswährung mit dem Abwicklungsplatz entfällt. Resultierend hieraus haben Geschäftsbanken nun die Möglichkeit, innerhalb der EU das Zahlungsverkehrsverfahren mit den für sie günstigsten Konditionen zur Abwicklung ihrer Zahlungen auszuwählen.
Im Laufe der Zeit wird die Verflechtung der EU-Güter- und Finanzmärkte weiter zunehmen und somit die Anzahl der grenzüberschreitenden Zahlungen ebenfalls steigen. International ausgerichtete Unternehmen werden immer stärker einen Zahlungsverkehrsservice fordern, der ,,der nationalen Abwicklung vergleichbar ist". Effizienz- und Preisunterschiede werden über Sieger und Verlierer in diesem Wettbewerb entscheiden. Gewinner sind zum einen die Banken, die durch geringere Kosten bei erhöhtem Service profitieren, aber auch die Kunden, die durch stark erhöhte Preistransparenz eine bessere Verhandlungsposition ihren Banken gegenüber erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Abkürzungsverzeichnis
- II. Darstellungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Hinführung
- 1.2 Aufbau und Ziel der Arbeit
- 1.3 Erläuterung zur Auswahl der dargestellten Zahlungsverkehrssysteme
- 2 Die 3. Stufe der Europäischen Währungsunion
- 2.1 Das Europäische Währungsinstitut
- 2.2 Allgemeine Entwicklungen im innereuropäischen Zahlungsverkehr
- 2.3 Steigerung der Anforderungen an die paneuropäische Zahlungsabwicklung
- 2.4 Die Lamfalussy-Kriterien
- 3 Darstellung der wichtigsten Zahlungsverkehrssysteme in Europa
- 3.1 TARGET
- 3.1.1 Entstehung
- 3.1.2 Technische Abwicklung von Zahlungen
- 3.2 Euro-1-Clearing
- 3.2.1 Entstehung
- 3.2.2 Technische Abwicklung von Zahlungen
- 3.3 EAF2
- 3.3.1 Entstehung
- 3.3.2 Technische Abwicklung von Zahlungen
- 4 Stärken und Schwächen der Zahlungsverkehrssysteme im Vergleich
- 4.1 Ausschlaggebende Faktoren zur Auswahl von Zahlungsverkehrssystemen
- 4.1.1 Allgemeines
- 4.1.2 Zugangskriterien
- 4.1.3 Endgültigkeit der Zahlung
- 4.1.4 Liquidität
- 4.1.5 Schnelligkeit
- 4.1.6 Betriebszeiten
- 4.1.7 Kosten
- 4.2 Ansätze zur effizienten Nutzung von Unterschieden in den Leistungsmerkmalen der einzelnen Systeme
- 5 Ausblick
- 6 Anhang
- 6.1 TARGET
- 6.1.1 Darstellung 1 Transaktionsvolumina Januar 1999
- 6.1.2 Darstellung 2 Der TARGET-Projektplan
- 6.1.3 Darstellung 3: Liste der an TARGET angeschlossenen RTGS-Systeme
- 6.1.4 Darstellung 4 Die TARGET-Infrastruktur
- 6.2 EBA
- 6.2.1 Darstellung 5 Tagesausgleich der Schlußsalden bei EBA
- 6.2.2 Darstellung 6 Gesamtübersicht Stärken und Schwächen
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich wichtiger paneuropäischer Zahlungsverkehrssysteme. Die Arbeit soll die Funktionsweise der Systeme sowie deren Vor- und Nachteile beleuchten und eine Grundlage für die Auswahl des optimalen Systems für den jeweiligen Anwendungsfall schaffen. Die Arbeit berücksichtigt dabei insbesondere den Hintergrund der dritten Stufe der Europäischen Währungsunion und den damit einhergehenden neuen Anforderungen an die Zahlungsabwicklung.
- Entwicklung und Funktionsweise von TARGET, Euro-1-Clearing und EAF2
- Analyse der Stärken und Schwächen der verschiedenen Zahlungsverkehrssysteme
- Relevanz der Lamfalussy-Kriterien für die paneuropäische Zahlungsabwicklung
- Einfluss der Europäischen Währungsunion auf die Gestaltung des paneuropäischen Zahlungsverkehrs
- Bewertung der verschiedenen Systeme hinsichtlich Kriterien wie Zugang, Endgültigkeit, Liquidität, Schnelligkeit, Betriebszeiten und Kosten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit führt in das Thema paneuropäischer Zahlungsverkehrssysteme ein und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Rolle der Europäischen Währungsunion und das Europäische Währungsinstitut für die Entwicklung des paneuropäischen Zahlungsverkehrs. Es werden die wichtigsten Anforderungen an die Zahlungsabwicklung im Kontext der Währungsunion dargelegt. Im dritten Kapitel werden die drei wichtigsten Zahlungsverkehrssysteme in Europa, TARGET, Euro-1-Clearing und EAF2, detailliert vorgestellt. Hierbei wird die Entstehung, die Funktionsweise und die technischen Abläufe der Systeme beschrieben. Das vierte Kapitel analysiert die Stärken und Schwächen der verschiedenen Zahlungsverkehrssysteme und stellt die relevanten Kriterien für die Auswahl eines Systems heraus. Dabei werden Themen wie Zugangskriterien, Endgültigkeit, Liquidität, Schnelligkeit, Betriebszeiten und Kosten betrachtet. Dieses Kapitel soll dem Leser eine umfassende Grundlage für die eigenständige Bewertung von Zahlungsverkehrssystemen bieten. Kapitel 5 gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des paneuropäischen Zahlungsverkehrs und beleuchtet wichtige Trends und Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen paneuropäischer Zahlungsverkehr, TARGET, Euro-1-Clearing, EAF2, Europäische Währungsunion, Lamfalussy-Kriterien, RTGS-Systeme, Endgültigkeit der Zahlung, Liquidität, Schnelligkeit, Betriebszeiten, Kosten, Transaktionsvolumina.
Häufig gestellte Fragen
Was ist TARGET?
TARGET ist das Zahlungsverkehrssystem der Europäischen Zentralbank, das mit dem Start der 3. Stufe der Währungsunion in Betrieb genommen wurde.
Welche anderen Systeme werden neben TARGET verglichen?
Die Arbeit vergleicht TARGET mit dem Euro-1-Clearing der EBA und dem EAF2-System.
Was sind die Lamfalussy-Kriterien?
Dies sind Mindeststandards für die Sicherheit und Effizienz von grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrssystemen.
Warum entstand Wettbewerb zwischen den Zahlungsverkehrssystemen?
Durch den Wegfall nationaler Währungen können Banken nun das System wählen, das die günstigsten Konditionen für ihre Zahlungen bietet.
Nach welchen Kriterien werden die Systeme bewertet?
Die wichtigsten Faktoren sind Zugangskriterien, Endgültigkeit der Zahlung, Liquidität, Schnelligkeit, Betriebszeiten und Kosten.
Was ist ein RTGS-System?
RTGS steht für Real-Time Gross Settlement, also ein System zur Echtzeit-Bruttoabwicklung von Zahlungen, wie es bei TARGET genutzt wird.
- Citation du texte
- Philipp Kurz (Auteur), 1999, Zahlungsverkehrssysteme für paneuropäische Interbankzahlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1521