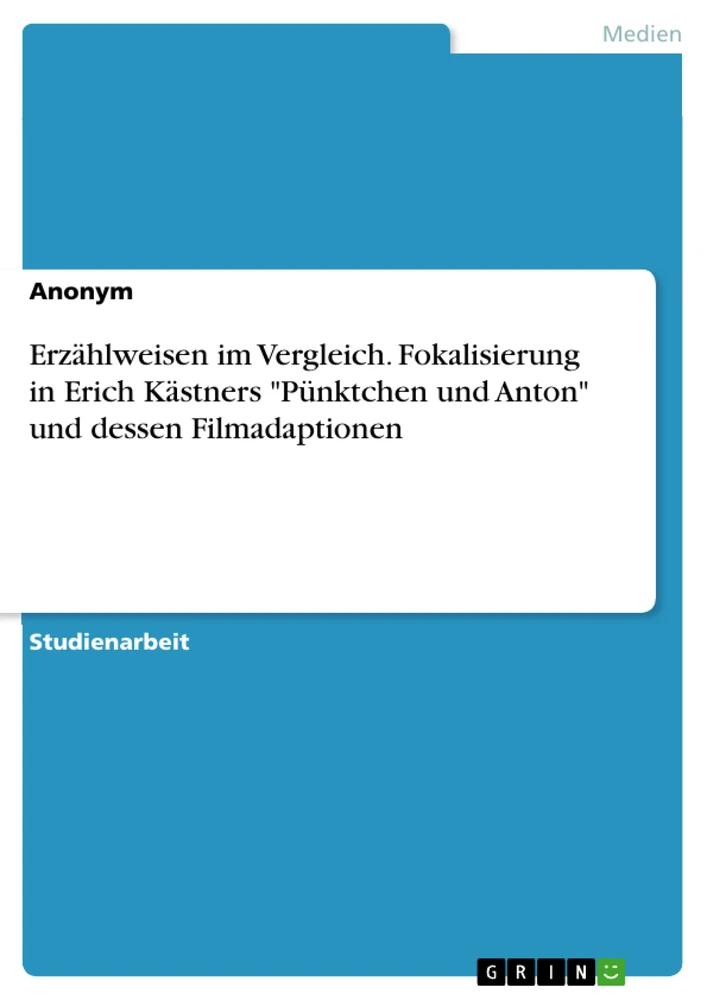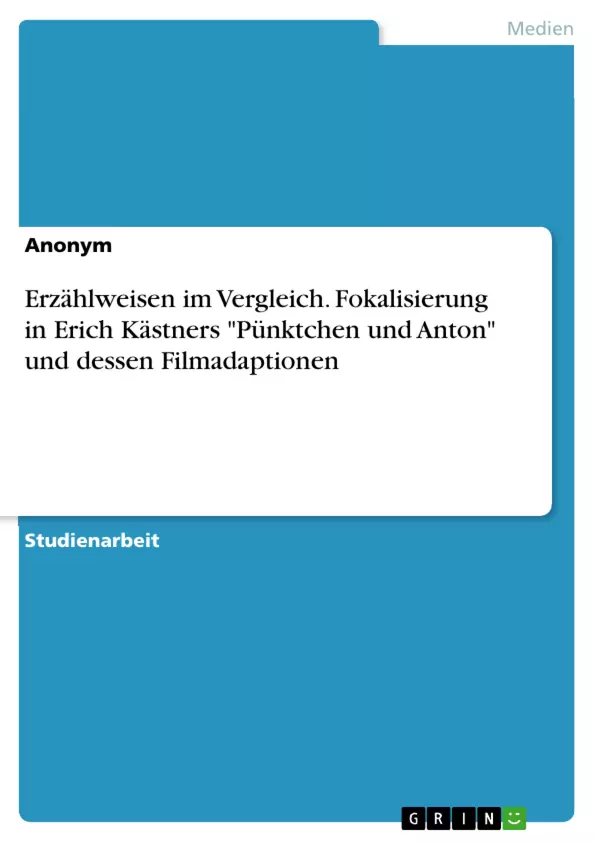Wie wird im Film erzählt? Gibt es eine Stimme, einen Erzähler? Erzählen die Figuren? In dieser Arbeit soll analysiert werden, auf welche Art und Weise im Film erzählt wird und inwiefern sich dies zur Erzählweise im Buch unterscheidet. Dafür wurden zwei Theoretiker herangezogen, die sich mit der Art der Fokalisierung im Buch, als auch mit der Erzähltheorie im Film auseinandergesetzt haben.
Erzähltheorie, Erzählanalyse sind Begriffe, die man mit aufgeschriebenen Erzählungen, Romanen und Texten in Verbindung bringt. Erzählte Geschichten kommen aber auch abseits von Büchern in anderen Medien vor wie der DVD oder im Streaming,
Daher stellt sich die Frage, wie insbesondere der Film erzählt wird.
Grundlage für die Erzählanalyse des WIE im Film im Vergleich zum Buch soll "Pünktchen und Anton" sein, hierfür wurde die 2. Auflage aus dem Jahr 2019 verwendet.
Der Kinderroman von Erich Kästner ist 1931 erschienen und handelt von Luise, die mit ihren wohlhabenden Eltern zusammenlebt. Luises Spitzname ist Pünktchen, nachfolgend wird in dieser Arbeit entweder Pünktchen oder Luise verwendet. Sie hat sich noch nie darum Sorgen gemacht, dass sie genug zu essen bekommt. Ganz anders als ihr Freund Anton, der sich gemeinsam mit seiner Mutter eine kleine Wohnung teilt und jeden Cent umdrehen muss, damit er warme Kleider und abends eine warme Mahlzeit hat. Luise und Anton kümmern sich darum, dass es Anton und seiner Mutter besser geht und sie nicht mehr in Not sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Fokalisierungsbegriff
- Fokalisierung nach Gérard Genette
- Fokalisierung im Film nach Markus Kuhn
- Pünktchen und Anton - Szene im Buch
- Die Szenen im Film
- Wie wird im Film dargestellt?
- Die Szene im Film 1999
- Die Szene im Film 1953
- Vergleich
- Vergleich zwischen der Buchszene und der Szene im Film 1999
- Vergleich zwischen den beiden Filmszenen 1953 und 1999
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Erzählweise in Erich Kästners "Pünktchen und Anton" im Vergleich zu zwei Verfilmungen (1953 und 1999). Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Erzählperspektiven im Buch und den Filmen mithilfe der Fokalisierungstheorien von Gérard Genette und Markus Kuhn zu untersuchen.
- Vergleich der Fokalisierung in Buch und Film
- Anwendung von Genettes Fokalisierungstypen auf "Pünktchen und Anton"
- Anwendung von Kuhns filmischen Fokalisierungskonzept
- Analyse der visuellen und narrativen Unterschiede zwischen den Filmadaptionen
- Untersuchung der Auswirkungen unterschiedlicher Erzählweisen auf die Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Erzählanalyse in Buch und Film ein und benennt "Pünktchen und Anton" als Untersuchungsgegenstand. Sie stellt die Frage nach den unterschiedlichen Erzählweisen im Buch und den beiden Verfilmungen (1953 und 1999) und kündigt die Heranziehung der Theorien von Genette und Kuhn an. Die Einleitung stellt den Kontext dar, indem sie den Roman kurz beschreibt und auf die Unterschiede zwischen Buch und Filmen hinweist, beispielsweise die veränderte Darstellung der Elternfiguren in den Verfilmungen.
2. Der Fokalisierungsbegriff: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es stellt die Fokalisierungstheorie von Gérard Genette vor, die drei Fokalisierungstypen (Nullfokalisierung, externe und interne Fokalisierung) unterscheidet und deren jeweilige Charakteristika erläutert. Es wird auf die verschiedenen Kategorien der internen Fokalisierung eingegangen (fest, variabel, multiplikativ) und kritische Aspekte der Theorie diskutiert. Die Ausführungen liefern ein fundiertes Verständnis des Konzepts der Fokalisierung als Grundlage für die spätere Analyse.
2.2 Fokalisierung im Film nach Markus Kuhn: Dieses Kapitel erweitert den Fokus auf die filmische Erzählweise. Es präsentiert Markus Kuhns Theorie der filmischen Fokalisierung, die die vergleichende Analyse von Literatur und Film ermöglicht. Kuhn verbindet Fokalisierung mit Wissensrelationen zwischen Erzählinstanz und Figur und bezieht visuelle (Okularisierung) und auditive (Aurikularisierung) Aspekte mit ein. Die Kapitel erläutert die drei Fokalisierungstypen analog zu Genette und betont die Relevanz visueller und auditiver Mittel für die filmische Erzählweise.
3. Pünktchen und Anton - Szene im Buch: Dieses Kapitel analysiert eine spezifische Szene aus dem Buch "Pünktchen und Anton" unter Anwendung der zuvor vorgestellten Fokalisierungstheorien. Es wird detailliert untersucht, welche Fokalisierungstypen Genette in der ausgewählten Szene verwendet und wie diese die Erzählung prägen. Die Analyse liefert eine detaillierte Beschreibung der Erzählperspektive im Roman.
4. Die Szenen im Film: Dieses Kapitel widmet sich den filmischen Adaptionen. Es untersucht die ausgewählte Szene in den Verfilmungen von 1953 und 1999 anhand von Kuhns Modell. Der Vergleich konzentriert sich darauf, wie die visuelle und auditive Gestaltung der Szene die Fokalisierung beeinflusst und wie sich die filmischen Erzählweisen von der literarischen Vorlage unterscheiden. Die Analyse umfasst sowohl die Unterschiede zwischen den beiden Verfilmungen als auch den Vergleich zu dem Originaltext.
5. Vergleich: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorherigen Kapitel gegenübergestellt. Die Analyse konzentriert sich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Fokalisierung in der literarischen Vorlage und den zwei filmischen Adaptionen. Die detaillierte Gegenüberstellung der drei Varianten zeigt auf, wie die Wahl der Fokalisierung die Rezeption und Interpretation der Geschichte beeinflusst.
Schlüsselwörter
Erzähltheorie, Fokalisierung, Gérard Genette, Markus Kuhn, Filmanalyse, Literaturvergleich, Pünktchen und Anton, Erich Kästner, Erzählperspektive, visuelle Erzählung, Okularisierung, Aurikularisierung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von "Pünktchen und Anton"?
Die Analyse vergleicht die Erzählweise in Erich Kästners "Pünktchen und Anton" mit zwei Verfilmungen (1953 und 1999). Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Erzählperspektiven im Buch und den Filmen mithilfe der Fokalisierungstheorien von Gérard Genette und Markus Kuhn zu untersuchen.
Welche Fokalisierungstheorien werden verwendet?
Die Analyse basiert hauptsächlich auf den Fokalisierungstheorien von Gérard Genette und Markus Kuhn. Genette unterscheidet drei Fokalisierungstypen (Nullfokalisierung, externe und interne Fokalisierung). Kuhn erweitert diesen Ansatz für den Film und bezieht visuelle (Okularisierung) und auditive (Aurikularisierung) Aspekte mit ein.
Was sind die Hauptthemen der Analyse?
Die Hauptthemen sind der Vergleich der Fokalisierung in Buch und Film, die Anwendung von Genettes Fokalisierungstypen auf "Pünktchen und Anton", die Anwendung von Kuhns filmischen Fokalisierungskonzept, die Analyse der visuellen und narrativen Unterschiede zwischen den Filmadaptionen und die Untersuchung der Auswirkungen unterschiedlicher Erzählweisen auf die Rezeption.
Welche Kapitel sind in der Analyse enthalten?
Die Analyse umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Der Fokalisierungsbegriff (mit Unterpunkten zu Genette und Kuhn), Pünktchen und Anton - Szene im Buch, Die Szenen im Film (mit Unterpunkten zur Darstellung im Film, der Szene im Film 1999 und der Szene im Film 1953), Vergleich (zwischen Buch- und Filmszene 1999, sowie zwischen den Filmszenen 1953 und 1999), und ein Fazit.
Welche spezifische Szene aus "Pünktchen und Anton" wird analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf eine spezifische Szene aus dem Buch "Pünktchen und Anton" und deren Adaptionen in den Filmen von 1953 und 1999. Die genaue Szene wird durch Anwendung der Fokalisierungstheorien untersucht, um die Erzählperspektiven zu vergleichen.
Was sind die Schlüsselwörter der Analyse?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Erzähltheorie, Fokalisierung, Gérard Genette, Markus Kuhn, Filmanalyse, Literaturvergleich, Pünktchen und Anton, Erich Kästner, Erzählperspektive, visuelle Erzählung, Okularisierung, Aurikularisierung.
Wie wird die Fokalisierung im Film analysiert?
Die Fokalisierung im Film wird anhand von Markus Kuhns Theorie analysiert, die visuelle (Okularisierung) und auditive (Aurikularisierung) Aspekte berücksichtigt. Es wird untersucht, wie die filmische Gestaltung die Erzählperspektive beeinflusst und sich von der literarischen Vorlage unterscheidet.
Was wird im Kapitel "Vergleich" analysiert?
Im Kapitel "Vergleich" werden die Ergebnisse der vorherigen Kapitel gegenübergestellt, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Fokalisierung in der literarischen Vorlage und den filmischen Adaptionen zu analysieren. Es wird untersucht, wie die Wahl der Fokalisierung die Rezeption und Interpretation der Geschichte beeinflusst.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2024, Erzählweisen im Vergleich. Fokalisierung in Erich Kästners "Pünktchen und Anton" und dessen Filmadaptionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1522772