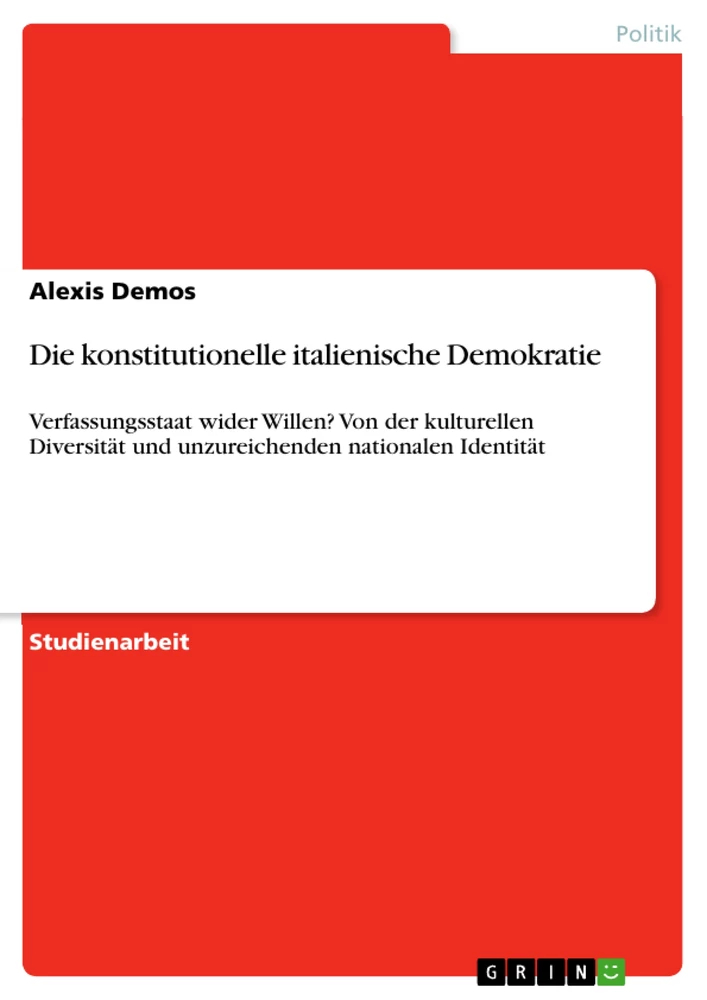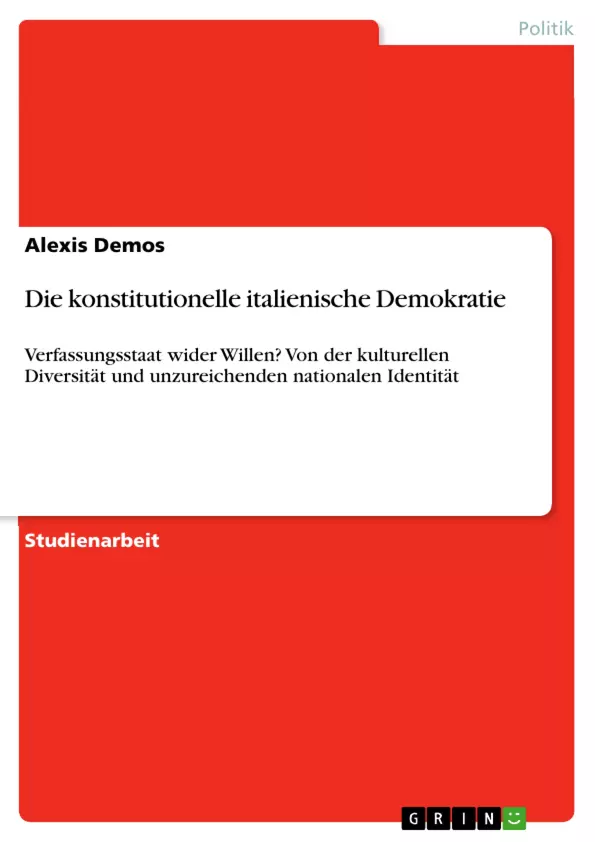Der Diktatur folgt Demokratie, so das Credo dreier großer Demokratisierungswellen, doch was folgt auf die Demokratie? Können Populismen und Neopatrimonialismen heutzutage als grundsätzliche Tendenzen dieser politischen Systeme gelten, so muss gesagt werden, dass das politische System Italiens mit dessen Paradoxien einen Sonderfall darstellt. Es sind Fragen nach der Legitimität und Effizienz, der institutionellen Struktur, der politischen Partizipation und den formalen Prozeduren und inhaltlichen Entscheidungen, die über den Gehalt einer Demokratie entscheiden. Ausgehend von der Fragestellung, wonach sich dieser inhomogene und inkonstante Nationalcharakter mit der konstitutionellen Demokratie und dem Einheitsstaat kleidet, sollen nicht nur die Auswirkungen der Diskrepanz von Verfassungstext und Verfassungspraxis auf den italienischen Staat aufgezeigt, sondern auch deduktiv der Ursprung der gespaltenen politischen Kultur und schwachen nationalen Identität ergründen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Potential italienischer Geschichte zur nationalen Einheit
- Risorgimento als Ursprung nationaler Identität?
- Der Faschismus als triumphaler Höhepunkt der Nationalgeschichte
- Die blockierte Demokratie Italiens
- Die demokratischen Fesseln der Ersten Republik
- Die Zweite Republik - Politischer Wandel und historische Kontinuität
- Die Zivilgesellschaft – horizontale Solidarität statt vertikale Loyalität
- Konzeptlosigkeit des aktivierenden Staates
- Demokratische Krise oder postdemokratisches Phänomen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen der konstitutionellen italienischen Demokratie und der politischen Realität. Sie analysiert die Ursachen der schwachen nationalen Identität und der gespaltenen politischen Kultur Italiens, indem sie historische Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen beleuchtet.
- Das Potential (oder Fehlen desselben) italienischer Geschichte zur nationalen Einheit
- Die Pathologien der Ersten Republik und der Einfluss von Subkulturen
- Der Einfluss des Mediencharismatischen Modells Berlusconis in der Zweiten Republik
- Das Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft
- Die Frage nach den Ursachen der andauernden politischen Krise Italiens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis zwischen der konstitutionellen italienischen Demokratie und dem inhomogenen Nationalcharakter. Sie argumentiert, dass die italienische Verfassung einen Kompromisscharakter aufweist, der die antikonstitutionell agierenden Subkulturen zu kompensieren versucht. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Diskrepanz zwischen Verfassungstext und -praxis und ergründet den Ursprung der gespaltenen politischen Kultur und der schwachen nationalen Identität. Es wird die demokratietheoretische Brisanz des Scheiterns der Ersten Republik und die Bedeutung der erneuten Wahl Berlusconis diskutiert, wobei verschiedene Perspektiven auf die italienische Demokratie einander gegenübergestellt werden. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die einzelnen Kapitel.
Das Potential italienischer Geschichte zur nationalen Einheit: Dieses Kapitel untersucht die soziokulturellen Vorbedingungen für eine stabile liberaldemokratische Ordnung und den Zusammenhang zwischen Identitätsbildung und Wertekonsens. Es betont die Bedeutung der Konstitutionalisierung eines politischen Raumes und der Entwicklung einer Verfassungskultur. Das Kapitel analysiert das Problem der italienischen nationalen Identität, die stark kulturell und sprachlich geprägt ist und deren Herausbildung durch die regionale Vielfalt und die späte staatliche Einigung im Jahr 1861 behindert wurde. Die Romantisierung des Risorgimento und die Verklärung der regionalen Orientierungen und der heterogenen Nationalbewegung werden kritisch beleuchtet.
Die blockierte Demokratie Italiens: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen der italienischen Demokratie, beginnend mit den "demokratischen Fesseln" der Ersten Republik und der Analyse der Zweiten Republik als Periode sowohl des politischen Wandels als auch historischer Kontinuität. Die Kapitel untersuchen die institutionellen, sozialen und kulturellen Faktoren, die die Stabilität und Effizienz der italienischen Demokratie beeinträchtigen. Dabei werden die verschiedenen politischen und sozialen Strömungen sowie die Rolle der Medien diskutiert. Die Kapitel analysieren die Schwierigkeiten, eine starke nationale Identität und einen Konsens über grundlegende Werte zu entwickeln.
Die Zivilgesellschaft – horizontale Solidarität statt vertikale Loyalität: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Zivilgesellschaft in Italien und deren Verhältnis zum Staat. Es beleuchtet die "Konzeptlosigkeit des aktivierenden Staates" und untersucht, ob die italienische politische Krise als demokratische Krise oder als postdemokratisches Phänomen zu verstehen ist. Es wird die Frage der "Patron-Client-Relations" und des Klientelismus sowie deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Zivilgesellschaft erörtert. Die Kapitel beleuchtet die verschiedenen Perspektiven auf das Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft und deren Bedeutung für die innere Erneuerung Italiens.
Schlüsselwörter
Italienische Demokratie, Nationale Identität, Verfassungskultur, Politische Kultur, Risorgimento, Faschismus, Erste Republik, Zweite Republik, Zivilgesellschaft, Klientelismus, Populismus, Neopatrimonialismus, Verfassungspraxis, Demokratiedefizit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Analyse der italienischen Demokratie
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Diskrepanz zwischen der konstitutionellen italienischen Demokratie und der politischen Realität. Sie untersucht die Ursachen der schwachen nationalen Identität und der gespaltenen politischen Kultur Italiens, indem sie historische Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen beleuchtet.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit untersucht das Potential (oder dessen Fehlen) italienischer Geschichte zur nationalen Einheit, die Pathologien der Ersten Republik und den Einfluss von Subkulturen, den Einfluss des Mediencharismatischen Modells Berlusconis in der Zweiten Republik, das Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft und die Ursachen der andauernden politischen Krise Italiens.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zum Potential italienischer Geschichte für nationale Einheit, zur blockierten italienischen Demokratie (mit Fokus auf Erste und Zweite Republik), zur Rolle der Zivilgesellschaft und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Thematik.
Welche Rolle spielt die italienische Geschichte?
Die Arbeit untersucht, inwiefern das Risorgimento und der Faschismus die nationale Identität geprägt haben und ob die italienische Geschichte überhaupt ein Potential zur nationalen Einheit bietet. Die regionale Vielfalt und die späte staatliche Einigung werden kritisch beleuchtet.
Wie wird die "blockierte Demokratie" Italiens beschrieben?
Die "blockierte Demokratie" wird durch die Analyse der "demokratischen Fesseln" der Ersten Republik und der Zweiten Republik als Periode des politischen Wandels und historischer Kontinuität beschrieben. Institutionelle, soziale und kulturelle Faktoren, die die Stabilität und Effizienz der italienischen Demokratie beeinträchtigen, werden untersucht.
Welche Bedeutung hat die Zivilgesellschaft?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Zivilgesellschaft in Italien und ihr Verhältnis zum Staat. Die "Konzeptlosigkeit des aktivierenden Staates" wird beleuchtet, und es wird untersucht, ob die Krise als demokratische Krise oder postdemokratisches Phänomen zu verstehen ist. Die Rolle von "Patron-Client-Relations" und Klientelismus wird ebenfalls erörtert.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Analyse?
Schlüsselbegriffe sind: Italienische Demokratie, Nationale Identität, Verfassungskultur, Politische Kultur, Risorgimento, Faschismus, Erste Republik, Zweite Republik, Zivilgesellschaft, Klientelismus, Populismus, Neopatrimonialismus, Verfassungspraxis und Demokratiedefizit.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist das Verhältnis zwischen der konstitutionellen italienischen Demokratie und dem inhomogenen Nationalcharakter. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Diskrepanz zwischen Verfassungstext und -praxis.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine historisch-vergleichende Methode, die historische Entwicklungen mit aktuellen Herausforderungen verbindet, um die Ursachen der schwachen nationalen Identität und der gespaltenen politischen Kultur Italiens zu analysieren.
- Citar trabajo
- Alexis Demos (Autor), 2008, Die konstitutionelle italienische Demokratie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152332