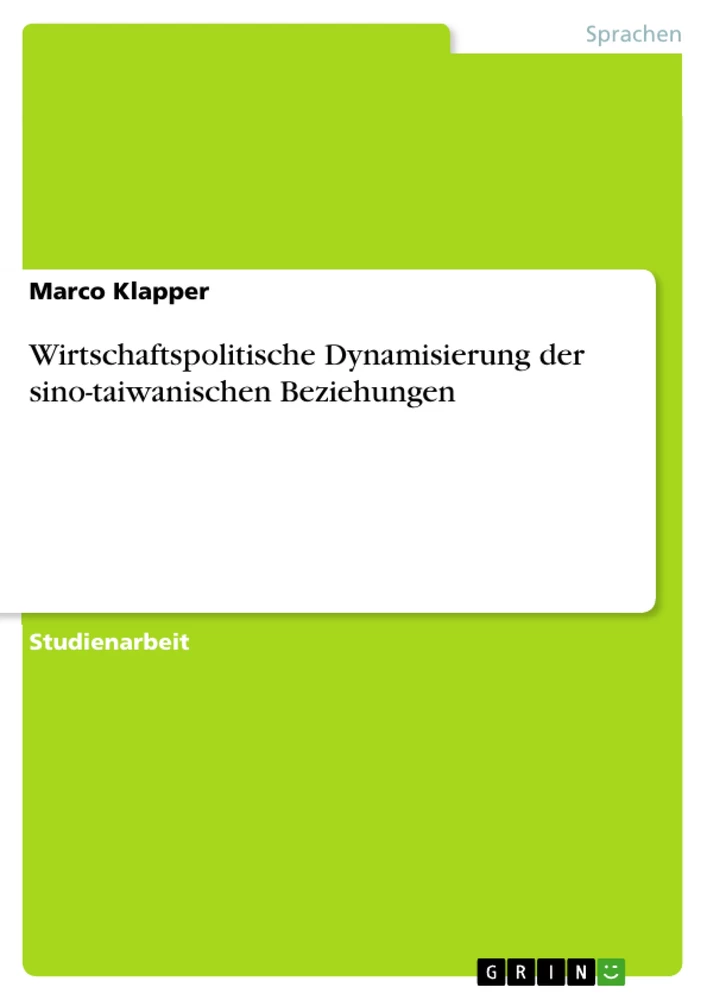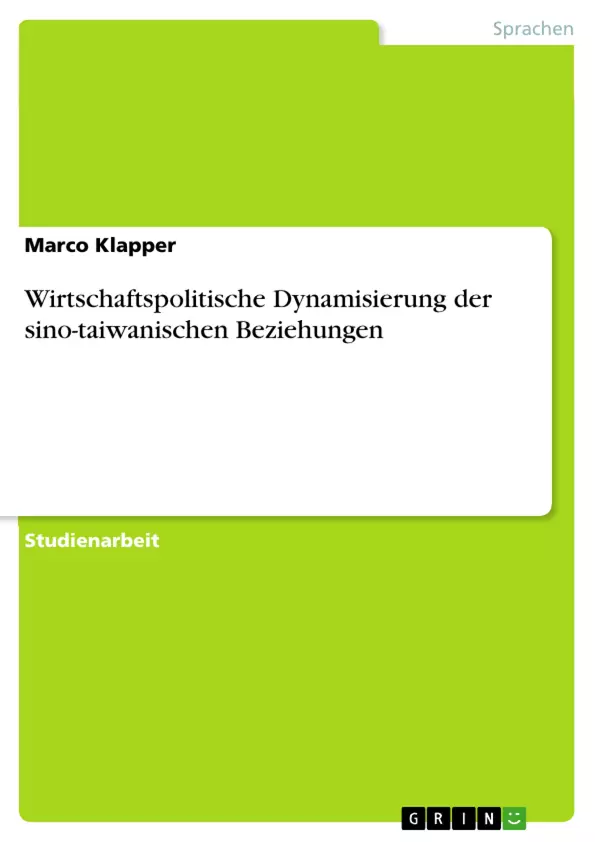Diese Facharbeit untersucht, inwieweit die politische Annäherung zwischen der Volksrepublik China und der Republik China auf Taiwan - insbesondere die (semi-)offiziellen, bilateralen Verhandlungen seit Anfang der neunziger Jahre - Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans und dessen Verflechtung mit dem Festland hatten.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung und methodische Vorgehensweise
- Erläuterungen zum Taiwan-Konflikt
- Das Ein-China-Prinzip
- Rolle der USA
- Wirtschaftliche Entwicklung und politische Annäherung
- Taiwans Aufstieg zum „Tigerstaat“
- Beginn des Cross-Strait Handels
- Politische Annäherung seit 1987
- Koo-Wang Gespräche
- Chiang-Chen Gespräche
- Die Verhandlungen und ihre wirtschaftspolitischen Implikationen
- Erste Verhandlungsphase unter Li Deng-hui
- Quantitative Beurteilung
- Qualitative Beurteilung
- Politische Isolation unter Chen Shui-bian
- Wiederaufnahme der SEF-ARATS Gespräche unter Ma Ying-jiu
- Erste Verhandlungsphase unter Li Deng-hui
- Ergebnisse und Ausblick
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Dynamisierung der sino-taiwanischen Beziehungen im Kontext der politischen Verhandlungen zwischen der Volksrepublik China und der Republik China auf Taiwan. Die Arbeit analysiert, welchen Einfluss die politische Annäherung beider Seiten auf die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans und dessen Verflechtung mit dem Festland hatte. Dabei wird untersucht, inwieweit wirtschaftspolitische Maßnahmen und Deregulierungstendenzen als direkte Folgen politischer Verhandlungen anzusehen sind oder ob der strukturelle Wandel und die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs als primäre Quellen dieses Prozesses betrachtet werden müssen.
- Die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans im Kontext des Taiwan-Konflikts
- Die Rolle der politischen Verhandlungen in der Dynamisierung der sino-taiwanischen Wirtschaftsbeziehungen
- Die Auswirkungen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Deregulierungstendenzen auf die taiwanische Wirtschaft
- Der Einfluss des globalen Wettbewerbs auf die sino-taiwanischen Wirtschaftsbeziehungen
- Die Bedeutung des Ein-China-Prinzips für die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Taiwan
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und erläutert die methodische Vorgehensweise. Sie beleuchtet die jüngere Geschichte Taiwans, die geprägt ist von politischen Konflikten, einer bemerkenswerten wirtschaftlichen Entwicklung und dem friedlichen Wandel von einem autoritären Herrschaftssystem zu einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft. Die Einleitung führt in den Taiwan-Konflikt ein und erklärt das Ein-China-Prinzip.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung Taiwans und der politischen Annäherung zwischen China und Taiwan. Es beschreibt den Aufstieg Taiwans zum „Tigerstaat“ und den Beginn des Cross-Strait Handels. Außerdem werden die politischen Annäherungsversuche seit 1987, insbesondere die Koo-Wang Gespräche und die Chiang-Chen Gespräche, beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert die Verhandlungen zwischen China und Taiwan und ihre wirtschaftspolitischen Implikationen. Es untersucht die erste Verhandlungsphase unter Li Deng-hui, die politische Isolation unter Chen Shui-bian und die Wiederaufnahme der SEF-ARATS Gespräche unter Ma Ying-jiu.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die sino-taiwanischen Beziehungen, die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans, die politische Annäherung zwischen China und Taiwan, das Ein-China-Prinzip, die wirtschaftspolitischen Implikationen der Verhandlungen, der globale Wettbewerb und die Deregulierungstendenzen. Die Arbeit analysiert die Dynamisierung der sino-taiwanischen Beziehungen im Kontext der politischen Verhandlungen und untersucht den Einfluss dieser Verhandlungen auf die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Facharbeit?
Die Arbeit untersucht die wirtschaftspolitische Dynamisierung der Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und Taiwan, insbesondere den Einfluss politischer Annäherung auf die wirtschaftliche Verflechtung.
Was bedeutet das „Ein-China-Prinzip“ in diesem Kontext?
Das Ein-China-Prinzip ist eine grundlegende politische Doktrin, die besagt, dass es nur ein rechtmäßiges China gibt, was die diplomatischen Beziehungen beider Seiten maßgeblich beeinflusst.
Welche Rolle spielten die Koo-Wang- und Chiang-Chen-Gespräche?
Dies waren (semi-)offizielle bilaterale Verhandlungen, die seit den 1990er Jahren wichtige Meilensteine in der politischen und wirtschaftlichen Annäherung darstellten.
Wie entwickelte sich Taiwan zum „Tigerstaat“?
Die Arbeit beleuchtet Taiwans rasanten wirtschaftlichen Aufstieg und den späteren Beginn des Handels über die Taiwan-Straße (Cross-Strait Handel) ab 1987.
Welchen Einfluss hatte der globale Wettbewerb auf diese Beziehung?
Es wird analysiert, ob die wirtschaftliche Verflechtung primär eine Folge politischer Verhandlungen oder eher eine Reaktion auf den strukturellen Wandel im globalen Wettbewerb war.
Wie unterschied sich die Politik unter Chen Shui-bian von der unter Ma Ying-jiu?
Unter Chen Shui-bian kam es zu einer Phase politischer Isolation, während unter Ma Ying-jiu die SEF-ARATS-Gespräche wieder aufgenommen wurden.
- Quote paper
- Marco Klapper (Author), 2010, Wirtschaftspolitische Dynamisierung der sino-taiwanischen Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152338