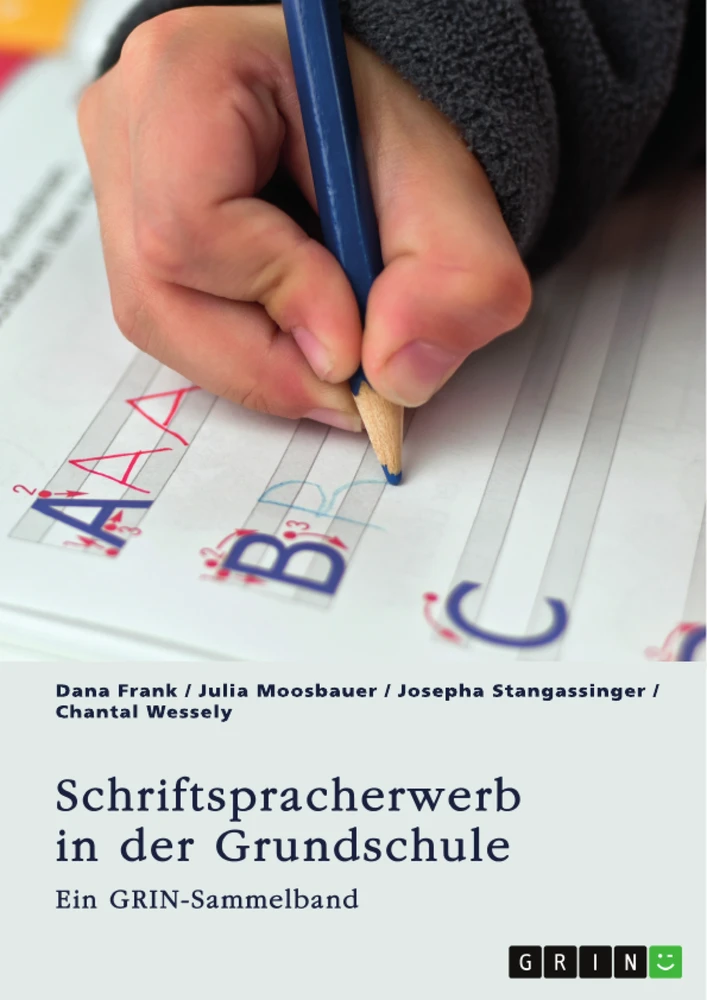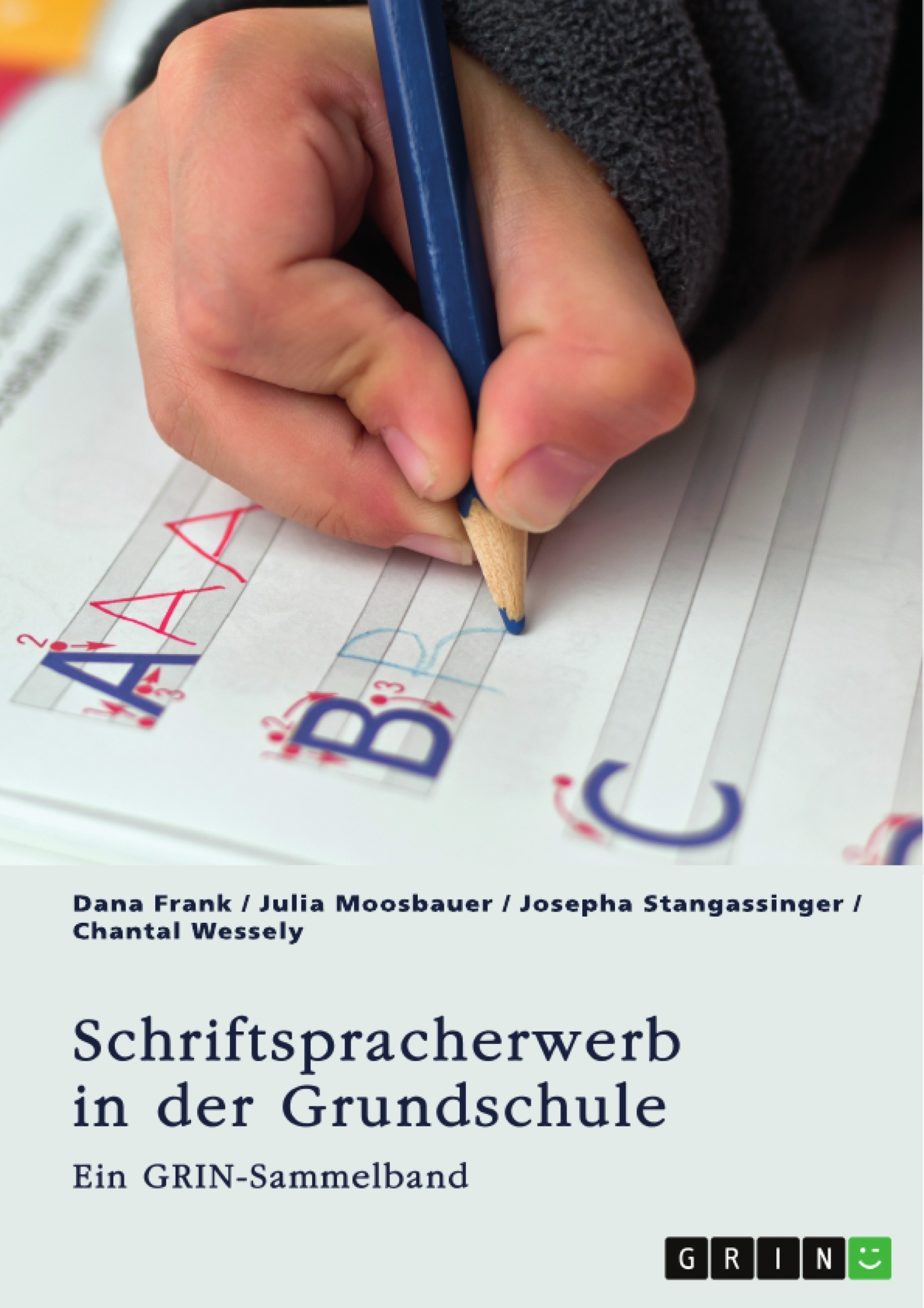Dieser Sammelband besteht aus vier Einzelpublikationen.
Die erste Arbeit thematisiert die Folgen herrschender Bildungsbenachteiligung und soziokultureller Diskrepanzen besonders auf das Grundschulfach Deutsch. Sie untersucht, vor welchen Hürden Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DAZ) beim Schriftspracherwerb stehen. Die Sprache dient im schulischen Kontext nicht nur als ein Medium der Verständigung, sondern auch als Instrument des Wissenserwerbs. Daher liegt in der Vermittlung (schrift-)sprachlicher Kompetenzen der Schlüssel für einen erfolgreichen Schulbesuch.
Der zweite Text beschäftigt sich mit dem Schriftspracherwerb zugrundeliegenden Theorien und stellt Stufenmodelle vor. Er beschreibt sowohl die Chancen als auch Grenzen dieser Modelle und gibt Beispiele zu Übungs- und Fördermöglichkeiten.
Die dritte Ausarbeitung untersucht das Thema des Schriftspracherwerbs. Was bedeutet Schriftspracherwerb? Woraus besteht die Schriftsprache und wie wird sie erworben?. Diese Fragen werden in dieser Arbeit geklärt. Dabei stützt sich diese wissenschaftliche Arbeit überwiegend auf die Fachliteratur von namhaften Erziehungswissenschaftlern und Pädagogen wie Agi Schründer-Lenzen, Wilhelm Grießhaber und Gerd Mannhaupt.
Der Großteil der Literatur zur phonologischen Bewusstheit befasst sich mit der vorschulischen Erfassung und Förderung von phonologischen Fähigkeiten. Die Förderung sollte allerdings mit dem Eintritt in die Grundschule nicht abgebrochen werden. Diese Hausarbeit beschäftigt sich deshalb mit der phonologischen Bewusstheit im Rahmen der Sprachentwicklung und ihrer Diagnostik und Förderung innerhalb der Grundschule.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zweitsprache
- Deutsch als Zweitsprache
- Zweitspracherwerbstheorien - Die Interdependenzhypothese von CUMMINS
- Der Stellenwert anderer Herkunftssprachen und Submersion
- Schriftspracherwerb
- Definition
- Die Rolle der Familiensprache beim Schriftspracherwerb
- Vor welchen Hürden stehen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache beim Schriftspracherwerb?
- Soziokulturelle Herkunft
- Sprachliche Besonderheiten
- Anregungen für einen Unterricht in mehrsprachigen Klassen
- Exkurs: Eine soziologische Perspektive auf die Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland
- Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen beim Schriftspracherwerb von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Sie beleuchtet die soziokulturellen und sprachlichen Faktoren, die den Schriftspracherwerb beeinflussen, und gibt Anregungen für einen inklusiven Unterricht in mehrsprachigen Klassen.
- Deutsch als Zweitsprache und ihre Herausforderungen
- Der Einfluss der Familiensprache und soziokultureller Faktoren
- Sprachliche Hürden im Schriftspracherwerb (Lautebene, Grammatik)
- Methodische Ansätze für mehrsprachigen Unterricht
- Soziologische Aspekte der Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den steigenden Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen und die damit verbundene Herausforderung des Schriftspracherwerbs für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Hürden im Schriftspracherwerb für DaZ-Kinder und den Fokus auf den Deutschunterricht in der Grundschule.
Zweitsprache: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Deutsch als Zweitsprache" und unterscheidet zwischen früher und sukzessiver Zweisprachigkeit. Es erläutert die Interdependenzhypothese von Cummins, die den Zusammenhang zwischen BICS (basic interpersonal communicative skills) und CALP (cognitive academic language proficiency) hervorhebt und die Bedeutung von CALP für den Schulerfolg betont. Schließlich wird das in Deutschland vorherrschende Submersionsmodell im Umgang mit Mehrsprachigkeit kritisch diskutiert und alternative Modelle, wie Immersion, vorgestellt.
Schriftspracherwerb: Dieses Kapitel definiert Schriftspracherwerb als einen Prozess, vergleichbar mit dem frühkindlichen Spracherwerb. Es betont die Bedeutung der Familiensprache und der frühkindlichen Literalität für den späteren Schriftspracherwerb. Es beschreibt die Hürden für DaZ-Kinder, sowohl soziokulturelle (bildungsferne Familien, sozioökonomische Deprivation) als auch sprachliche (Unterschiede im Lautbestand und der Grammatik zwischen Deutsch und anderen Sprachen, Interferenzphänomene). Die Kapitel erläutert detailliert die Schwierigkeiten auf der Lautebene (z.B. Graphem-Phonem-Korrespondenz) und der Grammatikebene. Es betont, dass Fehler beim Spracherwerb als Teil des Lernprozesses zu verstehen sind.
Anregungen für einen Unterricht in mehrsprachigen Klassen: Dieses Kapitel bietet Vorschläge für einen konstruktiven Unterricht in mehrsprachigen Klassen. Es betont die Verknüpfung von Sprachlernen und Sachlernen, den bilingualen Fachunterricht, die Aufgabenorientierung, kooperative Lernformen und die Verwendung von Materialien zur Förderung der phonologischen Bewusstheit.
Exkurs: Eine soziologische Perspektive auf die Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland: Dieser Exkurs betrachtet die Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund aus soziologischer Perspektive. Er kritisiert das selektive deutsche Schulsystem, das zu institutioneller Diskriminierung führen kann.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Mehrsprachigkeit, Familiensprache, Soziokulturelle Herkunft, Sprachliche Hürden, Phonologische Bewusstheit, Inklusiver Unterricht, Bildungsbenachteiligung, Migrationshintergrund, Submersion, Immersion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit zum Schriftspracherwerb?
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Herausforderungen beim Schriftspracherwerb von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Sie untersucht die soziokulturellen und sprachlichen Faktoren, die diesen Prozess beeinflussen, und bietet Anregungen für einen inklusiven Unterricht in mehrsprachigen Klassen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Deutsch als Zweitsprache und ihre Herausforderungen, den Einfluss der Familiensprache und soziokultureller Faktoren, sprachliche Hürden im Schriftspracherwerb (Lautebene, Grammatik), methodische Ansätze für mehrsprachigen Unterricht und soziologische Aspekte der Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern.
Was ist das Hauptargument der Interdependenzhypothese von Cummins?
Die Interdependenzhypothese von Cummins betont den Zusammenhang zwischen BICS (basic interpersonal communicative skills) und CALP (cognitive academic language proficiency). CALP wird als entscheidend für den Schulerfolg angesehen. Die Hypothese verdeutlicht die Bedeutung der Förderung der kognitiv-akademischen Sprachbeherrschung für Kinder mit DaZ.
Was wird unter "Submersion" im Kontext von Mehrsprachigkeit verstanden?
Das in Deutschland vorherrschende Submersionsmodell im Umgang mit Mehrsprachigkeit wird kritisch diskutiert. Submersion bedeutet, dass Kinder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch in den regulären Unterricht integriert werden, ohne spezifische sprachliche Unterstützung zu erhalten. Alternative Modelle wie Immersion, bei der die Zweitsprache gezielt im Unterricht eingesetzt wird, werden vorgestellt.
Welche Hürden beim Schriftspracherwerb werden für DaZ-Kinder identifiziert?
Die Arbeit identifiziert sowohl soziokulturelle Hürden (bildungsferne Familien, sozioökonomische Deprivation) als auch sprachliche Hürden (Unterschiede im Lautbestand und der Grammatik zwischen Deutsch und anderen Sprachen, Interferenzphänomene). Schwierigkeiten auf der Lautebene (z.B. Graphem-Phonem-Korrespondenz) und der Grammatikebene werden detailliert erläutert.
Welche Anregungen werden für einen Unterricht in mehrsprachigen Klassen gegeben?
Vorschläge für einen konstruktiven Unterricht umfassen die Verknüpfung von Sprachlernen und Sachlernen, bilingualen Fachunterricht, Aufgabenorientierung, kooperative Lernformen und die Verwendung von Materialien zur Förderung der phonologischen Bewusstheit.
Wie wird die Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund aus soziologischer Perspektive betrachtet?
Der Exkurs zur soziologischen Perspektive kritisiert das selektive deutsche Schulsystem, das zu institutioneller Diskriminierung führen kann. Die Bildungsbenachteiligung wird im Kontext struktureller Ungleichheiten analysiert.
Welche Schlüsselwörter werden im Zusammenhang mit dem Thema genannt?
Die Schlüsselwörter umfassen Schriftspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Mehrsprachigkeit, Familiensprache, Soziokulturelle Herkunft, Sprachliche Hürden, Phonologische Bewusstheit, Inklusiver Unterricht, Bildungsbenachteiligung, Migrationshintergrund, Submersion und Immersion.
- Quote paper
- GRIN Verlag (Hrsg.) (Editor), Dana Frank (Author), Julia Moosbauer (Author), Josepha Stangassinger (Author), Chantal Wessely (Author), 2024, Schriftspracherwerb in der Grundschule. Welche Herausforderungen und Fördermöglichkeiten gibt es?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1524114