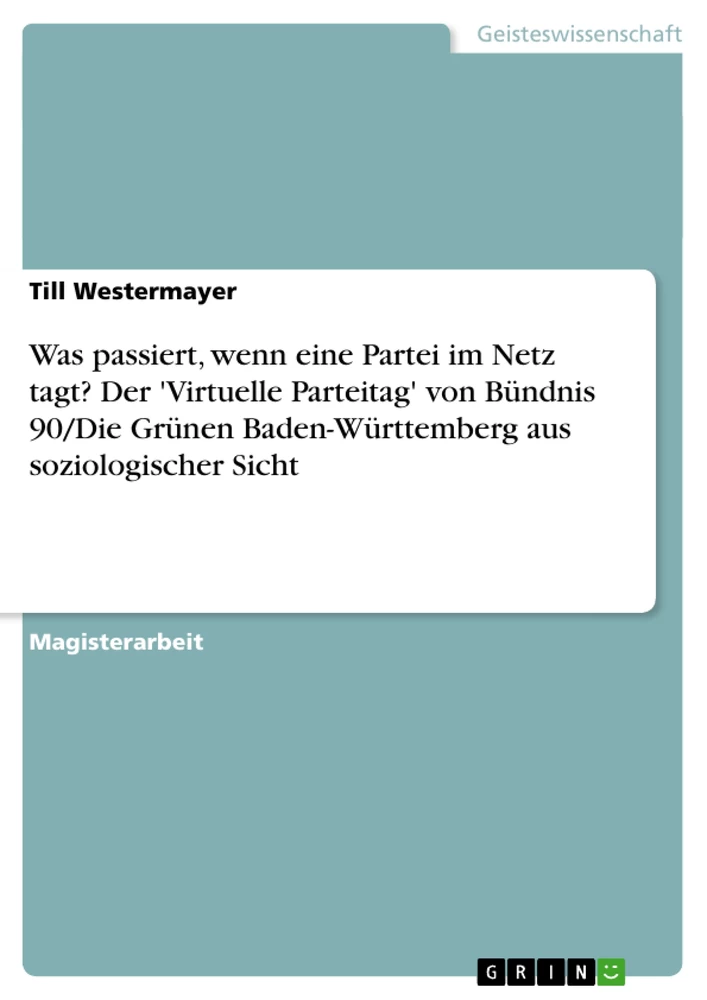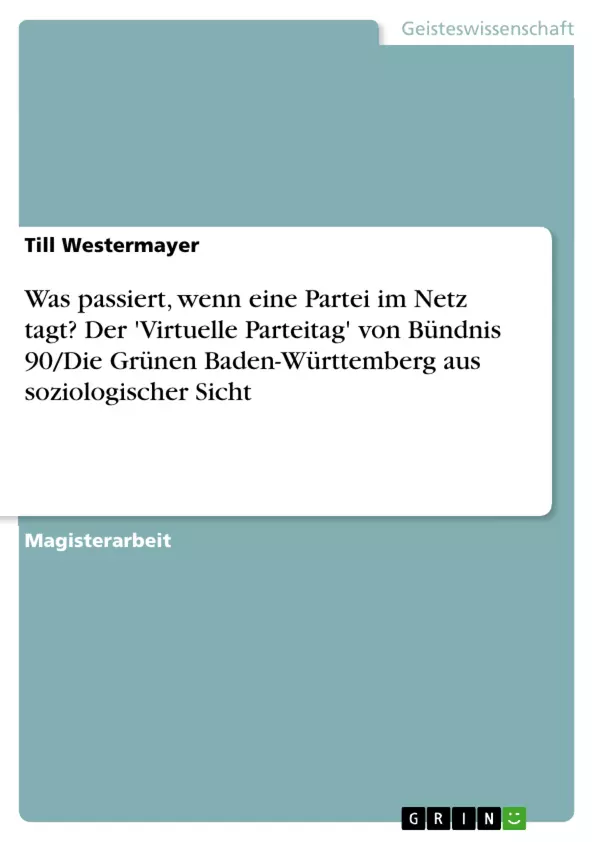So schön der Begriff ‘virtuell’ ist, so schwammig wird er, wenn er näher betrachtet wird. Der
Begriff kommt in seiner auf das Internet bezogenen Bedeutung wohl aus dem Simulationsgewerbe.
So gibt es Bezüge zu einem für die amerikanische Luftwaffe bestimmten NASA-Projekt
namens ‘Virtual Environment Display’ (VIVED), das 1987 einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt
wurde. Ca. 1988 wurde von der Firma Autodesk mit Jaron Laniers Firma VPL der Versuch
unternommen, kommerzielle grafische Immersionssysteme zu entwickeln, also Systeme,
die grafisch einer NutzerIn vorgaukeln, in eine andere Realität einzutauchen (beliebt wäre hier
der Verweis auf Gibsons Neuromancer). Diese Systeme wurden ‘Virtual Reality’ genannt.
(Chesher 1994). Anfang der 90er Jahre machte Howard Rheingold (1991) mit seinem gleichnamigen
Buch die Idee der grafische Immersion populär und zog zugleich die Verbindungslinie
zur Unterhaltungsindustrie. Sein nächstes Buch hieß dann ‘Virtual Communities’ und beschrieb
vor allem die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten des Computers zur Kommunikation (vgl.
Rheingold 1998). Der Begriff ‘virtuell’ haftet seitdem als gerne gebrauchtes Etikett nicht nur an
Unternehmen, Universitäten und Parteitagen, sondern findet sich auch in den Titeln sozialwissenschaftlicher
Literatur (vgl. Bühl 1997, Thiedeke 2000a). »’Virtual reality,’ however, has become
a cultural handle which attaches to a diversity of new ideas and technologies. While it is an inaccurate
and misleading term, it is widely used, and has assumed a meaning in its own right. It has changed
popular impressions of what technology can and should do.« (Chesher 1994).
‘Virtuell’ wurde aber nicht erst erfunden, als es darum ging, Simulationstechniken mit dem
Computer zu verbinden. Schon lange davor war von ‘virtualiter’ die Rede: [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Eine notwendige Vorbemerkung zum Begriff der Virtualität
- 1.2 Über die Erkundung unbekannter Landschaften
- 2 Rahmenbedingungen
- 2.1 Die 'Computerisierung' der Parteien
- 2.1.1 Die erste Phase der 'Computerisierung'
- 2.1.2 Die zweite Phase der 'Computerisierung'
- 2.1.3 Internetnutzung und Digital Divide
- 2.2 Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg
- 2.2.1 Struktur der Partei
- 2.2.2 Besonderheiten der Grünen in Baden-Württemberg
- 2.3 Grüne und das Internet
- 2.3.1 Die programmatische Auseinandersetzung mit Computern und neuen Medien
- 2.3.2 Die Nutzung von Computern und Internet
- 2.4 Vorgeschichte und Konzeption des Virtuellen Parteitags
- 2.4.1 Die Vorgeschichte
- 2.4.2 Die technischen und ökonomischen Rahmenbedingungen
- 2.4.3 Die Gestaltung des Virtuellen Parteitags
- 2.4.4 Präsidium und Geschäftsordnung
- 2.1 Die 'Computerisierung' der Parteien
- 3 Rekonstruktion des Virtuellen Parteitags
- 3.1 Der Virtuelle Parteitag aus Sicht der TeilnehmerInnen
- 3.1.1 Der Virtuelle Parteitag aus Sicht von A
- 3.1.2 Der Virtuelle Parteitag aus Sicht von B
- 3.1.3 Der Virtuelle Parteitag aus Sicht von C
- 3.1.4 Der Virtuelle Parteitag aus Sicht von D
- 3.2 Die Diskussionen während des Virtuellen Parteitags
- 3.2.1 Überblick über die Redelisten
- 3.2.2 Die Diskussion - zwei Beispiele
- 3.3 Zur Zeitstruktur des Virtuellen Parteitags
- 3.3.1 Die Zeitstruktur des Virtuellen Parteitags als Gesamtheit
- 3.3.2 Zeitliche Struktur des Tagesablaufs
- 3.4 Der Virtuelle Parteitag aus der Sicht der Statistik
- 3.4.1 Demographie der TeilnehmerInnen
- 3.4.2 Nutzung des Internet
- 3.4.3 Teilnahme und Beteiligung am Virtuellen Parteitag
- 3.4.4 Fazit: Statistik
- 3.5 Formen der Teilnahme und Beteiligung
- 3.5.1 Motive und Formen der Teilnahme
- 3.5.2 Formen der Beteiligung
- 3.1 Der Virtuelle Parteitag aus Sicht der TeilnehmerInnen
- 4 Zusammenstoß zweier Logiken
- 4.1 Die Logik der Partei
- 4.1.1 Kreisverbände
- 4.1.2 Delegierte
- 4.1.3 Das soziale Innenleben der Partei
- 4.1.4 Parteitage
- 4.1.5 Fazit: Parteien und Parteitage
- 4.2 Der Virtuelle Parteitag und die Logik der Partei
- 4.2.1 Handlungsrollen und Akteure
- 4.2.2 Soziale Netzwerke und persönliche Kontakte
- 4.2.3 Meinungsbildung
- 4.2.4 Inszenierung, Außenwirkung, Event-Charakter
- 4.3 Der Virtuelle Parteitag und die Logik computervermittelter Kommunikation
- 4.3.1 Die physikalische Schicht computervermittelter Kommunikation
- 4.3.2 Die Protokoll-Schicht computervermittelter Kommunikation
- 4.3.3 Die Anwendungsschicht computervermittelter Kommunikation
- 4.3.4 Der Virtuelle Parteitag als konkrete Anwendung
- 4.3.5 Die Relevanz computervermittelter Kommunikation für den Virtuellen Parteitag
- 4.4 Fallbeispiel Geschlechterverhältnis: Vermutungen
- 4.4.1 Der Anteil der Frauen und Männer im Vergleich zur LDK
- 4.4.2 Das Internet, ein Spielzeug für Jungs?
- 4.4.3 Doppelte Ungleichheit
- 4.5 Fazit: Die Logik des Virtuellen Parteitags
- 4.1 Die Logik der Partei
- 5 Schlussfolgerungen und Ausblick
- 5.1 Schlussfolgerungen
- 5.1.1 Der Virtuelle Parteitag erbringt keine politischen Sozialisationsleistungen
- 5.1.2 Zeitflexibilität und Individualisierung
- 5.1.3 Der Einfluss der Parteilogik auf die Formen der Kommunikation
- 5.1.4 Der Zusammenstoß zweier Logiken – ein nützliches Analyseinstrument?
- 5.2 Ausblick
- 5.1 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht den Virtuellen Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg im Jahr 2000. Ziel ist es, die spezifische Form dieses Parteitags anhand empirischer Daten (Interviews, Befragungen, Logfile-Analyse) zu rekonstruieren und zu erklären. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Formen der Teilnahme und Beteiligung sowie die Diskussionsstrukturen.
- Rekonstruktion des Virtuellen Parteitags anhand empirischer Daten
- Analyse verschiedener Formen der Teilnahme und Beteiligung
- Untersuchung der Diskussionsformen und -strukturen
- Erklärung der spezifischen Form des Virtuellen Parteitags durch den "Zusammenstoß zweier Logiken"
- Bewertung des Einflusses des Virtuellen Parteitags auf die soziale Binnenstruktur der Partei
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Virtuellen Parteitags ein und definiert den Begriff der Virtualität im Kontext der Arbeit. Es wird die Forschungsfrage formuliert und der methodische Ansatz skizziert.
2 Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext des Virtuellen Parteitags. Es beleuchtet die "Computerisierung" der Parteien, die Rolle des Internets im politischen Kontext, die Struktur und Besonderheiten von Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg und deren Verhältnis zum Internet. Die Vorgeschichte und Konzeption des Virtuellen Parteitags, inklusive technischer und ökonomischer Rahmenbedingungen sowie der Gestaltung und Geschäftsordnung, werden detailliert dargestellt.
3 Rekonstruktion des Virtuellen Parteitags: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es enthält vier detaillierte Fallstudien, die den Virtuellen Parteitag aus der Perspektive verschiedener TeilnehmerInnen beleuchten. Zusätzlich werden die Diskussionen, die Zeitstruktur und die statistischen Daten analysiert. Verschiedene Formen der Teilnahme und Beteiligung werden identifiziert und beschrieben.
4 Zusammenstoß zweier Logiken: In diesem Kapitel wird ein Erklärungsansatz für die spezifische Form des Virtuellen Parteitags entwickelt. Es werden die "Logik der Partei" und die "Logik computervermittelter Kommunikation" gegenübergestellt und deren Zusammenwirken im Kontext des Virtuellen Parteitags analysiert. Konkrete Beispiele, wie z.B. das Geschlechterverhältnis, veranschaulichen die Interaktion beider Logiken.
Schlüsselwörter
Virtueller Parteitag, Bündnis 90/Die Grünen, computervermittelte Kommunikation, Partei, Soziale Netzwerke, Meinungsbildung, Partizipation, Digital Divide, Grounded Theory, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen zum Virtuellen Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Magisterarbeit rekonstruiert und analysiert den Virtuellen Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg im Jahr 2000. Sie untersucht die spezifische Form dieses Parteitags anhand empirischer Daten wie Interviews, Befragungen und Logfile-Analysen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Formen der Teilnahme und Beteiligung am Virtuellen Parteitag zu analysieren, die Diskussionsstrukturen zu untersuchen und die spezifische Form des Parteitags durch den "Zusammenstoß zweier Logiken" zu erklären. Ein weiterer Fokus liegt auf der Bewertung des Einflusses des Virtuellen Parteitags auf die soziale Binnenstruktur der Partei.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Rekonstruktion des Virtuellen Parteitags anhand empirischer Daten; Analyse verschiedener Formen der Teilnahme und Beteiligung; Untersuchung der Diskussionsformen und -strukturen; Erklärung der spezifischen Form des Virtuellen Parteitags durch den "Zusammenstoß zweier Logiken"; Bewertung des Einflusses des Virtuellen Parteitags auf die soziale Binnenstruktur der Partei.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einleitung und definiert den Begriff der Virtualität. Kapitel 2 beschreibt die Rahmenbedingungen, inklusive der "Computerisierung" der Parteien, der Rolle des Internets und der Besonderheiten der Grünen in Baden-Württemberg. Kapitel 3 rekonstruiert den Virtuellen Parteitag anhand empirischer Daten, inklusive Fallstudien und statistischer Analysen. Kapitel 4 entwickelt den Erklärungsansatz des "Zusammenstoßes zweier Logiken", indem die "Logik der Partei" und die "Logik computervermittelter Kommunikation" gegenübergestellt werden. Kapitel 5 zieht Schlussfolgerungen und gibt einen Ausblick.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf empirischen Daten, die durch Interviews, Befragungen und die Analyse von Logfiles gewonnen wurden. Der methodische Ansatz beinhaltet die Rekonstruktion des Virtuellen Parteitags und die Analyse der Interaktion zwischen der "Logik der Partei" und der "Logik computervermittelter Kommunikation".
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Virtueller Parteitag, Bündnis 90/Die Grünen, computervermittelte Kommunikation, Partei, Soziale Netzwerke, Meinungsbildung, Partizipation, Digital Divide, Grounded Theory, empirische Forschung.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit liefert detaillierte Einblicke in die Funktionsweise eines virtuellen Parteitags, die Herausforderungen und Chancen dieser Form der politischen Organisation und die Interaktion zwischen Online- und Offline-Kommunikation im politischen Kontext. Die Ergebnisse zeigen den "Zusammenstoß zweier Logiken" auf und beleuchten den Einfluss der Technologie auf die soziale Binnenstruktur der Partei.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Effektivität des virtuellen Parteitags hinsichtlich politischer Sozialisationsleistungen, die Bedeutung von Zeitflexibilität und Individualisierung, den Einfluss der Parteilogik auf die Kommunikationsformen und die Nützlichkeit des "Zusammenstoßes zweier Logiken" als Analyseinstrument.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für WissenschaftlerInnen, die sich mit politischen Parteien, computervermittelter Kommunikation, Online-Partizipation und der Digitalisierung der Politik beschäftigen. Sie bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Möglichkeiten virtueller Formen der politischen Organisation.
- Citation du texte
- Till Westermayer (Auteur), 2001, Was passiert, wenn eine Partei im Netz tagt? Der 'Virtuelle Parteitag' von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg aus soziologischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15242