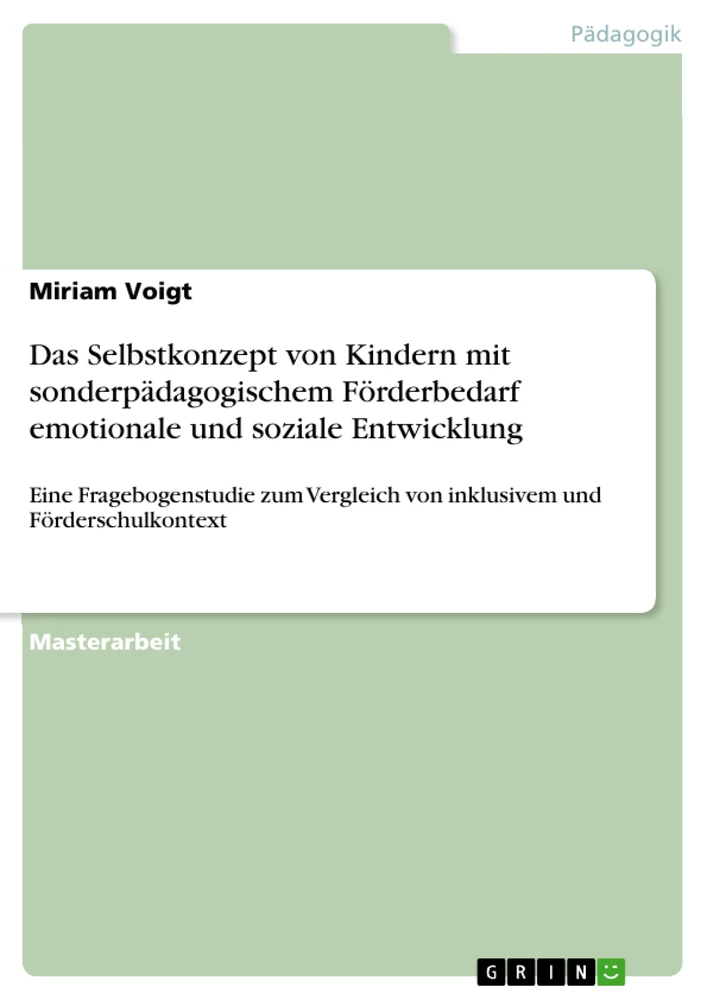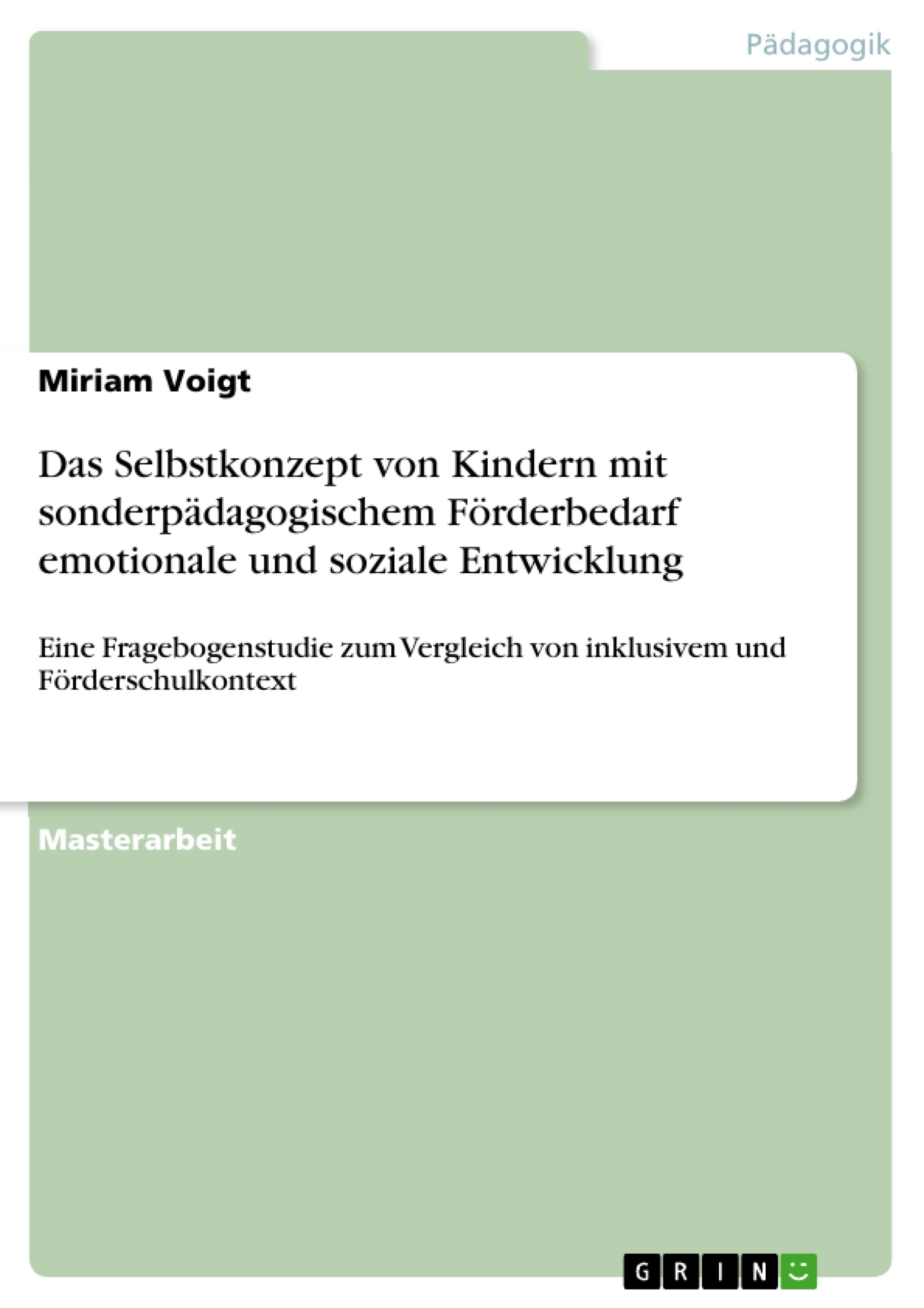Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Auswirkungen von Inklusion auf das Selbstkonzept von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) im Bereich Emotionale und soziale Entwicklung (ESE). Vor dem Hintergrund der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 und der daraufhin angestoßenen Inklusionsdebatte vergleicht die Arbeit das Selbstkonzept von Kindern in inklusiven Schulen mit dem von Kindern in Förderschulen.
Die Arbeit beginnt mit einer theoretischen Analyse der Begriffe "Förderschwerpunkt ESE", "Inklusion" und "Selbstkonzept" und beleuchtet deren Einflussfaktoren und Wechselwirkungen. Im empirischen Teil werden mittels einer Fragebogenstudie Daten von Grundschulkindern erhoben, ausgewertet und im Hinblick auf unterschiedliche Beschulungsformen sowie weitere Faktoren wie Geschlecht und Alter analysiert.
Die Ergebnisse weisen auf mögliche Unterschiede zwischen den Selbstkonzepten der Kinder in verschiedenen Bildungssettings hin, wobei Aspekte wie die soziale Integration und die schulische Unterstützung von Bedeutung sein könnten. Die Arbeit liefert Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung inklusiver Bildungsangebote und eröffnet Perspektiven für die zukünftige Forschung sowie die praktische Umsetzung inklusiver Konzepte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung
- 2.1.1 Allgemeine Begriffsbestimmung
- 2.1.2 Erscheinungswesen
- 2.1.2.1 Persönliche Ebene
- 2.1.2.2 Familiäre Ebene
- 2.1.2.3 Schulische Ebene
- 2.1.2.4 Gesellschaftliche Ebene
- 2.1.3 Klassifikation von Verhaltensstörungen
- 2.2 Inklusion
- 2.2.1 Zwischen Exklusion und Inklusion – Abgrenzung verschiedener Begrifflichkeiten
- 2.2.2 Inklusion im Bildungssystem
- 2.2.3 Lernende mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung in der Inklusion
- 2.2.4 Die Entwicklung des deutschen Schulsystems für Kinder mit SPF
- 2.3 Gegenwärtiger Stand schulischer Inklusion
- 2.3.1 Deutschland
- 2.3.2 NRW
- 2.4 Gegenwärtiger Stand der Inklusion im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung
- 2.4.1 Deutschland
- 2.4.2 NRW
- 2.5 Selbstkonzept
- 2.5.1 Allgemeine Begriffsbestimmung
- 2.5.2 Entwicklung des Selbstkonzepts
- 2.5.3 Einflussfaktoren auf das Selbstkonzept
- 2.5.4 Selbstkonzept und schulische Leistung
- 3 Forschungsvorhaben
- 3.1 Forschungsfragen und Hypothesen
- 3.2 Methode
- 3.3 Stichprobe
- 3.4 Durchführung
- 3.5 Auswertung
- 3.6 Ergebnisse
- 3.6.1 Inklusion vs. Förderschule
- 3.6.2 Geschlechterunterschiede
- 3.6.3 Alter/Klassenstufe und Selbstkonzept
- 3.6.4 Unterschiede unter den Selbstkonzeptdimensionen
- 4 Zusammenfassung und Diskussion
- 4.1 Limitation
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das Selbstkonzept von Kindern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (ESE) in der Primarstufe, vergleicht dabei inklusive und Förderschulkontexte und analysiert Einflussfaktoren wie Geschlecht, Alter und Klassenstufe.
- Vergleich des Selbstkonzepts von Kindern mit ESE in inklusiven und Förderschulsettings.
- Analyse von Geschlechterunterschieden im Selbstkonzept von Kindern mit ESE.
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Alter/Klassenstufe und Selbstkonzept bei Kindern mit ESE.
- Vergleich der verschiedenen Dimensionen des Selbstkonzepts (Fähigkeiten, Körperliches, Soziales) bei Kindern mit ESE.
- Diskussion der Auswirkungen der Beschulungsform auf die Selbstkonzeptentwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Inklusion auf das Selbstkonzept von Kindern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (ESE). Sie hebt die Herausforderungen hervor, die die Inklusion für diese Kindergruppe darstellt und stellt die Forschungsfrage nach unterschiedlichen Ausprägungen des Selbstkonzepts in Abhängigkeit von der Beschulungsform (inklusiv vs. Förderschule).
2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen für die Studie. Es beschreibt den Förderschwerpunkt ESE, seine verschiedenen Erscheinungsformen und die Klassifizierung von Verhaltensstörungen. Der Begriff Inklusion wird abgegrenzt, und der aktuelle Stand der Inklusion in Deutschland und NRW wird dargestellt. Schließlich wird das Selbstkonzept umfassend definiert, seine Entwicklung und Einflussfaktoren beleuchtet sowie der Zusammenhang von Selbstkonzept und schulischer Leistung erläutert.
3 Forschungsvorhaben: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie. Es werden die Forschungsfragen und Hypothesen vorgestellt, die Methode der Fragebogenstudie (Selbstkonzeptfragebogen für Kinder – SKF) erläutert, die Stichprobe beschrieben, die Durchführung des Fragebogens detailliert dargestellt und die Auswertungsmethode (quantitative Analyse mit SPSS) erklärt.
Schlüsselwörter
Selbstkonzept, emotionale und soziale Entwicklung, Inklusion, Förderschule, Primarstufe, Geschlechterunterschiede, Fragebogenstudie, SPSS, Big-Fish-Little-Pond-Effekt, soziale Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Inhaltsvorschau?
Diese Inhaltsvorschau bietet einen umfassenden Überblick über eine Masterarbeit, einschliesslich Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Masterarbeit behandelt?
Die Masterarbeit untersucht das Selbstkonzept von Kindern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (ESE) in der Primarstufe. Sie vergleicht dabei inklusive und Förderschulkontexte und analysiert Einflussfaktoren wie Geschlecht, Alter und Klassenstufe.
Was sind die Hauptziele der Masterarbeit?
Die Hauptziele umfassen den Vergleich des Selbstkonzepts von Kindern mit ESE in inklusiven und Förderschulsettings, die Analyse von Geschlechterunterschieden, die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Alter/Klassenstufe und Selbstkonzept sowie den Vergleich verschiedener Dimensionen des Selbstkonzepts (Fähigkeiten, Körperliches, Soziales).
Welche Kapitel umfasst die Masterarbeit?
Die Masterarbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Forschungsvorhaben, Zusammenfassung und Diskussion, Limitation, Fazit und Ausblick.
Was wird im Kapitel "Theoretischer Hintergrund" behandelt?
Das Kapitel "Theoretischer Hintergrund" liefert den theoretischen Rahmen für die Studie. Es beschreibt den Förderschwerpunkt ESE, den Begriff Inklusion und den aktuellen Stand der Inklusion in Deutschland und NRW. Zudem wird das Selbstkonzept definiert, seine Entwicklung und Einflussfaktoren beleuchtet sowie der Zusammenhang von Selbstkonzept und schulischer Leistung erläutert.
Was beinhaltet das Kapitel "Forschungsvorhaben"?
Das Kapitel "Forschungsvorhaben" beschreibt die Methodik der Studie, einschliesslich Forschungsfragen und Hypothesen, die Methode der Fragebogenstudie (Selbstkonzeptfragebogen für Kinder – SKF), die Beschreibung der Stichprobe, die Durchführung des Fragebogens und die Auswertungsmethode (quantitative Analyse mit SPSS).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Masterarbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Selbstkonzept, emotionale und soziale Entwicklung, Inklusion, Förderschule, Primarstufe, Geschlechterunterschiede, Fragebogenstudie, SPSS, Big-Fish-Little-Pond-Effekt, soziale Vergleiche.
Was sind die Hauptforschungsfragen und Hypothesen der Studie?
Die Forschungsfragen beziehen sich auf Unterschiede im Selbstkonzept von Kindern mit ESE in inklusiven vs. Förderschulsettings, Geschlechterunterschiede, den Einfluss von Alter/Klassenstufe und Unterschiede zwischen den Selbstkonzeptdimensionen.
Welche Auswertungsmethode wird im Forschungsvorhaben angewendet?
Es wird eine quantitative Analyse mit SPSS angewendet, um die Daten aus der Fragebogenstudie auszuwerten.
- Citar trabajo
- Miriam Voigt (Autor), 2024, Das Selbstkonzept von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1524756