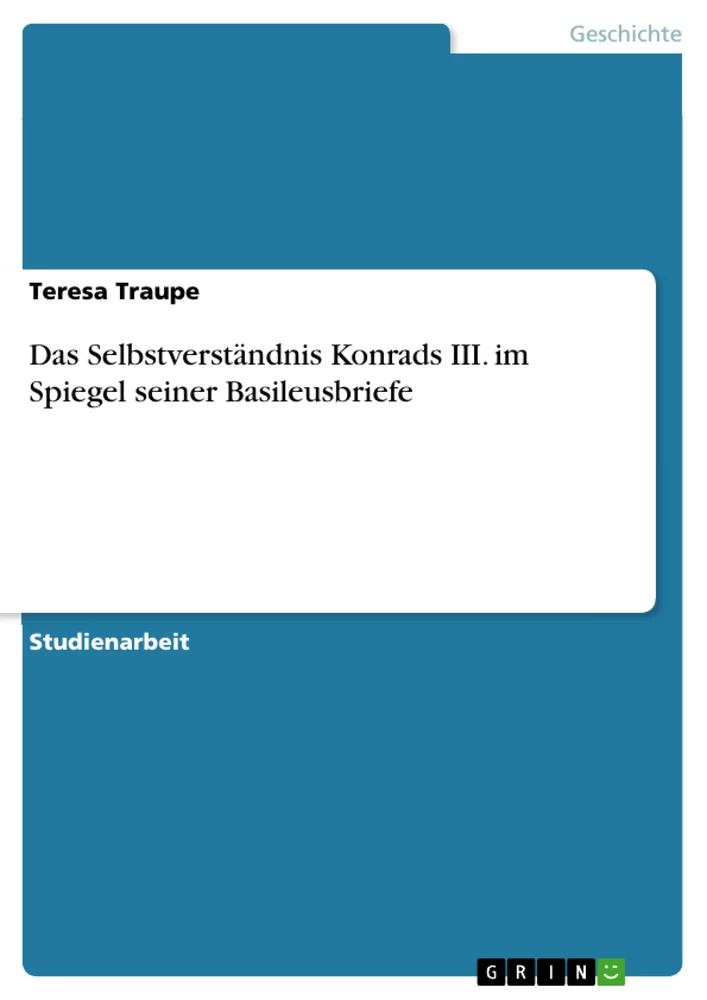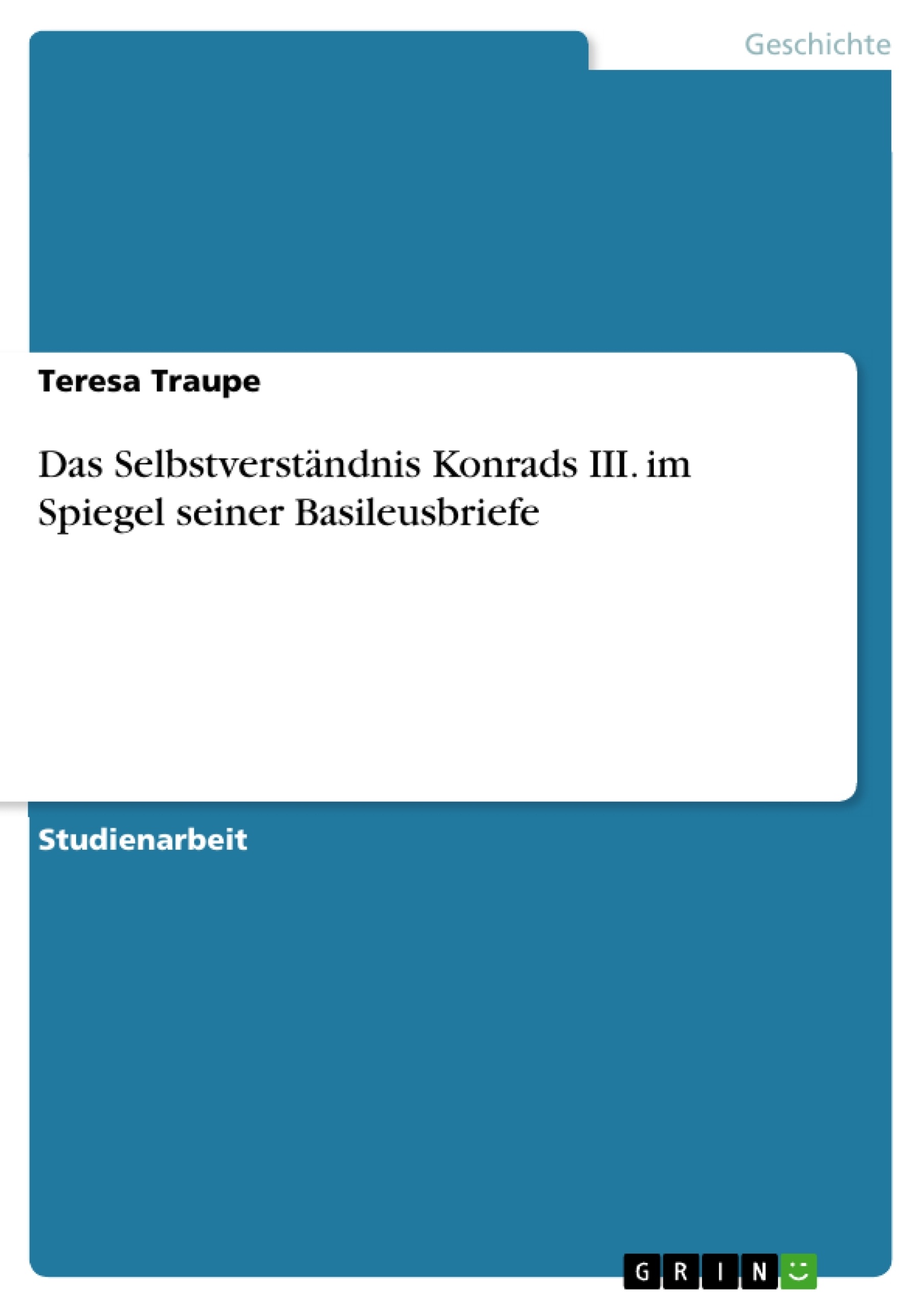Ziel der vorliegenden Arbeit ist, an einzelnen Urkunden des Stauferkönigs Konrad III. (1093-1152) das zugrundeliegende Selbstverständnis zu analysieren.
In der modernen Geschichtsschreibung und auch von Kritikern seiner Zeit lange als „Pfaffenkönig“ und Unglücksrabe des Staufergeschlechts abgewertet, trat Konrad III. samt seinen Taten lange in den Hintergrund. Von seinen Zeitgenossen wurden ihm Mangel an Glück, von der späteren Forschung die Unfähigkeit zu herrschen und wenig Talent bei der Kriegsführung unterstellt. Seit 1945 änderte sich der Blick auf Konrads Herrscherqualitäten. Unter anderem durch die Publikationen Friedrich Hausmanns kam die moderne Forschung weitgehend einhellig zu dem Ergebnis, dass Konrads Politik durchaus weitblickend und förderlich für den Aufstieg des Staufergeschlechts war.1 Trotzdem ist der Umfang der Fachliteratur zu seinem Nachfolger Friedrich I. Barbarossa schwer überschaubar, während sich eine begrenzte Zahl an Studien mit dem ersten Staufer befassen.
Aufgrund der divergierenden Forschungsmeinungen ist es umso interessanter zu untersuchen, wie Konrad sich selbst wahrnahm. In meiner Ausführung möchte ich darum vor allem diesen Aspekt bearbeiten. Sein Selbstverständnis scheint mir für die Forschung genauso von Bedeutung zu sein wie die Fragestellung, ob er ein guter oder schlechter König war und woran das zu messen und aus heutiger Sicht zu beurteilen ist.
An Quellen bleiben für diesen Zusammenhang in der Hauptsache seine Briefe.
Der Wechsel in der Anlage der Urkunden seiner Kanzlei im Laufe der Amtszeit Konrads (1138-1152) lässt sich mit den politischen Ereignissen der Zeit in Verbindung bringen. Besonders gut ist dies an den Herrschaftsbeziehungen und am Vokabular im Briefwechsel mit den Basileis Iohannes II. Komnenos und dessen Sohn Manuel I. Komnenos zu beobachten.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Das Zweikaiserproblem
1.1 Die Anfänge der Imperien
1.2 Die wechselseitige Beeinflussung der Kanzleien
1.3 Die Basileusbriefe
1.3.1 Konrad III. an Johannes Komnenos [DK III 39]
1.3.2 Konrad III. an Johannes II. Komnenos [DK III 69]
1.3.3 Konrad III. an Manuel I. Komnenos [DDK. III. 126]
1.4 Byzanz: Bruder oder Tochter des Reiches?
2. Begriffe, ihre Verwendung und Bedeutung
2.1 Der Herrschertitel
2.2 Das Siegel Konrads III
3. Resümee
Literaturverzeichnis
Quellen:
Darstellungen:
Einleitung
In der folgenden Arbeit werde ich mich mit dem Selbstverständnis des Stauferkönigs Konrad III. beschäftigen. In der modernen Geschichtsschreibung und auch von Kritikern seiner Zeit lange als „Pfaffenkönig“ und Unglücksrabe des Staufergeschlechts abgewertet, trat Konrad III. samt seinen Taten lange in den Hintergrund. Von seinen Zeitgenossen wurden ihm Mangel an Glück, von der späteren Forschung die Unfähigkeit zu herrschen und wenig Talent bei der Kriegsführung unterstellt. Seit 1945 änderte sich der Blick auf Konrads Herrscherqualitäten. Unter anderem durch die Publikationen Friedrich Hausmanns kam die moderne Forschung weitgehend einhellig zu dem Ergebnis, dass Konrads Politik durchaus weitblickend und förderlich für den Aufstieg des Staufergeschlechts war.[1] Trotzdem ist der Umfang der Fachliteratur zu seinem Nachfolger Friedrich I. Barbarossa schwer überschaubar, während sich eine begrenzte Zahl an Studien mit dem ersten Staufer befassen.
Aufgrund der divergierenden Forschungsmeinungen ist es umso interessanter zu untersuchen, wie Konrad sich selbst wahrnahm. In meiner Ausführung möchte ich darum vor allem diesen Aspekt bearbeiten. Sein Selbstverständnis scheint mir für die Forschung genauso von Bedeutung zu sein wie die Fragestellung, ob er ein guter oder schlechter König war und woran das zu messen und aus heutiger Sicht zu beurteilen ist.
An Quellen bleiben für diesen Zusammenhang in der Hauptsache seine Briefe.
Der Wechsel in der Anlage der Urkunden seiner Kanzlei im Laufe der Amtszeit Konrads (1138-1152) lässt sich mit den politischen Ereignissen der Zeit in Verbindung bringen. Besonders gut ist dies an den Herrschaftsbeziehungen und am Vokabular im Briefwechsel mit den Basileis Iohannes II. Komnenos und dessen Sohn Manuel I. Komnenos zu beobachten.
1. Das Zweikaiserproblem
1.1 Die Anfänge der Imperien
Um nun dem Selbstverständnis Konrads auf den Grund gehen zu können, muss erst einmal die Ausgangsposition für die Herrschaftslegitimation, nämlich die Entstehung der beiden von Rom ausgehenden Kaiserreiche beleuchtet werden. Mit Julius Caesar, spätestens jedoch mit der Erhebung Oktavians zum Augustus 27 v. Chr., begann die Prinzipatszeit im antiken Rom. Jahrhunderte später, nachdem das Imperium bereits gelegentlich durch parallel regierende Kaiser, die miteinander in Interessenkonflikte gekommen waren, in verschiedene Herrschaftsbereiche aufgeteilt worden war, entstanden 395 n. Chr. mit der Reichsteilung offiziell zwei Imperien: das Ost- und das Westreich. Beide Reiche wurden von Söhnen des verstorbenen römischen Kaisers Theodosius I. regiert.
Beide mittelalterlichen Kaiser leiteten ihren Herrschaftsanspruch aus der römischen Kaisertradition ab. Da sie sich ebenfalls beide mit voller Überzeugung als römische Kaiser bezeichneten, kam es zu unvermeidbaren Konflikten, die nicht selten in Form von rhetorischen Wendungen Einzug in den Briefwechsel fanden. Auch die Griechen bezeichneten sich im Mittelalter selbst als Römer. Die Tatsache, dass es nur einen Kaiser der Römer geben könne, schwingt immer im Unterton der Herrscher mit. Einen offenen Streit zwischen den beiden Kaisern dürften die gegenseitigen politischen Interessen verhindert haben. Unter Friedrich I. kam es seitens der Kanzleien allerdings schon zu deutlicherer Kritik.
1.2 Die wechselseitige Beeinflussung der Kanzleien
Dass sich die Herrscherkanzleien in Orient und Okzident gegenseitig beeinflussten, ergründete bereits Werner Ohnsorge 1932.[2] Obwohl die Kanzlei des Basileus Johannes bürokratisch weiter entwickelt war als die Konrads, übernahm sie doch einige Formalia der deutschen Kanzlei oder überdachte zumindest ihre Wortwahl im Abgleich mit der des Staufers. Aber auch die staufische Kanzlei hatte ihre Anfangsschwierigkeiten, als 1139 die Gesandtschaft Johannes' in Deutschland eintraf. Man war nicht auf den Verkehr mit dem Kaiser eines Weltreiches eingestellt, der seine Briefe in Griechisch mit lateinischer Übersetzung abzufassen pflegte. Zudem stellte sich für Konrad die Frage, wie er ihm gegenübertreten sollte. Zum König gekrönt, was jedoch immer noch nicht von allen ranghohen Mitgliedern der fränkischen Regierugsschicht gebilligt war, hatte er die Kaiserwürde noch nicht empfangen. Eigentlich war er also dem Basileus im Rang nicht gleichgestellt, geschweige denn überlegen. Seine Urkundensprache aber zeigt uns, dass er sich dazu entschied, seine Position von Anfang an uneingeschränkt und keineswegs unterlegen darzustellen. In DDK. III. 69 bezeichnet er sich in der Intitulatio als dei gratia Romanorum imperator augustus, während er Johannes die Würde des Constantinopolitano imperatori zubilligt. Konrad erhebt sich selbst zum gleichwertigen Imperator und setzt sich mit dem Attribut Romanorum, wie oben zum Zweikaiserproblem angesprochen, in eine erhöhte Position. Wie Ohnsorge erläutert, waren die Titel imperator und basileus in der Mitte des 12. Jahrhunderts weitgehend austauschbar, wobei dem imperator gegenüber dem rex mehr Würde innelag.[3] Derselbe weist jedoch auch eindringlich darauf hin, dass, wenn in DDK. III. 126 eine weitere Abminderung der Anrede des Basileus, nun Johannes' Sohnes Manuel, als rex Grecorum stattfindet, dies nicht unbedingt beleidigend aufgefasst wurde. Was der byzantinische Kaiser nicht hinnehmen konnte, war, dass Konrad das Attribut Romanorum für sich beanspruchte. Denn es war ein gewichtiges Wort, das beiden Kaisern zur Legitimation ihrer Herrschaft elementar war und das beide nur für sich selbst gelten lassen konnten.
1.3 Die Basileusbriefe
Konrad bemühte sich, die Kanzlei so zu führen, wie es der Salier Heinrich V. getan hatte, denn er betrachtete sich als Erbe der salischen Tradition.[4] Konrads Mutter, Agnes von Waiblingen, war die Tochter Heinrichs IV. Seine Kanzlei verwendete dieselben Formularbehelfe, die unter Heinrichs Regentschaft zusammengestellt worden waren.[5]
[...]
[1] Siehe zur modernen Forschungsmeinung vor allem: F. Hausmann: Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, Wien 1969 und W. Ziegler: König Konrad III. (1138-1152): Hof, Urkunden und Politik, Wien 2008.
[2] Siehe dazu Ohnsorge, "Kaiser" Konrad III. (MÖIG 46), S. 343-360.
[3] Erläutert in: "Kaiser" Konrad III. (MÖIG 46), S. 350.
[4] Friedrich Hausmann, Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich (S. XX).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit über Konrad III. und sein Selbstverständnis?
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Selbstverständnis des Stauferkönigs Konrad III. und untersucht, wie er sich selbst wahrnahm, insbesondere in Bezug auf seine Herrschaftslegitimation und seine Beziehungen zu anderen Kaiserreichen, insbesondere Byzanz.
Was ist das "Zweikaiserproblem"?
Das Zweikaiserproblem beschreibt den Konflikt, der entstand, weil sowohl das westliche (römisch-deutsche) als auch das östliche (byzantinische) Reich ihren Herrschaftsanspruch aus der römischen Kaisertradition ableiteten und sich beide als "römische" Kaiser bezeichneten. Dies führte zu Spannungen und rhetorischen Auseinandersetzungen, insbesondere im Briefwechsel zwischen den Herrschern.
Wie beeinflussten sich die Kanzleien im Orient und Okzident?
Die Herrscherkanzleien in Ost und West beeinflussten sich gegenseitig, obwohl die byzantinische Kanzlei bürokratisch weiter entwickelt war. Konrads Kanzlei übernahm Formalia und überdachte ihre Wortwahl im Abgleich mit der byzantinischen Kanzlei. Umgekehrt musste sich Konrads Kanzlei auf den Verkehr mit dem byzantinischen Kaiser einstellen und seine Position im Rang definieren.
Welche Bedeutung haben die Briefe von Konrad III. an die Basileis?
Die Briefe von Konrad III. an die Basileis Johannes II. Komnenos und Manuel I. Komnenos sind wichtige Quellen, um sein Selbstverständnis zu verstehen. In seinen Briefen nutzte er seine Titulatur, um seine Position als gleichwertiger Imperator zu etablieren, insbesondere durch die Verwendung des Attributs "Romanorum".
Wie betrachtete Konrad III. die salische Tradition?
Konrad III. betrachtete sich als Erbe der salischen Tradition und bemühte sich, seine Kanzlei so zu führen, wie es der Salier Heinrich V. getan hatte. Seine Kanzlei verwendete dieselben Formularbehelfe, die unter Heinrichs Regentschaft zusammengestellt worden waren.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Hauptquellen für die Arbeit sind die Briefe Konrads III., insbesondere sein Briefwechsel mit den byzantinischen Kaisern. Des Weiteren wird auf moderne Forschungsliteratur, insbesondere die Werke von Friedrich Hausmann und Werner Ziegler, verwiesen.
Welche Kritik gab es an Konrad III. und wie hat sich das Bild gewandelt?
Konrad III. wurde lange Zeit als "Pfaffenkönig" und Unglücksrabe des Staufergeschlechts abgewertet. Ihm wurden Mangel an Glück, Unfähigkeit zu herrschen und wenig Talent bei der Kriegsführung unterstellt. Seit 1945 hat sich das Bild gewandelt, und die moderne Forschung sieht seine Politik als weitsichtig und förderlich für den Aufstieg des Staufergeschlechts.
- Citation du texte
- Teresa Traupe (Auteur), 2009, Das Selbstverständnis Konrads III. im Spiegel seiner Basileusbriefe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152488