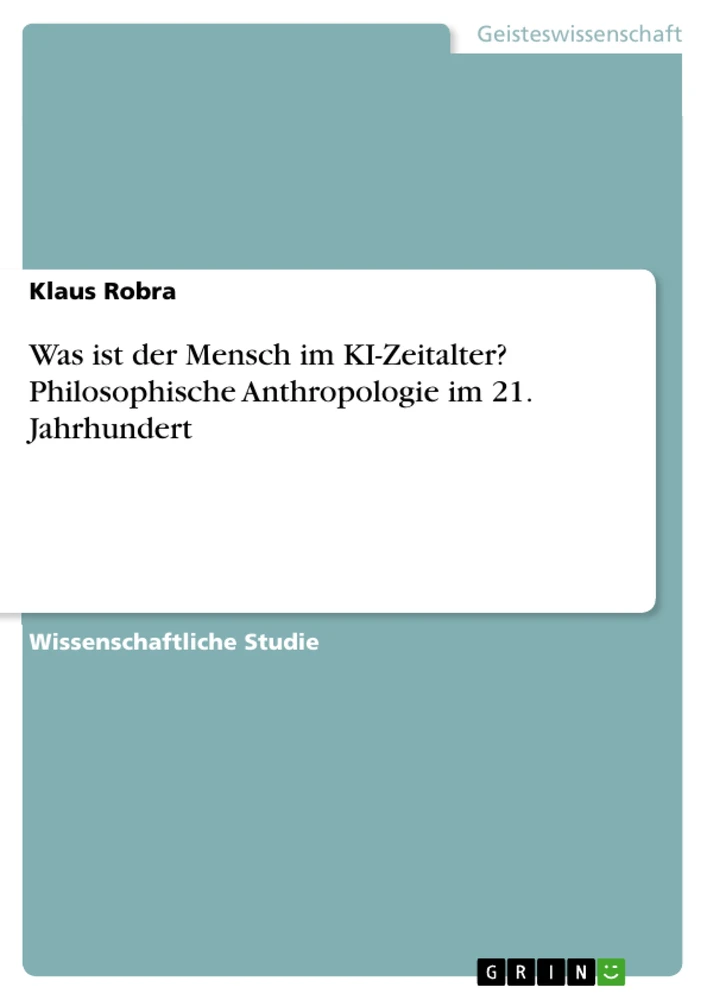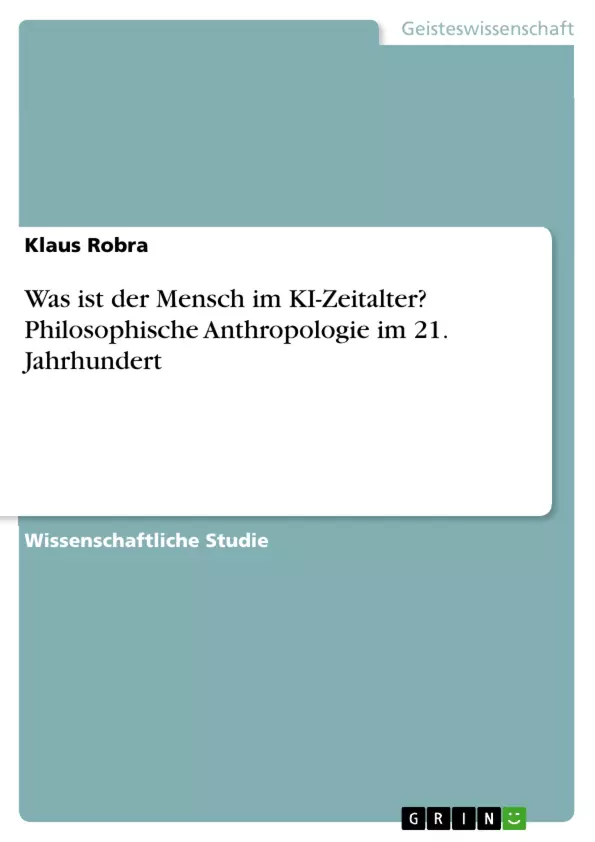Es mag zunächst als gewagt erscheinen, die philosophische Anthropologie auf das 21. Jahrhundert einzugrenzen, es sei denn zu Forschungszwecken. Im Übrigen dürfte es auch in solcher Eingrenzung ausgeschlossen sein, Vollständigkeit zu erreichen, und zwar schon in Folge der Unüberschaubarkeit der neuronalen Kombinatorik jeder Einzelperson. Kaum möglich ist es auch, die Jahrtausende umfassende Wirkungsgeschichte der Anthropologie in ihrer Gesamtheit zu referieren. Außerdem überschneidet sich der Begriff ‚KI-Zeitalter‘ teilweise mit Begriffen wie ‚Anthropozän‘ (P. Cruxen) und ‚Kapitalozän‘, die sich aber auf die Zeit seit dem 18. Jahrhundert und dabei nur sporadisch oder beiläufig auf die Besonderheiten des KI-Zeitalters beziehen. – Aber nichts geht mehr für die Menschen, wenn eines Tages die KI die Menschheit auslöscht, um sodann die Herrschaft über das gesamte Universum anzutreten.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Zur Forschungslage. Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Thema: Mensch und Maschine. Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz (2023)
Zur philosophischen Anthropologie: Die vier großen K: Kommunikation, Kontakt, Kooperation, Konkurrenz
Zum Leib-Seele-Problem
Ergänzungen zur Erkenntnistheorie
Erkenntnistheorie, Ethik und Willensfreiheit
Bewusstseins-Konzepte
Kunst und KI
Die Liebe – oder auch: der Weltknoten
Das Widersacherische: negative oder destruktive Gefühle?
Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit
Ist der Mensch als Selbst „das nicht-festgestellte Tier“? J. Bauer: „Wie wir werden, wer wir sind.“
Posthumanistische Endzeit-Visionen: R. Kurzweil u.a
Trotzdem immer weiter mit KI? Das Für und Wider
Wachsende Bedeutung der KI in Wirtschaft und Gesellschaft
Probleme mit KI im Alltagsleben
KI und Anthropozän/Kapitalozän: Bewältigung sowohl der Öko-Krise als auch der Sozialen Frage?
Reicht „mehr Besonnenheit im Umgang mit KI“?
Kritische Würdigung und Fazit
Literaturhinweise
Inhaltsverzeichnis (detailliert)
Einleitung
Zur Forschungslage. Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Thema: Mensch und Maschine. Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz (2023)
Zur philosophischen Anthropologie: Die vier großen K: Kommunikation, Kontakt, Kooperation, Konkurrenz
Zum Leib-Seele-Problem
Ergänzungen zur Erkenntnistheorie
Erkenntnistheorie, Ethik und Willensfreiheit
Bewusstseins-Konzepte
Sprache, Bewusstsein und Welterfahrung
Sprache und Künstliche Intelligenz
Kunst und KI
Die Liebe – oder auch: der Weltknoten
Das Widersacherische: negative oder destruktive Gefühle?
Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit
Zur aktuellen Forschungslage: J. Bauer und M. Spitzer
Ist der Mensch als Selbst „das nicht-festgestellte Tier“? J. Bauer: „Wie wir werden, wer wir sind.“
Zum Tier-Mensch-Vergleich
Eine neue politische Perspektive
Aktuelle Probleme mit höchstem Bedrohungspotential
Posthumanistische Endzeit-Visionen: R. Kurzweil u.a.
„Künstliche Intelligenz wird den Menschen auslöschen“
Trotzdem immer weiter mit KI? Das Für und Wider. Wachsende Bedeutung der KI in
Wirtschaft und Gesellschaft
Probleme mit KI im Alltagsleben
KI und Anthropozän/Kapitalozän: Bewältigung sowohl der Öko-Krise als auch der Sozialen Frage?
Reicht „mehr Besonnenheit im Umgang mit KI“?
Kritische Würdigung und Fazit
Europäische Charta der Grundrechte, KI und die Zukunft der Menschheit
Literaturhinweise
Einleitung
Hegel definiert die Philosophie u.a. als „ihre Zeit, in Gedanken erfasst“ und meint dabei auch das historische Bewusstsein als Vermittlungsinstanz, so dass es zunächst als gewagt erschei-nen mag, die philosophische Anthropologie auf das 21. Jahrhundert einzugrenzen, es sei denn aus heuristischen Gründen, d.h. zu Forschungszwecken. Im Übrigen dürfte es auch in solcher Eingrenzung ausgeschlossen sein, Vollständigkeit zu erreichen, und zwar schon in Folge der Unüberschaubarkeit der neuronalen Kombinatorik jeder Einzelperson. (Ergänzungen: s. Robra 2003 bzw. 2017b.) Kaum möglich ist es auch, die Jahrtausende umfassende Wirkungs-geschichte der Anthropologie in ihrer Gesamtheit zu referieren. Außerdem überschneidet sich der Begriff ‚KI-Zeitalter‘ teilweise mit Begriffen wie ‚Anthropozän‘ (P. Cruxen) und ‚Kapita-lozän‘, die sich aber auf die Zeit seit dem 18. Jahrhundert und dabei nur sporadisch oder beiläufig auf die Besonderheiten des KI-Zeitalters beziehen. – Im Folgenden begnüge ich mich zunächst mit ein paar Wegmarken.
Im Buch Genesis gilt der Mensch als „Ebenbild Gottes“. Doch der Psalmist fragt Gott:
„Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“ (Psalm 8, V. 4-5, Hervorhebungen K.R.)
Augustinus (354-430) erklärt: „Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum, donec requies-cat in Te.” (»Du hast uns zu Dir hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir.«)
David Hume (1711-1776): „Überhaupt können wir bemerken, dass die Seelen der Menschen sich gegen einander wie Spiegel verhalten.“
Kant (1724-1804) stellt die Fragen: „1.Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen?“ Und: „Was ist der Mensch?“ Kants eigene Antwort: „Der Mensch ist Person.“1
Dagegen behauptet Nietzsche (1844-1900), der Mensch sei „das noch nicht festgestellte Tier“.
Martin Buber (1878-1965): „Der Mensch wird am Du zum Ich.“
Während Arnold Gehlen (1904-1976) den Menschen als „biologisches Mängelwesen“ auf-fasst, fragt Ernst Bloch (1885-1977): „Was kann der Mensch werden?“, und Joachim Bauer (geb. 1951) erklärt, „wie wir werden, wer wir sind“. Auch über das „verkommene“ Subjekt kann man philosophieren (z.B. Robra 2022).
Aber nichts geht mehr für die Menschen, wenn eines Tages die KI die Menschheit auslöscht, um sodann die Herrschaft über das gesamte Universum anzutreten.
Zur Forschungslage. Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Thema: Mensch und Maschine. Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz(2023).
Mit dem Untertitel grenzen die Ethikrat-Autoren das Thema deutlich ein, so dass keineswegs das gesamte Maschinen-Zeitalter zur Diskussion steht. KI-Systeme definieren sie folgender-maßen:2
„Die in KI-Systemen verwendeten algorithmischen Verfahren und Systeme werden vielfach unter dem Stichwort „maschinelles Lernen“ zusammengefasst und zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Mustersuche, Modellbildung und sonstige Funktions-weise datenbasiert optimieren können.“ (a.a.O. S. 15)
Einer weiteren gängigen Definition zufolge bezeichnet ein Algorithmus „eine systematische logische Regel oder Vorgehensweise, die zur Lösung eines vorliegenden Problems führt“ (Werner Stangl). Einfacher ist ein Algorithmus „eine Anleitung, die dir Schritt für Schritt zeigt, wie du ein Problem lösen kannst“3. Und die Fähigkeit zur Problemlösung ist bekannt-lich das, was allgemein als Intelligenz gilt. Auf die KI übertragen bedeutet dies, dass jedes Computer-Programm als Ganzes einen Algorithmus darstellt.
Der Ethikrat unterscheidet in seiner 403 Seiten umfassenden Stellungnahme zwischen enger, breiter und starker KI, wobei letztere einen „qualitativen Sprung“ bedeute. Enge KI bezieht sich auf spezielle Aufgaben, in denen menschliche Fähigkeiten in einem bestimmten, eng umgrenzten Bereich zu simulieren sind. „Breite KI erweitert das Spektrum ihrer Anwend-barkeit über einzelne Domänen hinaus. Der Begriff der starken KI wird für die Vision einer Künstlichen Intelligenz verwendet, die jenseits der möglicherweise perfekten Simulation menschlicher Kognition auch über mentale Zustände, Einsichtsfähigkeit und Emotionen verfügen würde.“ (a.a.O. S. 19)
Wobei solche „Einsichtsfähigkeit“ keineswegs moralische oder rechtliche Verantwortung be-deutet. Letztere bleibe den natürlichen Personen vorbehalten, zumal diese Vernunft und Leib-lichkeit miteinander verbinden. Kognitive Fähigkeiten seien „in ihrem Entstehungs- und Voll-zugsprozess … an Sinnlichkeit und Leiblichkeit, Sozialität und Kulturalität gebunden“ (a.a.O. S. 28 f.).
Insofern diene KI vor allem dazu, die Möglichkeiten des Menschen zu erweitern, auch wenn dies nicht immer gelinge, sondern auch das Gegenteil, nämlich die Einschränkung menschli-cher Möglichkeiten, eintreten könne (S. 31).
Darüber hinaus spricht der Ethikrat für einige Domänen spezielle Empfehlungen aus, z.B. zur Medizin:
„Eine vollständige Ersetzung der ärztlichen Fachkraft durch ein KI-System gefährdet das Patientenwohl und ist auch nicht dadurch zu rechtfertigen, dass schon heute in bestimmten Versorgungsbereichen ein akuter Personalmangel besteht. Gerade in kom- plexen Behandlungssituationenbedarf es eines personalen Gegenübers, das durch tech- nische Komponenten zwar immer stärker unterstützt werden kann, dadurch selbst als Verantwortungsträger für die Planung, Durchführung und Überwachung des Behand-lungsprozesses aber nicht überflüssig wird.“ (S. 38)
Zur Bildung:
„In Anbetracht der erkenntnistheoretischen und ethischen Herausforderungen und unter Abwägung potenzieller Nutzen und Schäden stehen die Mitglieder des Deutschen Ethikrates dem Einsatz von Audio- und Videomonitoring im Klassenzimmer ins-gesamt skeptisch gegenüber. Insbesondere erscheint die Analyse von Aufmerksamkeit und Emotionen per Audio- und Videoüberwachung des Klassenraums mittels aktuell verfügbarer Technologien nicht vertretbar. Ein Teil des Ethikrates schließt den Einsatz von Technologien zur Aufmerksamkeits- und Affekterkennung zukünftig jedoch nicht vollständig aus, sofern sichergestellt ist, dass die erfassten Daten eine wissenschaftlich nachweisbare Verbesserung des Lernprozesses bieten und das hierfür notwendige Monitoring von Lernenden und Lehrkräften keine inakzeptablen Auswirkungen auf deren Privatsphäre und Autonomie hat. Ein anderer Teil des Ethikrates hingegen hält die Auswirkungen auf Privatsphäre, Autonomie und Gerechtigkeit hingegen generell für nicht akzeptabel und befürwortet daher ein Verbot von Technologien zu Aufmerksamkeitsmonitoring und Affekterkennung in Schulen.“ (S. 44 f.)
Zur Kommunikation:
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll um eine neue „digitale Infrastruktur“ erweitert, aber nicht durch diese ersetzt werden. Jedenfalls soll die neue Infrastruktur „eine Alternative zu den kommerzbetriebenen, stark oligopolartigen Angeboten“ bieten. Wobei eine „hinreichende Staatsferne“ auch durch Öffentliche Stiftungen erreicht werden könne (S. 55 f.).
Zur Verwaltung:
Letztentscheidungen können nicht einfach auf die KI abgewälzt werden. Ferner:
„Die Einsichts- und Einspruchsrechte Betroffener müssen auch beim Einsatz algo- rithmischer Systeme effektiv gewährleistet werden. Dazu bedarf es gegebenenfalls weiterer wirksamer Verfahren und Institutionen.“ Und:
„In Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung sollte eine Sensibilisierung gegenüber möglichen Gefahren von Automatisierungssystemen, wie etwa Verletzungen der Privatsphäre oder Formen systematisierter Diskriminierung, erfolgen. Dazu gehört eine öffentliche Debatte darüber, ob es in bestimmten Kontexten überhaupt einer technischen Lösung bedarf.“ (S. 62)
KI soll Entscheidungen unterstützen, nicht ersetzen. Effektive Kontroll-Optionen sind zu ge- währleisten. Kriterium ethischer Bewertung von KI sei die Stärkung menschlicher Hand-lungsmöglichkeiten. Die Privatsphäre ist stets zu schützen, Diskriminierung zu verhindern (S. 76 f.).
Ausführlich geht der Ethikrat auch auf mögliche „Mensch-Technik-Wechselwirkungen“ ein, und zwar wie folgt:
„Die zunehmende Komplexität der Mensch-Technik- bzw. Mensch-Maschine-Relation verändert auch deren Wahrnehmung. Insbesondere KI-gesteuerte Systeme wie Produk-tionsroboter, „autonome“ Fahrzeuge, Therapieprogramme oder Schachcomputer sind Beispiele digitaler Technik, in denen die vormals klaren Unterscheidungen von Mensch und Technik weniger eindeutig zu werden scheinen. Androide Roboter er-scheinen menschenähnlich, Hilfesuchende interagieren mit Therapieprogrammen, als ob es sich um menschliche Therapiekräfte handeln würde, und der Schachcomputer scheint die Partie gewinnen „zu wollen“. Die Anthropomorphisierung digitaler Technik ist in der Umgangssprache weit fortgeschritten. Sie zeigt sich darin, dass KI und Robotern Fähigkeiten wie Denken, Lernen, Entscheiden oder Emotionalität zugeschrieben werden, wodurch sie scheinbar in die Gemeinschaft der denkenden, lernenden, entscheidenden und fühlenden Menschen aufgenommen werden. Phänome- nologisch geht damit einher, dass sich durch „autonom“ werdende KI-gestützte Technik Subjekt-Objekt-Verhältnisse zwischen Mensch und Technik verändern. Im traditionellen Bild gestalten und nutzen menschliche Subjekte technische Objekte. Bereits mit traditioneller Software, mehr noch mit KI, kommt es jedoch zu neuen Konstellationen. In vernetzten Systemen haben Menschen teils die Subjekt-, teils aber auch die Objektrolle inne. Wenn einerseits Entscheidungen über Menschen an Soft- waresysteme delegiert werden, beispielsweise hinsichtlich der Gewährung von Kre- diten oder Sozialleistungen, werden Menschen zu Objekten der „Entscheidungen“ dieser Systeme, die hier auftreten, als ob sie Subjekte seien. Andererseits kann die Subjektrolle von Menschen durch gute Software zur Entscheidungsunterstützung erhöht werden, beispielsweise wenn diese qualitativ hochwertige, diskriminierungs- freie und nachvollziehbare Informationen liefern, welche die Qualität menschlicher Entscheidungen und deren Begründbarkeit verbessern. Verschiebungen in den Sub- jekt- Objekt-Rollen zwischen Mensch und Technik müssen daher differenziert be- trachtet werden. Sie hängen einerseits vom Ausmaß und diversen technischen und organisationalen Details ab; andererseits – und dies ist von besonderer ethischer Rele- vanz – manifestieren sie sich bei verschiedenen Personengruppen auf unterschiedliche Weise.“ (S. 170 f.))
Bemerkenswert erscheint hier die mögliche Veränderung von Subjekt-Objekt-Beziehungen, somit der ureigenen Domäne des menschlichen Geistes. Anthromorphisierung führt dazu, dass Maschinen, z.B. Robotern, partielle Subjektivität zugesprochen wird, nämlich z.B. men-schenähnliches „Denken, Lernen, Entscheiden oder Emotionalität“, so dass die Grenzen zwi-schen Mensch und Maschine zu verschwinden drohen. In vernetzten Systemen werden Menschen zu Objekten, verlieren zumindest einen Teil ihres Subjekt-Seins, so wenn KI-Soft-ware über die Vergabe von Krediten entscheiden soll – so, als ob die KI-Systeme tatsächlich Subjekte sein könnten.
Unbedenklich scheint dagegen die Absicht, das Subjekt-Sein von Menschen mittels verlässli-cher KI-Informationen zu stärken. Aber: Handelt es sich dabei nur um „Verschiebungen in den Subjekt-Objekt-Rollen zwischen Mensch und Technik“? Wenn KI „subjekthaft“ wird, bedroht sie die herkömmliche menschliche Subjektivität, und zwar erst recht dann, wenn sich Intelligenzleistungen von KI als denjenigen von Menschen überlegen erweisen, was in Teilbe-reichen, z.B. beim Schachcomputer und bei superintelligenten Robotern bzw.Cyborgs, schon gegenwärtig der Fall ist. Dieser Gefahr begegnet der Ethikrat in seiner Stellungnahme anscheinend nicht oder nicht in hinreichendem Maße. Es ist ein Thema, das weiter ausgrei-fender Überlegungen bedarf (s.u.). Darüber hinaus fehlen in der Stellungnahme des Ethikrats – trotz deren Umfangs von gut 400 Seiten – einige weitere, wesentliche Komponenten der aktuellen Forschungslage der Anthropologie, wie im Folgenden aufgewiesen werden soll.
Zur philosophischen Anthropologie: Die vier großen K: Kommunikation, Kontakt, Kooperation, Konkurrenz
Am Anfang aber war anscheinend ein fünftes großes K: die Katastrophe. Welten, Universen stürzen zusammen, implodieren in einer schier unvorstellbaren „Urknall“-Singularität, um in unfassbarer Explosion aus dem unendlich Kleinen das unendlich Große zu gebären: ein neues Universum, das unsrige. Ursprüngliche Negativität wird aus diesem Katastrophen-Szenario verstehbar; ständige Expansion bedeutet ständige Veränderung, dynamische Negation des Zustandsmoments A durch den/das Folge-Moment B: Ursprung der Dialektik.
Und doch auch: Negation der ursprünglichen Katastrophe durch die erwähnten aufbauenden Faktoren Kommunikation, Kontakt und Kooperation, nachweisbar schon in der anorganischen Materie und in allen weiteren Seinsstufen bis hin zum individuellen Bewusstsein und zum gesellschaftlichen Sein, Grundlagen von Weiter- und Höherentwicklung. Nicht nachweisbar, aber postulierbar in Hypothesen über Eigenschaften und Merkmale der ursprünglichen, aus der „Urknall“-Singularität hervorgehenden Welt-Materie.
Demgemäß gibt es auf die Frage, was der Mensch sei, mindestens drei einleuchtende Antworten: 1.) Der Mensch ist das, was er geworden ist; sein „Ge-wesenes“ ist sein Wesen. 2.) Er ist das, was er noch werden kann, noch nicht ist. 3.) Und das ist meine (vorläufige) Antwort: Er/sie ist Materie und Person zugleich. Bestimmbar daher sowohl materiell als auch geistig, sowohl vom „Gesamtumfang“ des Mensch-Seins als auch von der stofflichen und informationell-entelechetischen Materie her. Wobei zu dem Gesamtumfang bekanntlich nicht nur das Körper-Sein und der Geist, sondern auch die Psyche, die Seele als Erlebnis-Grundlage, gehört. Der Versuch, die leib-seelische Einheit zu verstehen, ist oft unternommen worden und möglicherweise nie gelungen. Eine „endgültige“ Lösung kann es schon deshalb nicht geben, weil wir nicht wissen, welche Möglichkeiten, welches Noch-Nicht uns die Zukunft bescheren wird. Immerhin verhilft dialektisches Denken dazu, die prinzipielle Unüber-schaubarkeit des Leib-Seele-Problems auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und plausible Lösungsansätze bieten zu können, wie ich im Folgenden zu zeigen hoffe. Wobei ich auch auf die Antworten 1.) und 2.) zurückkommen werde.
Zu Anwort 1.). Sie erheischt einen Rückgang in den Ursprung, den mutmaßlichen Anfang des Kosmos, zumindest aber zur materiellen Grundlage des menschlichen Seins – und damit zu der gigantischen Evolutionsgeschichte, die in uns, d.h. z.B. in unserem genetischen Erbe, nachwirkt. Schon auf subatomarer Ebene werden In-formationen bzw. Strukturen vorgefunden, die analysiert und als „bedeutsam“ interpretiert werden können. Es sind u.a. „dynamische Muster“ mit bestimmten Wellen-Funktionen bzw. raum-zeitlichen Symmetrien und Asymmetrien, denen Physiker bereits Zwecke zuordnen können. Eine Teleonomie, die sich in den Atomen in der Entwicklung des periodischen Systems der chemischen Elemente niederschlägt, wobei „syntaktische Zuordnungsprinzipien“ vorzuherrschen scheinen.
Wie molekulare Codierung funktioniert, zeigt sich in der speziellen Semantik der genetischen Codes und damit des Lebens selbst, das zugleich das biologisch-materielle Substrat der natürlichen Wort-Sprachen enthält. Wiederum wirken Assoziations- und Zuordnungs-prinzipien, die ein Prinzip von Höherentwicklung und Transcodierung enthalten. Und aus DNS-Molekülen bestehen auch die Pflanzen4 und die Lebewesen. Wobei die Tierwelt charakterisiert ist durch Triebe der Selbst- und Arterhaltung, die sich in ständiger Ausein-andersetzung mit der Umwelt bewähren. Elementare, rhythmische Kräfte des Lebens wie Herzschlag, Atmung, Verdauung, Fortbewegung, Sexual- und Fortpflanzungsverhalten begleiten das teilweise sprunghaft dynamische Wachstum und die zunehmende Differen-zierung der Gehirne, speziell des Neocortex, was neue Formen der Kommunikation ermöglicht, darunter immer neue körper- und lautsprachliche Signalsysteme, wobei die Tiere allerdings stets auf bestimmte Situationen reagieren, also situativ gebunden sind. Was es ihnen aber nichtsdestoweniger ermöglicht, ihre Lebensräume zweckdienlich neu zu gestalten. Es sind, insgesamt gesehen, Vorformen der Symbolik und Arbitrarität, die in der Menschen-sprache voll entfaltet werden.
Im Verhalten der Menschen führen die außerordentliche Vergrößerung des Neocortex und die Ausbildung des Bewusstseins u.a. zu immer besseren Formen des sprachlichen Ausdrucks und dessen Kommunikation. Wobei primär bedeutsam allerdings nicht die bloße Kommu-nikation gewesen zu sein scheint, sondern die Konstruktion eines kohärenten Weltbildes, zusammengesetzt aus unterschiedlichen Sinnesmodalitäten. Träger, Muster und Bedeutung sind Grundelemente jeglicher Sprache, wobei für die Entwicklung der Psyche bereits die Zellsprache, d.h. die Zeichengebung in den Zellen als maßgeblich gilt. So dass sich erneut das Leib-Seele-Problem als Kernfrage der Anthropologie erweist.
Zum Leib-Seele-Problem
Das Bewusstsein ist auf den Geist angewiesen, beide auf das Zusammenspiel von Leib, Seele und Geist. Auch wenn das Bewusstseins-Problem weitgehend geklärt ist, lässt sich von ihm die Frage nach dem Verhältnis von Körper, (un)bewusstem Erleben und geistiger Aktivität nicht trennen. Mein Lösungsvorschlag:
Koitieren, urinieren, fühlen, schmecken, reflektieren, sprechen, träumen – alles ein- und dasselbe? Natürlich können die genannten Aktionen allesamt von ein- und derselben Person vollzogen werden. Sind sie deshalb wesensgleich, evtl. sogar in qualitativer Hinsicht? Nur einer einzigen, immer gleichen Sinn- und Bedeutungsebene zuzuordnen? Überlegungen dieser Art gehen einem immer wieder durch den Kopf, wenn man über das Leib-Seele-Problem nachdenkt.
Und dies ändert sich auch nicht, wenn man bedenkt, dass manche Theoretiker darin ein bloßes „Scheinproblem“ sehen. Eine Annahme, die doch allenfalls dann berechtigt sein könnte, wenn man Geist und Materie, Psychisches und Körperliches einfach für identisch erklärt, was ich für nachweislich falsch halte. „Wie kommt der Geist in die Hose?“ „Wie können Theologen behaupten, die Seele sei unsterblich?“ „Der Geist weht, wo er will?“ Angesichts solcher Fragen und Probleme glaubt man jedenfalls zu wissen, worin die Aufgabe besteht: Die Nuss zu knacken, den Dingen auf den Grund zu gehen, endlich Klarheit zu gewinnen.
Aber wie? Müssen nicht zunächst wenigstens die Grund- und Schlüsselbegriffe definiert werden? Was ist denn der Leib im Unterschied zum Körper? Worin unterscheiden sich Körper, Seele, Psyche und Geist? Existiert der Mensch, auch und gerade als Person, nicht immer als Einheit, wenn nicht substanziell, so doch wenigstens akzidentiell? Körper und Leib, Psyche und Seele – diese Unterscheidungen verdanken wir vor allem der christlichen Theologie. Mein Körper, das ist zunächst und vor allem etwas Materielles, Organisches, in Raum und Zeit Feststellbares. Mein Leib, das ist der religiös verklärte, der beseelte Körper. Und die Seele? Aristoteles nannte sie Psyche und definierte diese als „die Form des Körpers“ und als das zweckgerichtete (entelechetische) Lebensprinzip, das, was den Körper am Leben hält.
Heute wissen wir: Seele oder Psyche, das ist einerlei. Mit beidem meinen wir die individuelle, je-meinige Art und Weise, in der ich mich und die Welt erlebe. Ich bin, aber ich habe mich nicht, wie Ernst Bloch bemerkt. Was ich empfinde, verspüre, fühle, erinnere, denke, gehört nichtsdestoweniger zu meinem persönlichen Erleben, meinem ureigenen, einmaligen Seelen-Leben. Es gehört alles zu meinem Selbst, das hinter und in meinem Ich steht. Und ist doch auch Teil eines größeren Ganzen: des Subjekt-Seins. Und dieses Subjekt-Sein lässt sich nicht begreifen ohne seine Objekt-Bezüge. Dinge an sich werden Gegenstände für meine Sinne und für meinen Verstand; es sind Gegenstände, die in meinem Gehirn zu mentalen Objekten werden, zu Objekten des Empfindens, Fühlens, Wahrnehmens, Vorstellens und Reflektierens. In diesen Transformationen zeigen sich Wechselwirkungen, Dialektik; so arbeitet der Geist, der aber ohne Körper und Psyche gar nicht funktionieren könnte. Subjekt-Objekt-Dialektik, das bedeutet: Der ganze Mensch ist stets auch ein geistiges Wesen und zugleich Teil der Natur, seiner Umgebung, seiner Gesellschaft – ein Welt-Ereignis.
Dies bringt mich auf eine weitere Idee: Sollte es nicht möglich sein, die Begriffe Dialektik und Information miteinander zu verbinden und dadurch neue Möglichkeiten der Erklärung des Leib-Seele-Problems zu finden? Weitere Gründe hierfür finden sich in dem Buch der US-amerikanischen Biomedizinerin Candace B. Pert : Moleküle der Gefühle. Körper, Geist und Emotionen, Reinbek 2001. Die Autorin analysiert darin das gesamte zelluläre bzw. energetische Geschehen in lebenden Organismen als dynamisches Informationsgeschehen, wobei angeblich der latente Dualismus von Leib und Seele endgültig überwunden wird. Gefühle vermitteln zwischen Körper und Geist; anscheinend Immaterielles (z.B. Gedanken) und Materielles (z.B. Organe) stehen, u.a. über Neuropeptide, im menschlichen Körper in ständiger Verbindung, und zwar – in unterschiedlichen, variierenden Ausprägungen – in den Körperzellen, die durch informationelle Interaktion miteinander verbunden sind. Diese Einheit bezeichnet Pert auch als „Körpergeist“.
Sind damit auch die Inhalte von Geist und Bewusstsein bereits erklärt? Wohl kaum, zumal die Subjektivität des Menschen, sein persönlicher Geist, sich nicht auf beschreibbare Hirn-Mechanismen oder gar Hirn-Materie reduzieren lässt. Diskutabel scheint außerdem Perts Behauptung, der Geist als solcher sei etwas gänzlich Immaterielles und letztlich nur religiös Begreifbares, nämlich der „Heilige Geist“. Wenn der Geist mit Schelling als dialektische Subjekt-Objekt-Beziehung und mit Gregory Bateson als „die Welt der Informations-verarbeitung“ aufgefasst werden kann, kann der Geist nicht als etwas völlig Immaterielles bezeichnet werden.
Nimmt man beide Hypothesen der Verursachung, d.h. die der Epigenetiker (wonach sogar erworbene Fähigkeiten vererbt werden können!) und die von Candace B. Pert, zusammen, zeichnet sich eine neue Hypothese des Interaktionismus zur Lösung des Leib-Seele- Problems ab, und zwar an Hand eines dialektisch-materialistischen Informationsbegriffs, den es näher zu erklären gilt.
Laut Thomas und Brigitte Görnitz (2002) kann man die „abstrakte kosmische Quanten-information“ sogar als „das Weltsubstrat“ auffassen. Dieses Konstrukt halte ich jedoch für einen induktiven Fehlschluss, denn es wird darin ja von etwas Besonderem, der inner-weltlich konstatierten Information, auf etwas Allgemeines, den Welt-Grund, geschlossen.
Nichtsdestoweniger vermute ich, dass Information keineswegs ein bloßes Gedankending, sondern von Anfang an in der Natur, als ursprüngliche Welt-Information, vorhanden ist. Laut Rainer E. Zimmermann werden im Universum andauernd Informationen produziert. Im Jahre 2011 postulierte Zimmermann einen „Urstoff“, der allerdings nur gedacht, nicht beobachtet werden könne. Immerhin könne, wenn auch nur mathematisch-abstrakt, ein „Spin-Netzwerk“ dargestellt werden, das „auf der fundamentalen Ebene des Universums“ wie ein ständig Informationen erzeugender „Quanten-Computer“ wirke, „der zugleich hardware und software ist“. Dieses Spin-Netzwerk liege allem zu Grunde, was beobachtet werden kann. Es sei ein neuer Ausdruck für die Schöpferkraft der Natur (‚natura naturans‘) und zugleich eine Erweiterung der diesbezüglichen Erkenntnisse von Aristoteles, Spinoza, Schelling und Ernst Bloch – und speziell auch von Blochs hypothetischem „Natursubjekt“.5
Ähnlich argumentiert der Theoretiker Erich Bieramperl in seiner Autoadaptions-Theorie. Auf subatomarer Ebene erkennt Bieramperl Vorgänge, die an die Arbeitsweise von Sensoren denken lassen. Elementarteilchen gewinnen Informationen über ihre Umgebung, d.h. über andere E-Teilchen, mit denen sie Kontakt aufzunehmen vermögen. Wie ein Radar tastet das E-Teilchen seine Umgebung darauf hin ab. Information, Kontakte und Verbindungen von E-Teilchen sind keineswegs neue Phänomene. Bieramperl fand aber eine neue Erklärung dafür – mit weitreichenden Konsequenzen: Die Natur organisiert sich anscheinend selbst, aber aus einem ursprünglichen „Selbst“ heraus, das bereits Subjektives in sich zu tragen scheint. Fragt man jedoch nach der Zielursache des Ganzen, wird man nicht umhin können, die informationshaltige Materie selbst, d.h. nicht unbedingt Ernst Blochs hypothetisches „Natursubjekt“, wohl aber sein Konzept einer „unvollendeten Entelechie der Materie“, als Grundlage anzunehmen.
Für sinnvoll halte ich es außerdem, die Informationstheorie mit der Semiotik zu verknüpfen. Dann zeigt sich, dass Zeichen-, Code- und Bedeutungsprozessen stets Vorgänge der Information – als In-Form-Setzung (‚informatio‘) – zu Grunde liegen, wobei laut H. Benesch (1977) dialektisch-materialistisch zwischen „Trägern, Mustern und Bedeutungen“ zu unterscheiden ist.
Orientierung vermitteln nach wie vor auch die Bestimmungen von Gregory Bateson, der (1985) Information und Unterschied gleichsetzt, genauer: als „Unterschied, der einen Unterschied ausmacht“, noch genauer: als „Unterschied, der bei einem späteren Ereignis einen Unterschied ausmacht“. Information als solche zu erkennen, ist demnach erst auf Grund vergleichender Analyse möglich, eines Verfahrens, das bekanntlich zu den Grundformen der dialektischen Methode gehört.
Dialektik als Einheit von Identität und Nicht-Identität betrifft voll und ganz die leib-seelische Befindlichkeit des Menschen, wobei Grenzen der Erklärbarkeit, z.B. außerhalb der von Empfängnis und Tod begrenzten leib-seelischen Identität des Menschen, erkennbar werden. Anfang und Ende des Ganzen, dessen Teile wir sind, kennen wir ohnehin nicht. Womit auch die Grenzen benannt sind, in denen sich eine dialektisch-materialistische Theorie der leib-seelischen Existenz des Menschen bewegen kann. – Immerhin ist diese Existenz aber an Hand eines dialektisch-materialistischen Informationsbegriffs näher bestimmbar, nämlich als umfassendes Informations- und Interaktions-Geschehen im Rahmen einer Theorie der informationellen Einheit von Körper, Seele und Geist.6
Ergänzungen zur Erkenntnistheorie
Anthropologie kann es ohne Erkenntnistheorie nicht geben, denn die Art und Weise, wie wir Menschen die Wirklichkeit erleben und auffassen, ist von entscheidender Bedeutung für unse-re Existenz. Demgemäß ist in der Stellungnahme des Ethikrates von „erkenntnistheoretischen und ethischen Herausforderungen“ die Rede; wozu aber im Text wenig bis fast gar nichts vor-kommt, wenig zur Ethik, fast gar nichts zur Erkenntnistheorie. Daher nun Folgendes:
Gegen Kant s ‚Ding an sich‘-Konstrukt wendet Hegel mit Recht ein: „Wie anders sollen die Dinge erscheinen als ihrem Wesen gemäß?“ Sonderbar ist allerdings, welche Folgerungen Hegel aus dieser Erkenntnis ableitet. Was dem „Wesen gemäß“ ist, bestimmt er zwar u.a. an Hand der Subjekt-Objekt-Dialektik, diese jedoch als Teil der Bewegung des Absoluten Geistes: Abzuleiten sei nicht bloß aus der Wirklichkeit selbst, sondern vor allem aus der nur theologisch begründbaren Auffassung, das Wirkliche sei vernünftig und das Vernünftige sei wirklich.Wobei er Vernunft auf das „Vernehmen“ des Göttlichen zurückführt und dabei außer Acht lässt, dass es Wirklichkeit schon Milliarden von Jahren vor der Entstehung des Menschen und seinen Ideen gegeben hat; so dass es illusorisch ist, die gesamte Wirklichkeit aus Ideen und Begriffen ableiten und erklären zu können, wie Hegel es vermeint und dadurch schließlich wieder bei dem landet, was er überwinden wollte: Kants Apriorismus des Den-kens.
Um solche Zirkularität zu vermeiden, kommt es vorrangig darauf an, den Begriff ‚Wirklich-keit‘ zu klären. Bekanntlich hat Meister Eckhart (ca. 1260-1327) den Begriff in den deut-schen Sprachgebrauch eingeführt, und zwar durch eine Übersetzung des von Aristoteles (ca. 384-322 v.Chr.) geprägten Begriffs ‚energeia‘, der so viel bedeutet wie ‚im Werk-, im Wir-ken-Sein‘. Es ist ein Wirken, das anscheinend überall im Universum anzutreffen ist, und zwar wohl auch schon im Big Bang, dem „Urknall“. Denn in den Elementar-Teilchen, die im Big Bang entstanden sind, lässt sich ein Wirken schon daran erkennen, dass sie sich in ständiger Bewegung befinden, die ohne eine bewirkende Triebkraft kaum vorstellbar ist. Der Leitsatz hierzu lautet: „Die Teilchen eines Stoffes sind in ständiger Bewegung.“7
Es genügt also nicht, auf den Big Bang (den vermuteten Anfang des Universums) zu rekur-rieren und dabei mit „einer Unterscheidung“ zu beginnen, wie dies David J. Krieger (1996, S. 11) vorschlägt. Entscheidend ist vielmehr die Einsicht, dass die Wirklichkeit – auch die der E-Teilchen – tatsächlich erschlossen werden kann, wenn auch nur in Ausschnitten, und zwar nicht bloß durch die Ableitung aus Ideen, sondern durch die Bestimmung wesentlicher, spezifischer Merkmale und Eigenschaften eines Gegenstandes.
Im Falle der E-Teilchen gehört zu diesen Eigenschaften neben der auf Triebkraft beruhenden Bewegung die Tatsache, dass diese Teilchen stets bestrebt sind, sich mit anderen zu verbinden, so dass neue atomare und molekulare Synthesen (z.B. chemische Elemente) entstehen. In beiden Fällen handelt es sich um Entelechie, Zweck- und Zielgerichtetheit. Demgemäß empfiehlt es sich, den Begriff Wirklichkeit mit dem der Information zu verbinden. In Natur und Geschichte informieren Gegenstände sich und ihre Umgebung aktiv und passiv über ihren Zustand – und umgekehrt. Und besser verständlich wird nunmehr auch, warum Aristoteles den Begriff ‚energeia‘ (s.o.) häufig als Synonym von ‚entelechia‘ verwendet hat.
Anthropologisch wesentlich sind außerdem folgende Überlegungen zur Erkenntnistheorie: Auf jeden Fall ergänzungsbedürftig sind Kants Raum- und Zeit-Konzepte. Der Raum existiert nicht nur als „reine Anschauung“, sondern auch als etwas real Erfahrbares, wie dies z.B. Feuerbach auf Grund topografischer Erörterungen darlegt. Darüber hinaus gibt es neue Modelle wie die vierdimensionale Raumzeit von Einstein und Minkowski und Riemanns hochkomplexes Schichtenmodell des Raumes. – Was die Zeit betrifft, so ist auch hier nicht die Kantische Innerlichkeit das Maß aller Dinge, sondern z.B. die Hypothese einer Subjekt und Objekt umschließenden Weltzeit, wie sie Heidegger vorgeschlagen hat. (Vgl. Robra 2017 b), S. 114 ff.)
Unbefriedigend erscheint Kants uneinheitlicher Wahrheitsbegriff. Die Korrespondenztheorie bedarf der Erweiterung durch die Theorien der Kohärenz und des Konsenses (s. Robra 2017 b), S. 108 ff.). Ähnliches gilt für Kants „Horizont“-Vorstellungen. Hierzu hat Gadamer, z.B. in Form der hermeneutischen „Horizont-Verschmelzung“, neue Konzepte vorgeschlagen. Überhaupt ist zu beachten, dass sich durch die geisteswissenschaftliche Tradition der Hermeneutik seit Schleiermacher und Dilthey neue Dimensionen des Verstehens und damit der Erkenntnis eröffnet haben. Zu schmal ist die mathematisch-naturwissenschaftliche Basis, auf die Kant seinen Apriorismus stützt. Im sowohl geistes- wie naturwissenschaftlich relevanten Verstehensprozess erweist sich Erkenntnis als Problem ohne endgültige Lösungen. Die von mir herangezogenen „alternativen Konzepte“ führen durchweg Kant weiter, soweit sie sich als haltbar erweisen. Für eines der bedeutendsten dieser Konzepte halte ich Poppers Lehre von der Theoriegebundenheit der Erkenntnis.
In der Kritik der reinen Vernunft (A 804 f.) heißt es: „Alles Interesse meiner Vernunft (das spekulative sowohl als das praktische) vereinigt sich in folgenden drei Fragen: 1.Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen?“
Die erste dieser Fragen beantwortet Kant in seiner Erkenntnislehre, die zweite in seiner Ethik, die dritte in seiner Religionsphilosophie, in der er sämtliche Gottesbeweise widerlegt und dennoch an Gott und der „Seelenunsterblichkeit“ als Postulaten und Glaubensinhalten festhält. Wie die drei Fragen zusammenhängen, erörtert er in seinem gesamten Werk immer wieder; so auch in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), wo er wechselseitige Bedingtheiten zwischen Erkenntnisvermögen, Person-Sein, Verstand, Vernunft und Sinnen analysiert. Die drei zitierten Fragen ergänzt er andernorts8 durch die Frage: „Was ist der Mensch?“. In ihr mündet alles andere, denn der Mensch vereinigt in sich Erscheinung und „intelligiblen Charakter“, Zweck, Selbst- und Endzweck und somit Anfang und Ende aller Fragen.
Erkenntnistheorie, Ethik und Willensfreiheit
Spätestens seitdem Eva und Adam vom „Baum der Erkenntnis“ aßen (Genesis 3), bilden Erkenntnis und Ethik eine unverbrüchliche Einheit. Was kein Wunder ist, denn seit grauer Vorzeit dient beides als Schutz und Waffe im Überlebenskampf. Nur wer Gut und Schlecht bzw. Gut und Böse zu unterscheiden und demgemäß zu handeln vermag, kann die Selbst-erhaltung sichern, auch wenn dabei entscheidend die Tatsache mitwirkt, dass Gedanke und Gefühl, Bewusstsein und Unbewusstes, Geist und Materie ebenfalls relativ feste „Einheiten“ im Menschen bilden.
Kant begründet diese Einheit neu, z.B. durch seine Synthesen von Ding an sich und Freiheit, Freiheit und Person-Sein, die er andernorts sogar mit der Willensfreiheit verbindet. Dass Kant Ethik und Erkenntnistheorie neu zusammenbringt, ist von besonderer aktueller Bedeutung, weil Kants personale Wertethik, wie ich zeigen konnte, gerade in unserer Zeit weit verbreiteter Desorientierung überraschend aktuelle Relevanz gewonnen hat (s. Robra 2017 S. 133 ff. bzw. Robra o.J. (2020), S. 3 ff.).
Dennoch sind Updates vonnöten. Wie schon Max Scheler bemängelt hat, vernachlässigt Kant die Gefühlsebene. Schon deshalb ist es aus heutiger Sicht dringend geboten, Kants Konzept der (relativen) Willensfreiheit zu ergänzen. – Nicht sehr umfangreich, aber keineswegs belanglos sind die Ergebnisse des Libet-Experiments, zumal sie durch spätere Forschungen weitgehend bestätigt wurden. Sie besagen, kurz gefasst, dass unsere Entscheidungen nicht nur im Bewusstsein, sondern auch im Unbewussten vorbereitet werden, wobei das Bewusstsein keinesfalls entmündigt wird, weil, je nach Situation, immer eine mehr oder weniger große Marge der bewussten Entscheidungsfreiheit gewahrt bleibt. Folglich ist es unzulässig, zu behaupten, die Willensfreiheit sei eine Illusion.
Da aber trotzdem immer wieder behauptet wird, es gebe keine Willensfreiheit, wohl aber „Handlungsfreiheit“, halte ich es für erforderlich, einige Schlüsselbegriffe erneut zu erörtern, insbesondere das Bewusstsein, das Unbewusste und den Willen. Letzterer umschließt sowohl unser bewusstes als auch unser unbewusstes Sein. Der Wille ist nicht identisch mit Trieben, Instinkten und Gefühlen, wird aber von diesen beeinflusst, z.B. in Form von Antrieben, Motiven und Beweggründen, deren Bedeutung Libet neu bestätigt hat. Darüber hinaus wird der Wille geprägt von Faktoren wie Zweckvorstellungen, dem Abwägen von Vor- und Nachteilen, Zielstrebigkeit, Entschlusskraft und Durchsetzungsfähigkeit. Wir können den Willen aus freien Stücken bewusst-rational beeinflussen und sogar steuern. In unseren willentlichen Handlungen machen wir von unserer Freiheit Gebrauch. Auch diese Tatsache geht ins Unterbewusste ein. Es gibt also Willensfreiheit, was auch Libet bestätigt hat. Dies im Gegensatz zu der theologischen Leugnung der Willensfreiheit, die sich ein Martin Luther, im Unterschied zu Erasmus von Rotterdam, nicht verkneifen konnte.
Bewusstseins-Konzepte
Dass der Wille trotzdem nicht im Sinne von Schopenhauer und Nietzsche universal sein kann, erhellt schon daraus, dass er stets sowohl vom Unbewussten als auch von den höheren Fähigkeiten des Bewusstseins abhängt.
Neuro- und Naturwissenschaftler – und gelegentlich auch Philosophen – behaupten, das Be-wusstseins-Problem sei nicht lösbar, zumal es naturwissenschaftlich nicht zu erklären sei. Der Hauptgrund hierfür liegt wohl darin, dass im Bewusstsein Faktoren auftreten wie das subjekti-ve Erleben, Gefühle, Verstehen, Sprache und die unendliche Vielfalt der dialektischen Sub-jekt-Objektbeziehungen des Geistes. Hinzukommen die sogenannten Qualia, im Wesentli-chen: Wahrnehmungserfahrungen, körperliche Empfindungen, Emotionen und Gefühls-Stimmungen. Nicht zu unterschätzen ist auch die Tatsache, dass die neuronale Kombinatorik des Gehirns – als konstituierender Bestandteil des Bewusstseins – unendlich, unüberschaubar und mathematisch nicht erfassbar ist. Gleiches gilt für eine wichtige Grundlage und Quelle des Bewusstseins: das Unbewusste, einen Träger unseres bewussten Erlebens sowie unserer Entscheidungs- und Handlungsoptionen und -möglichkeiten. – Grundsätzlich ist das Bewusst-sein qualitativ, nicht quantitativ bestimmbar, daher nicht mathematisch-naturwissenschaftlich, sondern geisteswissenschaftlich und allgemein-philosophisch, dabei durchaus auch durch den Zugriff auf die Ergebnisse aller Wissenschaften – inklusive der Neurowissenschaften. – Was in der philosophischen Tradition seit langem bekannt ist, so dass sich das Bewusstsein vorran-gig unter Bezug auf diese Tradition bestimmen lässt.
Worin und woraus aber besteht dass Bewusstsein? Nur aus dem „bewussten Sein“ oder „Mit-wissen“ (‚conscientia‘), wie es die Wortbedeutungen nahe legen? (Wobei das Bewusstsein per se vom Sein „bestimmt“ wird?) Ohne spezielles Wissen über das Bewusstsein ist es jedenfalls unmöglich, es näher zu bestimmen. Keineswegs unlogisch ist Hegels Weg vom Bewusstsein zum Geist mit den Zwischenstufen Selbstbewusstsein, Verstand und Vernunft, so dass das Bewusstsein schließlich im Geist „aufgehoben“ wird. Unbestreitbar scheint jedenfalls, dass plausible Bestimmungen des Bewusstseins erst von dem als Gesamtheit dialektischer Subjekt-Objekt-Beziehungen verstandenen Geist her möglich sind. Es ist nicht denkbar ohne den Bezug zur gesamten Erlebniswelt des Menschen in seiner Konstitution durch Körper, Seele und Geist.
Zweifellos ist das Bewusstsein „das wissende Subjekt“ (Kant), erschöpft sich aber nicht darin. Und sicherlich auch nicht in der Feststellung, die Großhirnrinde sei der eigentliche physische Träger des Bewusstseins. – Für Hegel ist das Bewusstsein „nur das Erscheinen des Geistes, und der Geist „hat oder macht ... das Bewusstsein zu seinem Gegenstande“ (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften §§ 414 u. 443; dort auch die ganze Stufenfolge §§ 413-577). Wenn dem so ist, was ich nicht bezweifle, steht das Bewusstsein in ständiger Wechselwirkung mit dem Leib, dem Unbewussten, dem Ich und dem Geist. Mit der bemerkenswerten Folge, dass Maschinen auf keinen Fall Bewusstsein haben können. Maschinen (Roboter etc.) können über bestimmte kognitive Fähigkeiten verfügen, nicht aber über menschliches Bewusstsein. Den Begriff ‚Künstliche Intelligenz‘ sollte man durch den der ‚Maschinellen Kognition‘ ersetzen, zumal man in absehbarer Zukunft zwar immer mehr Teilfunktionen von Denken und Erkennen maschinell wird nachbilden können, nicht aber den an jeglicher menschlicher Intelligenzleistung beteiligten menschlichen Geist mit seinen umfassenden begrifflichen und ethischen Implikationen.
Libet bestätigt teilweise philosophische Thesen des 19. Jahrhunderts, wonach das Bewusst-sein von Nicht-Bewusstem abhängig ist (z.B. laut C. G. Carus), wohingegen Sigmund Freud fordert, das Ich müsse auch das Es, das ja weitgehend mit dem Unbewussten identisch ist, beherrschen. („Wo Es war, soll Ich werden.“) – Libet sorgt auch hier für mehr Klarheit. Unser Gedächtnis speichert – mehr oder weniger vollständig – unser gesamtes Erleben, einschließ-lich unserer Entscheidungen, Erfolge und Misserfolge. Reflexion, Traumarbeit und die Kooperation mit unseren Mitmenschen helfen uns dabei, immer wieder neue Erfahrungen zu bewältigen. All dies geht ins Unbewusste ein, somit auch die Art und Weise, in der wir von unserer Willens- und Handlungsfreiheit Gebrauch machen. Wäre das nicht der Fall, könnten wir im Notfall nicht blitzschnell reagieren, würde jede Reflex-Handlung, wie sie z.B. beim Autofahren eine Rolle spielt, zum lebensgefährlichen Risiko. (Was ein Grund mehr dafür sein dürfte, über das „autonome Fahren“ erneut nachzudenken!) – Und S. Freud können wir antworten: Wo Es ist, ist auch schon Ich, wenngleich – im Handlungs-Effekt und insbesondere im -Affekt – nicht immer zuverlässig und „rational“.
Nicht zu beunruhigen braucht uns die Tatsache, dass unser Wille fast alle unsere Handlungen begleitet. (Unbewusst ohnehin, bewusst je nach Situation.) Es gibt Willensfreiheit ohne Handlungsfreiheit, weil wir nicht alles tun können, was wir wollen. Aber gibt es auch Handlungsfreiheit ohne Willensfreiheit? Nicht, wenn Handeln dadurch charakterisiert ist, dass bestimmte Mittel bewusst zur Erreichung von bestimmten Zielen und Zwecken eingesetzt werden. Auch nicht beim Reflex-Handeln, insofern auch dort der (unbewusste) Wille mitwirkt.9
Bestätigt und erweitert wurden diese Bewusstseins-Konzepte durch die Ergebnisse, die eine Ulmer Forschungsgruppe um den Neurologen Markus Kiefer im Jahr 2015 vorgelegt hat.10
Demnach werden unbewusste Prozesse, die im Widerspruch zu unseren Absichten stehen, weitgehend von unserem Bewusstsein blockiert. "Unser Wille ist freier als gedacht", sagt Markus Kiefer, Wissenschaftler an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni Ulm. Seine Forschungsgruppe konnte mit Messungen der Hirnaktivität im Magnetresonanz- tomographen (MRT) zeigen, dass bewusste Vorsätze die Arbeit unserer automatischen Systeme im Gehirn steuern. Die Forscher wiesen erstmals nach, dass solche Vorsätze für eine gewisse Zeit Netzwerke von Bereichen im Gehirn etablieren, die den unbewussten Informa-tionsfluss im Gehirn steuern.
Seit den Arbeiten des Begründers der Psychoanalyse Sigmund Freund wurde unhinterfragt angenommen, dass unser Unbewusstes autonom und nicht vom Bewusstsein kontrollierbar ist. "Die Vorstellung des chaotischen und unkontrollierbaren Unbewussten prägt bis heute auch die akademische Psychologie und Kognitionsforschung. Dieses Dogma wurde in der Vergan-gen heit kaum kritisch hinterfragt", sagt Kiefer.
Die neuen Befunde widerlegen diese Lehrmeinung. Sie zeigen eindeutig, dass unser Bewusst-sein zu den Absichten passende unbewusste Vorgänge in unserem Gehirn verstärkt, nicht passende dagegen abschwächt. Dadurch werde gewährleistet, dass unser bewusstes "Ich" Herr im Haus bleibt und nicht durch eine Vielzahl unbewusster Tendenzen beeinflusst wird, erklärt Kiefer: "Wir sind also keinesfalls Sklaven unseres Unbewussten, wie lange Zeit angenommen."
Die bewussten Absichten und Einstellungen entscheiden somit darüber, ob ein unbewusster Prozess in unserem Gehirn überhaupt ablaufen kann.
Diese Ergebnisse stimmen weitgehend mit denjenigen Libets überein (s.o.). Dass sie aller-dings nicht für die epigenetischen und sonstigen unbewussten Körperfunktionen gelten können, liegt auf der Hand. Frappierend ist dennoch a) das hohe Ausmaß der Kontrolle durch das Bewusstsein, b) die Vielfalt der Kooperation zwischen Bw und Ubw. Ohne die weit gefassten Begriffe für beide Sphären wäre es nicht möglich, den genannten Befunden und Erkenntnissen gerecht zu werden. Mit erheblichen Folgen für die komplexen Fragen von Ethik, Lebensführung, Gesundheitsfürsorge, Psychohygiene usw.
Außerdem: Nicht zu bestreiten ist, dass die Kontrolle durch das Bewusstsein nicht immer gelingt. Man denke nur an die relativ häufigen Fälle von krankhaften Veränderungen, Ungeschicklichkeiten, Naturkatastrophen, Bosheit, Kriminalität und anderen angeborenen und/oder erworbenen Beeinträchtigungen. – Die Macht des Unbewussten ist – wie die des Bewussten – nicht zu überschätzen, aber auch nicht zu unterschätzen. Anscheinend aber müssen und können Balance und Maß individuell herausgefunden und hergestellt werden.– Auch wenn unklar sein mag, wo innerhalb einer Klassengesellschaft die Grenzen des freien Willens liegen.11
Sprache, Bewusstsein und Welterfahrung
„Im Anfang war der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und Gott war der Logos.“ So beginnt das Johannes-Evangelium. Goethe antwortete: „Am Anfang war die Tat!“ So als ob dem Handeln nicht Entscheidungen im Bewusstsein bzw. im Unbewussten vorangingen. Wenn alles mit dem Logos begann, steht am Anfang die Einheit von Sprache, Rede, Vernunft und Verstand, also von Sprache und Bewusstsein, mit Gott als dem Garanten dieser Einheit, also mit theologischer Begründung. So dass hinsichtlich des (möglichen) Wechsel-Verhält-nisses von Sprache und Bewusstsein weitere Überlegungen erforderlich sind.
Fragt man nach dem Ursprung der Sprache, stößt man auf die wahrscheinlich am weitesten gefasste Hypothese bei Lothar Wendt (1988), der eine Entwicklungslinie sieht von der in der Ur-Materie enthaltenen In-Formation über das assoziative Verhalten der Ur-Elementar-teilchen und die evolutionär entstandenen genetischen Codes und die Tiersprachen bis hin zur Wortsprache des Menschen.12
Zum Form-Inhalt-Problem der verbalen Sprache stellte Mario Wandruszka fest: „Wörter sind Bezeichnungen und haben Bedeutungen.“ Was aber bedeutet es, dass die Bedeutung eines Wortes sich aus der Kombination von Wort-Form und Wort-Inhalt ergibt, wobei die Wort- Form „willkürlich“ ist und der Wort- Inhalt eine „verallgemeinerte Vorstellung“ enthält? Das Arbiträre, Willkürliche der Wort-Form lässt sich einfach an Hand der Vielzahl der natürlichen Sprachen erklären. Das Graphem `Tag‘ bzw. die Lautfolge ‚Te-a-ge‘ kann auch anders repräsentiert werden, z.B. als ‚day‘, ‚jour‘, ‚dies‘, ‚dia‘ usw. Das Wort kann als Zeichen in einer Vielzahl unterschiedlicher Gestalten auftreten. Bedeutungen können durch unterschied-liche Zeichen evoziert werden. – Wie aber steht es mit dem Wort- Inhalt ? Dieser gehört nicht zur Außenwelt, sondern stets zum individuellen Bewusstsein eines Menschen. Es ist ein mentaler, geistiger Inhalt, auch wenn sich in Bildwörterbüchern ca. 80 % des Wortschatzes einer Einzelsprache jeweils durch ein einzelnes Bild (Abbild: Foto, Zeichnung usw.) wieder-geben lassen. Wobei die Wahl eines bestimmten, zu einem bestimmten Wort passenden Bildes natürlich stets vom Gutdünken des Urhebers bzw. Produzenten abhängt.
Wenn jemand an eine KATZE denkt, „spricht“ seine Innere Stimme, die nicht nach außen dringt, von niemandem gehört werden kann. Man ist auch in der Lage, sich zu dem innerlich „gehörten“ – innerlich vernommenen – Lautbild der Inneren Stimme ein Schriftbild vorzu-stellen. In beiden Fällen verbindet sich damit automatisch – als Evokation – der Bezug von der Form zum Inhalt des Wortes, verweist das Zeichen auf einen imaginierten Sachverhalt, zumal in einer bestimmten Situation. Die Form ‚Katze‘ evoziert ein (Ab-)Bild, das dem einer evtl. vor mir herlaufenden Katze entspricht, aber auch auf alle anderen real existierenden Katzen anwendbar ist. Wie dieses Bild tatsächlich und im Einzelnen aussieht, können Außen-stehende nicht sehen oder wissen. Dazu ist nur imstande, wer gerade – als Einzelperson – dabei ist, sich mit dem Wort ‚Katze‘ eine Katze vorzustellen. – Was hier stattfindet, sind offensichtlich markante, mit der Sprache verbundene Zustände des Bewusstseins.
Als Person ist das Individuum, der Einzelmensch, Teil größerer Gemeinschaften, so auch einer oder mehrerer Sprach-Gemeinschaften. Daher ist anzunehmen, dass die verallgemei-nerten Vorstellungen als Sprach-Inhalte zwar unterschiedlich gestaltet sind, dass aber die Inhalts-Gestalten der Individuen einander so ähnlich sind, dass sie verbalsprachlich kom-muniziert, mitgeteilt werden können.
Natürlich kann eine solche Mitteilung auch non-verbal, z.B. durch ein Foto einer bestimmten Katze erfolgen. Und auf diese Weise sogar einfacher und sicherer als durch das gesprochene oder geschriebene Wort. Und vor allem: Das bloße Wort ‚Katze‘ reicht nicht, um eine bestimmte Katze zu beschreiben, die gerade nicht zugegen, nicht anwesend ist. Zu einer solchen Beschreibung sind stets mehrere Wörter / Worte notwendig. Aber auch dann wird es nur selten gelingen, einem/r Adressaten/in ein dermaßen genaues Bild einer bestimmten Katze zu vermitteln, dass er / sie diese Katze sofort wiedererkennen würde, wenn sie irgendwo auf-taucht. Sprache bildet also ab, aber nicht vollständig, nicht ganz genau, nicht im Verhältnis 1:1.
So dass sich nunmehr die Frage stellt, in welchem Sinne überhaupt von „Welterfahrung durch Sprache“ (Gadamer) die Rede sein kann. Hier kann zunächst die Tatsache weiterhelfen, dass man mit Hilfe von Worten / Wörtern und Begriffen einer Sprache zwar nicht 1:1 abbilden, aber doch das Wesen einer Sache bzw. eines Sachverhalts oder einer Person an Hand ihrer spezifischen Eigenschaften und Merkmalen beschreiben kann. Eine Katze ist vierbeinig wie ein Hund, kann aber nicht bellen, sondern miauen (was der Hund nicht kann). Ihr Körper ist anders geformt als der eines Hundes oder eines anderen Tieres. Worin die Unterschiede, z.B. der Pfoten, des Kopfes mit den charakteristischen Schnurrhaaren usw. bestehen, kann mit geeigneten Begriffen erklärt werden.
Darüber hinaus wird ersichtlich, wie in der Wesensbestimmung Sprache, Denken und Bewusstsein ineinander übergehen. Um ein charakteristisches Merkmal als solches erkennen zu können, muss man auf im Gedächtnis gespeicherte Bewusstseinsinhalte zurückgreifen können, die aus früherer Erfahrung stammen. Im Nach-Denken, also im dialektischen Subjekt-Objekt-Bezug, findet man heraus, mit welchen bereits vorhandenen Begriffen man den neuen Gegenstand bestimmen kann, d.h. ob frühere Bewusstseinsinhalte sich auch auf den neuen beziehen lassen. Man benutzt den Begriff „Schnurrhaare“ als Unterscheidungs-merkmal. Der sprachliche Begriff passt zu dem wahrgenommenen bzw. vorgestellten bzw. gedachten bzw. erinnerten Bewusstseinsinhalt: zweifellos im Zusammenspiel und in der Einheit von Bewusstsein, Denken und Sprache. Herauszufinden ist jeweils, mit welcher Ver-lautbarung, d.h. mit welchen Begriffen, Worten/Wörtern, Ausdrücken, Sätzen und Texten bzw. Textzusammenhängen ein bestimmter Bewusstseinsinhalt bestmöglich dargestellt werden kann.
Doch die Welt besteht natürlich nicht nur aus Hunden und Katzen – und auch nicht nur aus „Wesensschau“ (oder „Wesenserschauung“, wie Husserl sie nannte). So dass sich die Frage stellt: Was heißt allgemeine Welterfahrung durch Sprache ?
Wesentliches hierzu findet sich in Hans-Georg Gadamers ‚Wahrheit und Methode‘, und zwar in dem Kapitel „Sprache als Welterfahrung“ (S. 415-432).13 Demnach beruht die Individuali-tät des Bewusstseins großenteils auf der Individualität der Sprache, die auch schon in Humboldts Formel von der „Sprache als eigene Weltansicht“ zum Ausdruck kommt, wobei Humboldt dem „inneren Sprachsinn“ durch seine Untersuchung der „inneren Form“ der Sprache auf die Spur kam (a.a.O. S. 416). Was jedoch keineswegs auf eine Gleichsetzung von Sprache und Denken hinausläuft, und zwar auch nicht in Humboldts Feststellung, dass die Sprache „von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch“ macht (a.a.O. S. 417). Vielmehr sei hierfür, wie Humboldt erklärt, eine allen inhaltlichen Anwendungen überlegene „sprachliche Kraft“ verantwortlich. – Was Gadamer allerdings für eine „Abstraktion“ hält, die er vehement ablehnt, indem er betont:
„ Sprachliche Form und überlieferter Inhalt lassen sich in der hermeneutischen Erfahrung nicht trennen. Wenn eine jede Sprache eine Weltansicht ist, so ist sie das in erster Linie nicht als ein bestimmter Typus von Sprache, (wie der Sprachwissen-schaftler Sprache sieht), sondern durch das, was in dieser Sprache gesprochen wird bzw. überliefert ist.“ (ebd.)
Mit anderen Worten: Erst über die Inhaltsseite der Sprache können Synthesen von Sprache und Denken gelingen, Sprache und Denken ineins gedacht werden. Wozu Gadamer aller-dings die Frage stellt, wie sich die Inhalte der Sprache tatsächlich zu den Inhalten der Welt verhalten, und herausfindet, „dass die Sprache ihrerseits gegenüber der Welt, die in ihr zur Sprache kommt, kein selbständiges Dasein behauptet.“ (a.a.O. S. 419) Wonach es Sprache an-scheinend nur gibt, insofern sich Welt in ihr „abbildet“, zur Darstellung kommt. Wobei „die Welt“ nicht mit der Umwelt zu verwechseln ist (S. 420).
Überdies ist zu beachten, dass im Verhältnis der Sprache zur Welt Sachverhalte eine Rolle spielen, und zwar auch solche negativer Art, wozu Gadamer erklärt:
„In der Struktur des Sachverhaltes, der sich abhebt, ist gelegen, daß in ihm stets Nega-tives mit da ist. Dies zu sein und nicht jenes, macht die Bestimmtheit alles Seienden aus. Es gibt also grundsätzlich auch negative Sachverhalte. Das ist die Seite am Wesen der Sprache, die das griechische Denken zuerst gedacht hat.“ (S. 421)
Was zugleich als Voraussetzung für jede Art von Verständigung anzusehen ist, zumal diese nur im Gespräch zustande kommen kann. Was nicht bedeutet, dass Sinn und Zweck von Sprache sich darin erschöpfen. Sprache ist „kein bloßes Mittel zur Verkündigung“, und zwar schon deshalb nicht, weil Sprache in größeren Zusammenhängen, wie z.B. des Lebens-vollzugs, der Lebens- und Sprachgemeinschaft usw. stattfindet. Immerhin lassen sich am Sprachwandel auch Veränderungen der Welt-Inhalte ablesen. Manche traditionsbeladene Begriffe, wie z.B. ‚die Tugend‘, haben mit der Zeit an Gewicht und Bedeutung verloren (S. 425).
Alles in allem: Sprachlichkeit hat Vorrang, aber in ihr vollziehen sich nicht sämtliche Subjekt-Objekt-Bezüge – und somit des Bewusstseins –, auch nicht in Form von Wissen-schaft, wozu Gadamer anmerkt:
„ Der Grundbezug von Sprache und Welt bedeutet … nicht, daß die Welt Gegenstand der Sprache werde. Was Gegenstand der Erkenntnis und der Aussage ist, ist vielmehr immer schon von dem Welthorizont der Sprache umschlossen. Die Sprachlichkeit der Welterfahrung schließt nicht die Vergegenständlichung der Welt in sich.“ (S. 426)
Und vorläufig abschließend:
„Wir gehen davon aus, daß in der sprachlichen Fassung der menschlichen Welt-erfahrung nicht Vorhandenes berechnet oder gemessen wird, sondern das Seiende, wie es sich dem Menschen als seiend und bedeutend zeigt, zu Worte kommt. Darin – und nicht in dem methodischen Ideal der rationalen Konstruktion, das die moderne mathematische Naturwissenschaft beherrscht – vermag sich das in den Geisteswissen-schaften geübte Verstehen wiederzuerkennen. Wenn wir oben die Vollzugsart des wirkungsgeschichtlichen Bewußtseins durch Sprachlichkeit charakterisierten, so war es, weil Sprachlichkeit unsere menschliche Welterfahrung überhaupt charakterisiert. So wenig in ihr die ‚Welt‘ vergegenständlicht wird, genauso wenig ist die Wirkungs-geschichte Gegenstand des hermeneutischen Bewußtseins.“ (S. 432)
Wirkungsgeschichte ist eben immer schon Teil des verstehenden Bewusstseins – und somit auch Teil desjenigen Verstehens, das Gadamer mit dem Begriff ‚Horizontverschmelzung‘ umschreibt.14
Wobei in den Objekt-Horizonten Gegenstände des Mikro-, Meso- und Makro-Kosmos vorkommen, auf die sich das je subjektive Bewusstsein beziehen kann, um sie in bewusstes Sein bzw. zum Wissen gebrachtes Sein zu überführen. Da diese Gegenstände aber nur als end-liche bestimmbar sind, kann es ein „unendliches Bewusstsein“ anscheinend nicht bzw. nicht außerhalb des religiösen Glaubens geben (s.o. S. 5). So dass es sich wahrscheinlich verbietet, das Wechselverhältnis von Sprache und Bewusstsein als „quasi religiös“ zu bezeichnen.
Beide, Sprache und Bewusstsein, stammen aus dem Ur-Grund der ursprünglich in der Materie enthaltenen In-formation. Allerdings ist die Sprache viel früher entstanden als das Bewusst-sein des Menschen. Dass auch Tiere Bewusstsein haben, wird inzwischen kaum noch bestrit-ten. Kriterium ist u.a. das Vorhandensein eines Nervensystems und von episodischem Ge-dächtnis. – Dass das menschliche Bewusstsein sich nicht nur auf Endliches, sondern auch auf Unendliches beziehen kann (indem es z.B. in der Sprache von „endlichen Mitteln unendlichen Gebrauch“ macht), bedeutet nicht, dass es selbst als solches unendlich ist. Als Selbst-Bewusstsein teilt es vielmehr mit dem Mensch-Sein das Schicksal der Endlichkeit. Das „unendliche“ Bewusstsein ist also eine (religiöse) Fiktion. Ähnliches gilt für das sogenannte „kollektive“ Bewusstsein. Das individuelle menschliche Bewusstsein bezieht sich selbst-verständlich auch auf Kollektives, Gemeinsames, Allgemeines, existiert aber in seinem Wesen als Selbst-Bewusstsein, also nicht kollektiv. – Umstritten ist, ob es Bewusstseinser-weiterung durch Drogen gibt.
Sprache und Bewusstsein (Liebrucks)
Es bleiben einige Fragen offen, auf die Gadamer nicht eingeht, nämlich:
1. In welchem Verhältnis stehen Sprache und Sprecher*in zu einander?
2. Entsteht Sprache durch Bewusstsein oder Bewusstsein durch Sprache?
3. Wie ist Philosophie „von der Sprache her“ zu betreiben?
4. Wie verhalten sich Sprache und Begriff zu einander?
5. Ist Sprache wesentlich Mythos und Logos?
Diese Fragen behandelt Bruno Liebrucks (1911-1986) in seinem 7-bändigen Monumental-werk Sprache und Bewusstsein (1964-1979), das Fritz Zimbrich (1980) zusammenfassend analysiert hat, und zwar folgendermaßen:
Zu Frage 1: Sprache und Sprecher*in
Sprache soll sowohl der subjektiven als auch der objektiven Seite der Reflexion gerecht werden. Hierzu benutzt Liebrucks den Begriff ‚Sphäre‘. In ihr findet die Reflexion statt; sie ist also kein Naturgegenstand.15 Dies ebenso wenig wie die „Paraphrase“, die Liebrucks auch „dienende Anpassung“ nennt. Wie Sprecher*innen damit umgehen, steht ihnen frei; wobei die Paraphrase inhaltlich nicht mehr als „das bereits Gesagte“ aussagt. Wozu Liebrucks bemerkt:
„Dabei werden wir uns an die Texte halten, wenn wir es für notwendig halten, und werden über sie hinausgehen, wenn wir es für notwendig halten. Dem Leser wird ein zweischichtiges Hinhören anempfohlen, wie er es bei Sprachgebilden immer schon vornahm, da hinter den Sprachgebilden immer noch ein zweiter Sprecher steht, nämlich Sprache selbst.“ (a.a.O. S. 2)
Zu Frage 2: Sprache durch Bewusstsein oder umgekehrt?
Für Liebrucks ist Bewusstsein gleich „Bewußt-Sein“, das in seiner Besonderheit zu würdigen und vom landläufigen Sprachgebrauch abzugrenzen ist, wozu er erklärt: Das Bewusstsein „ist nicht ein Besitz des Bewußtseienden. Es ist vielmehr das, was ihn in all seinem Tun trägt, auch dann, wenn ihm gerade dies nicht bewußt ist. Bei der Suche nach diesem Bewußt-Sein ist man zunächst auf die Zeit verwiesen, in der ein Bewußtseien-der bewußt ist. Denn aus ihr entwickelt sich das Denken und das Handeln.“ (ebd.)
Womit Zeit (im Sinne Heideggers?) auch zur „Substanz“ von Sprache wird, d.h. zu dem, was der Sprache im Bewusstsein zu Grunde liegt. Dabei bleibt die Zeit selbst dem Erkennen schon deshalb nicht unmittelbar zugänglich, weil in ihr – als „Einheit von Vergangenheit, Gegen-wart und Zukunft“ – die Zukunft unbekannt ist, während auf der Gegenwart die „Unentschie-denheit der Vergangenheit“ lastet, ohne dass man sich diesem Geschick je entziehen könnte. Für Liebrucks ist die Zeit „existierender Begriff“ bzw. „das existierende Bewußtsein“ bzw. „die existierende Bewußtheit“ (a.a.O. S. 3). Und als solche ist die Zeit für ihn auch „immer die Einheit von Geschehen und den Erzählungen über dieses Geschehen“ (ebd.). Zeit somit also als Einheit von Geschichte und Mythos. Auch diesen Aspekten gegenüber empfiehlt Liebrucks das „zweischichtige Hinhören“, um sie als Formen von Bewegung verstehen zu können. Denn: „Die Zeit begegnet … nicht unmittelbar; sie ist nicht reine Anschauungsform. Sie begegnet in >der Gegenwart der Vergangenheit des Vergangenen<“ (ebd.). Was nur einem Bewusstsein möglich sei, das zugleich Sprache ist. Diese darf aber nicht auf ihren Zeichen-Charakter reduziert werden, sondern muss in ihrem (Gesprächs-)Vollzug und in ihren Bedeutungen gewürdigt werden. Denn die Sprache sei selbst „das Ereignis der Zeit“ (S. 4). Folglich müssten Modetrends bekämpft werden, die diese Einzigartigkeit der Sprache miss-achten. „Entsprachlichung“ entstehe aus „Logophobie“ (Foucault), aus Angst vor dem sprach-lichen Ausdruck.
Darüber hinaus: Als „Ereignis der Zeit“ geht das Bewusstsein anscheinend der Sprache voran; doch es vereinigt sich mit dieser, um Vergangenes gegenwärtig zu machen. Was der Tatsache widerspricht, dass die Sprache (bzw. jedenfalls ihre Vorformen) in der geschichtlichen Zeit früher entstanden ist als das menschliche Bewusstsein (s.o.). Auf diesen Widerspruch wird zurückzukommen sein (s.u. zu Frage 5).
Zu Frage 3. Philosophie „von der Sprache her“ zu betreiben, bedeutet, dass sie sich in der Sprache und durch sie selbst interpretiert. Was möglich ist, weil Sprache per se auf Wirklich-keit beruht und abzielt. Hierzu erklärt Liebrucks:
„Unter ‚Denken der Sprache‘ sei ein Denken verstanden, das unser sprachliches Vor-gehen ins Bewußtsein aufnimmt, also dasjenige ‚Denken‘ ins Bewußtsein aufnimmt, das Sprache schon immer geübt hat, wenn wir auch nicht wissen, wie Menschen sich in ihren Sprachbahnen fanden.“ (S. 5 f.)
Wobei es darauf ankomme, sich zunächst von der Wert-Wirklichkeit zu distanzieren, weil nur dann mit Sprache Erfahrungen gemacht werden könnten, wozu Zimbrich feststellt: „Der Umgang mit der Sprache, die doch immer zugleich die eigene und die der anderen ist, erfordert anderes Verhalten als der Umgang mit verwertbaren Dingen.“ (S. 6) Durch Sprache seien wir in der Lage, unsere „Gedanken rein und unverfälscht“ zum Ausdruck zu bringen (ebd.) – mit der Kehrseite, dass Sprache auch Sachverhalte unnötig komplizieren und sogar den Verstand „verhexen“ könne, wie Wittgenstein behauptet.
Zum Verhältnis von Sprache und Denken gehört allerdings auch die Tatsache, dass das Denken in der Sprache bestimmten Zwecken dient, darunter vor allem dem „Begreifen der Wirklichkeit“, und zwar stets in bestimmten Kontexten und Situationen (S. 6).
Zu Frage 4: Sprache und Begriff
Liebrucks‘ Sprache und Bewußtsein dreht sich vornehmlich um die Frage nach dem Begriff. Denken heißt für Liebrucks Denken in Begriffen als „Begreifen von Wirklichkeit“ (S. 9) Was immer auch „Spannung zwischen der Einzelheit und der Allgemeinheit“ bedeute (ebd.) Erfasst der Begriff die Sache, wird aus der begriffenen Sache ein Sachverhalt. Dadurch avanciere der Begriff sogar zur „Weltbegegnung im logischen Status Bewußt-Sein“, wodurch der Begriff sogar zum „Spender unseres Lebens im biologischen Sinne“ werde (ebd.).
Zu Frage 5: Sprache als Mythos und Logos?
Der Begriff verleihe dem Menschen Sicherheit, Halt und Orientierung im Leben, das im Mythos, d.h. „in Geschichten gegenwärtig“ bleibe (S. 12). Was Liebrucks auch als einen Aspekt der „Einheit von Mythos und Logos“ wertet. Erfahrung geht also nicht etwa in den Wissenschaften auf, wohl aber – weitgehend – in der Sprache, in der das persönliche Wissen von hohem Belang sei. Während Sprache und Erfahrung nicht ohne Mythos existieren. Und:
„Erfahren sein heißt, im Bewußtsein der Erfahrung der Sprache leben. Es heißt also nicht, einen Sack voll Erfahrungen mit sich herumtragen, sondern in der Sprache, in ihrer Erfahrung sein. >Der Mensch denkt nur vermittelst der Sprache; je reicher dieje-nige ist, deren er sich bedient, le leichter und freier in ihren Bewegungen, desto fruchtbarer wird sie unter seinen Händen in neuen Verbindungen, desto weiter und tiefer dringt er in das Gebiet der Wahrheit ein< (… Zitat W. v. Humboldt).“ (S. 13)
Wobei Humboldt leider nicht-verbale Denkvorgänge wie das Denken in Bildern außer Acht lässt.
Nichtsdestoweniger dürfte feststehen, dass die Sprache die Art und Weise mitprägt, wie sich Bewusstsein bildet. Was jedoch nicht bedeuten kann, dass Sprache allem Bewusstsein zu Grunde liegt. Als ursprüngliche In-formation bestimmt und beeinflusst Sprache jegliches Bewusstsein, aber dieses reicht – als das in umfassenden, dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen „gewusst gemachte Sein“ – seinerseits in Dimensionen, die über diejenigen der Sprache hinausgehen, religiös sogar bis hin zum „universellen“ Bewusstsein, also dorthin, wo letztlich jegliche Sprache verstummt.
Ethik der Sprache
In einer Zeit, in der immer wieder von Hassrede, Verrohung der Sprache, Fake News usw. die Rede ist, rückt die Frage nach einer Ethik der Sprache in den Vordergrund. Es ist eben nicht gleichgültig, wovon wir uns „berieseln“ lassen, was wir von uns geben und wie wir es in Worte oder Wörter kleiden. Auch beim Verstehen von Sprache schlafen Ethik und Moral nicht, im Gegenteil. Dagegen sind Hassrede und Sprachverrohung nur dann möglich, wenn nicht mehr auf die Innere Stimme des Gewissens gehört wird. Sprache kann hintergangen werden, Lüge und Unwahrhaftigkeit an die Stelle von Wahrheitsliebe, Anstand und Ehrlichkeit treten. Was natürlich auch für Politiker-, Jugend-, Kiffer-, Ganoven-Sprachen usw. gilt. – Und umgekehrt kann das treffende Wort zur rechten Zeit Wunder bewirken, seelische Wunden heilen, therapeutisch wirken nicht nur im Sinne der Psychotherapie. Sprache kann besänftigen, Missverstehen beseitigen, Mut machen, positives Handeln bewirken. In der Dichtung kann Sprache die Tiefen, Geheimnisse, Düsternisse und feinsten Regungen des Seelenlebens ausleuchten. Ohne Sprache hätten wir keinen adäquaten Zugang zur Welt – einschließlich der Gefühls-, Wahrnehmungs- und Vorstellungs-Welten –, zum Denken und zu jeglicher Erkenntnis.
Sprache ist stets ein Produkt, ein Ausdruck des Bewusstseins – und doch müssen wir uns unsere sprachliche Ausdrucksweise immer wieder auch bewusst machen. Wir müssen überprüfen, was und wie wir reden oder schreiben. Denn wir sind diejenigen, die sprachlich handeln, nicht irgendein ominöses „Es“.
Sprache wird von Anfang an erlernt, erscheint im Bewusstsein, ehe sie ins Gedächtnis und damit ins Unbewusste eingeht. Und genau dieser Vorgang ist von höchstem moralischem und ethischem Belang und Interesse. Das sprachliche Bewusste bestimmt das Unbewusste in jedem Gedächtnis, jedem Gehirn. Und umgekehrt kann das Unbewusste – nicht zuletzt auf Grund seiner ursprünglichen Konstitution und Formung durch das Bewusstsein – ent-scheidenden Einfluss auf unsere spontanen Reaktionen ausüben, aber auch auf unser gesamtes sprachliches und nicht-sprachliches Handeln. Jede Form von Hassrede muss daher entschlos-sen und nachhaltig bekämpft werden. Zumal der Missbrauch verbaler Sprache auch zu Rechtsbrüchen führen kann, z.B. in Form von Beleidigung, Verleumdung und übler Nach-rede. Wobei es Vorstufen hierzu schon im Alltäglichen gibt. Wer sich abfällig über seine Mitmenschen äußert, steht in der Gefahr des Rechtsbruchs.
Und ein nicht weniger schädlicher Einfluss kann von unreflektiertem Medien-Konsum ausgehen. Wer das eigene Bewusstsein immer wieder von Gewaltszenen, Pornografie, rasend schnellem Bildwechsel in Video-Clips, plumpen Werbetricks usw. in Beschlag nehmen lässt, läuft Gefahr, schweren psychischen Schaden bis hin zum Verlust der Selbstkontrolle zu erleiden. – Umso mehr kommt es darauf an, sich über das Wechselverhältnis von Sprache und Bewusstsein Klarheit zu verschaffen.
Zusammenfassung
Sprache und Bewusstsein bedingen und beeinflussen sich gegenseitig, obwohl die Sprache bzw. ihre Vorformen wesentlich früher entstanden sind als das menschliche Bewusstsein. Beide entstammen wahrscheinlich dem gleichen Ur-Grund: der in der Ur-Materie enthaltenen In-formation oder In-Form-Setzung. Aus diesem Ursprung bezieht die der Sprache zu Grunde liegende Sprachkraft anscheinend ihre spezielle Funktion: die der Herstellung von Bedeutun-gen.16 „Wörter sind Bezeichnungen, haben Bedeutungen.“ (M. Wandruszka) – Bewusstsein ist zunächst bewusstes Sein, d.h. zum Wissen gebrachtes Sein.
Wie Sprache im Bewusstsein funktioniert und sich auswirkt, lässt sich an Hand tiefschürfen-der Untersuchungen z.B. von H.-G. Gadamer und B. Liebrucks darstellen. „Religiös“ wäre die Wechselwirkung von Bewusstsein und Sprache nur dann, wenn ein „universelles“ Bewusstsein anzunehmen wäre; wofür es jedoch keine wissenschaftlichen Belege oder An-haltspunkte gibt. – In der Wesensbestimmung gehen Sprache, Denken und Bewusstsein in-einander über. Umstritten ist, ob es Bewusstseinserweiterung durch Drogen gibt.17
Zusatz: Eine „philosophische Sprach-Anthropologie“, gefolgt von einem Kapitel über „Er-fahrung und Sprache in philosophischer Reflexion“, hat neuerdings Helmut Fahrenbach vor-getragen in: Existenzanalyse und Sprachreflexion, Mössingen-Talheim 2024, S. 197-282, auf deren Einzelheiten ich hier leider nicht eingehen kann, zumal KI darin nicht vorkommt.
Sprache und Künstliche Intelligenz
Hier stellt sich die Frage, wie es überhaupt gelingt, in KI Sprache aufzunehmen und zu verar-beiten. Dass KI dies „lernen“ kann, nehme ich – im Unterschied zu einigen anderen Autoren – nicht an, weil beim menschlichen Lernen u.a. Gefühle, Verstehen, Körper- und Bewusstseins-Funktionen aktiviert werden, die keiner Maschine zugänglich sind. Dagegen hat KI anschei-nend möglich gemacht, was sich beim Menschen als unmöglich erwiesen hat: das „Eintrich-tern“ von Sprache. Hierzu müssen KI-Systeme, zumeist Künstliche Neuronale Netze (KNN), zunächst die Strukturen eines Textes ermitteln. Wie das geschieht, beschreibt Michael Notter wie folgt:
„Indem das KI-System riesige Mengen an geschriebenem Text durchforstet und analysiert, welche Wörter nebeneinander vorkommen, welche in positivem oder negativem Kontext erscheinen, welche Freude oder Traurigkeit, Ernsthaftigkeit oder Humor ausdrücken, kann es die Informationsmuster erkennen, die die deutsche Sprache ausmachen.
Ein KI-System kann dann dasselbe für andere Sprachen tun und lernen, wie man die genaue Bedeutung und den Kontext zwischen ihnen übersetzt. Jedes Wort, jeder Satz und jeder Kontext trägt einen winzigen Teil dazu bei, das KI-System in die Lage zu versetzen, vorherzusagen, welche Wörter in einer Sequenz aufeinander folgen sollten und welche Wörter und Formulierungen einander korrekt übersetzen.“18
Dabei geht es anfangs darum, Wort für Wort zu übersetzen, danach um Kontexte, Strukturen und Bedeutungen auch größerer Zusammenhänge. Hierzu Notter:
„Sobald ein System gelernt hat, welche Wörter in welchem Kontext verwendet werden, kann es eine Rechtschreibprüfung Ihres Textes durchführen und Ihnen Synonyme vorschlagen.
Es kann Ihre beruflichen Dokumente zum Beispiel mit anspruchsvolleren Wörtern verbessern oder bessere Ausdrucksmöglichkeiten für Beiträge in sozialen Medien vorschlagen. Diese KI-Systeme können Texte in Hunderte von verschiedenen Sprachen übersetzen, und das schneller und genauer als jeder Mensch.“ (ebd.)
Auch zum Erkennen unterschiedlicher Autoren-Stile und zur Verbesserung von Chatbots kann KI beitragen. Und:
„Von dort aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Erstellung von Originaltexten. In nicht allzu langer Zeit wird ein KI-System in der Lage sein, einen neuen Harry-Potter-Roman im Stil von Shakespeare zu schreiben und mit der Stimme von Barack Obama vorzulesen.
Spätestens dann werden wir uns erneut tiefgreifende, philosophische Fragen darüber stellen müssen, was Intelligenz bedeutet.“ (ebd.)
Vorerst aber bereiten KI-Systeme nicht selten auch Probleme und Verdruss. Robert Klatt stellt (2020) z.B. fest, „dass Sprachassistenten ungewollt durch falsch verstandene Signalwörter aktiviert werden“. Probleme entstehen auch durch „Abbrüche, Stotterer, Fülllaute wie ‚äh‘ oder ‚hm‘ und auch Lacher oder Huster, wenn Menschen miteinander sprechen.“19
Ähnliches passiert bei undeutlicher Aussprache. An entsprechenden Verbesserungen der KI-Systeme wird laufend gearbeitet. Über eine Vielzahl solcher Probleme hat Christoph Drösser (2024) eine Schrift unter dem Titel Was macht KI mit unserer Sprache veröffentlicht. Als fehleranfällig erweisen sich demnach Chatbots dadurch, dass sie grundsätzlich auf jede Frage antworten, und z.B. auch dann, wenn sie auf Fragen antworten sollen, auf die sie nicht vorbereitet, d.h. nicht mit entsprechenden Informationen „gefüttert“ sind. In solchen Fällen gäben sie „baren Unsinn“ von sich. Im Übrigen sei die KI-Sprachfähigkeit nicht mit der menschlichen vergleichbar, zumal erstere angeblich nur auf Syntax, nicht auf Semantik beruhe. Hierzu bemerkt Josef König in einer Rezension der Schrift von Ch. Drösser:
„Man müsse sich davor hüten, alles zu glauben, was sie [die KI] antwortet. Sie sei zu keinem Sprechakt, auch zu keinem absichtlichen Handeln fähig. Ihr fehle das, was uns als Menschen ausmacht: die gesättigte sinnliche und geistige Lebenserfahrung. Maschinen versagten zudem vollends bei Humor, Witz und Ironie, so Drösser. Und wenn die Modelle demnächst wegen rechtlicher Einschränkungen nur mit Sprach-ergebnissen anderer Maschinen »gefüttert« würden, könnten sie in ihrer Sprach-entwicklung verarmen: Fachleute sprechen von einem »model collapse«.“20
Für verfehlt halte ich allerdings die Behauptung, dass KI-Systeme nur über Syntax, nicht aber über Semantik verfügen (s.o.). Wäre dies der Fall, könnte kein Chatbot analysieren, „welche Wörter nebeneinander vorkommen, welche in positivem oder negativem Kontext erscheinen, welche Freude oder Traurigkeit, Ernsthaftigkeit oder Humor ausdrücken“ (s.o.). Dass Chat-bots hierzu sehr wohl in der Lage sind, kann ich aus eigener Erfahrung, z.B. mit ‚Microsoft-Copilot‘, bestätigen. – Im Übrigen ist wohl einzuräumen, dass bei KI in Bezug auf die Fähigkeit zur Spracherkennung und -verarbeitung Einiges noch in den Kinderschuhen steckt. Umso mehr wird es darauf ankommen, die neue Technik auch in Zukunft stets unter strenger Kontrolle zu behalten.
Zusatz: Bemerkenswert ist der Hinweis, dass mittels KI neuerdings auch „die Sprache der Schweine“, d.h. deren Grunzen, Quieken usw., entschlüsselt werden kann. Für die artge-rechte Tierhaltung dürfte dies einen beachtlichen Fortschritt bedeuten, zumal dann, wenn aus den Lautäußerungen tatsächlich mit Sicherheit auf die Gemütszustände der Tiere geschlossen werden kann.21
Kunst und KI
a) Ästhetik der Person
Wie eine personalistische Ästhetik beschaffen sein kann, habe ich in meinem Personalismus-Buch (2003) dargelegt, so dass ich mich im Folgenden kurzfassen kann. Künstler*innen genießen das Privileg der Nicht-Entfremdung, der wahrhaft freien Entfaltung ihrer Persön-lichkeit in ihren Werken. Bereits in der Gegenwart arbeiten sie an der Errichtung des Reichs der Freiheit, das eines Tages, unter sozialistischem Vorzeichen, jedem Menschen die volle Freiheit im Sinne künstlerischer Kreativität gewähren kann. Eine dem gemäße Definition der Kunst hat Ernst Bloch wie folgt vorgeschlagen: „ Kunst ist ein Laboratorium und ebenso ein Fest ausgeführter Möglichkeiten, mitsamt den durcherfahrenen Alternativen darin, wobei die Ausführung wie das Resultat in der Weise des fundierten Scheins geschehen, nämlich des welthaft vollendeten Vor-Scheins.“22 Dialektisch-materialistisch liegt solche Vollendung im Bereich des Möglichen, zumal die Materie selbst im Fluss des „In-Möglichkeit-Seins“ steht. Weil die Kunst „das sinnliche Scheinen der Idee“ (Hegel) verkörpert, entstehen in ihr immer wieder neue Synthesen aus Personalität, Geist und Materie.
Die Idee der Freiheit so weit wie möglich, und zwar für alle Menschen, zu verwirklichen, ist das Ziel des Sozialismus: die „freie Assoziation freier Individuen“, von der Marx spricht, ohne jedoch im Detail anzugeben, wie diese Freiheit konkret gestaltet bzw. gestaltbar sein wird. Worin ihm Herbert Marcuse, ein Marxist des 20. Jahrhunderts, folgt, indem er erklärt, man könne „den Sozialismus nicht malen“.
Auf genau diese Zurückhaltung verzichtet Oscar Wilde (1854-1900), der Schöpfer hervor-ragender sprachlicher Kunstwerke. Im Sozialismus sieht Wilde die Voraussetzung dafür, den Individualismus als wahre Freiheit der Person zu verwirklichen; und er malt sich auch aus, welche Kunst diesem Ideal am ehesten gerecht werden könnte, und zwar in seinem 1891 erschienenen Essay The soul of man under socialism, deutsch: Der Sozialismus und die Seele des Menschen.23 Im Sozialismus werde es weder Armut noch erzwungene Arbeit geben. Selbstverwirklichung, wie sie bisher nur „die Dichter, die Philosophen, die Geistmenschen, ... die Menschen, die sich selbst verwirklicht haben“, erreichen, soll jedem Individuum ermöglicht werden, und zwar, um „das Schöne zu tun“ (a.O. 11, 32): allgemeine Freiheit durch die Kunst! Individualismus als Kunst ist für Wilde diejenige „zerstörende und zersetzende Kraft“, die darauf abzielt, „die Eintönigkeit des Typus, die Sklaverei der Gewohnheit, die Tyrannei der Sitte und die Erniedrigung des Menschen auf die Stufe einer Maschine“ zu beseitigen und durch Kreativität zu ersetzen (a.O. S. 40 f.) Und: „Wenn der Mensch glücklich ist, dann ist er in Harmonie mit sich selbst und seiner Umgebung. Der neue Individualismus, in dessen Diensten der Sozialismus, ob er es will oder nicht, am Werke ist, wird vollendete Harmonie sein.“ (a.O. S. 73)
Welche Art von Kunst kann diesem Ideal entsprechen? Oder, wie Wilde fragt: „Was ist ein gesundes und was ein ungesundes Kunstwerk?“ (a.O. S. 44) Wilde bezieht diese Fragen a) auf den Stil eines Kunstwerks, b) auf dessen Gegenstand und c) „auf beide zugleich“. Und er stellt fest: „Hinsichtlich des Stils ist ein Kunstwerk gesund, wenn sein Stil die Schönheit des Materials, das es verwendet, erkennen läßt, bestehe es nun aus Worten, aus Bronze, aus Farben oder aus Elfenbein, und wenn es diese Schönheit als Mittel zur Erzeugung der ästhetischen Wirkung benutzt. Hinsichtlich des Gegenstandes ist ein Kunstwerk gesund, wenn die Wahl dieses Gegenstandes vom Temperament des Künstlers bedingt ist und unmittelbar aus ihm entspringt. Kurz, ein Kunstwerk ist gesund, wenn es sowohl Vollendung wie Persönlichkeit hat.“ (ebd.)
Im Kunstwerk sieht Wilde also bedeutsame Aspekte von Materialität und Personalität vereinigt. Für den künstlerischen Ausdruck gebe es keine Grenzen und keine „Dekadenz“. Künstler*innen vertragen keinerlei politischen Zwang, keinerlei „autoritäre Gewalt“ über sich: „ Die Regierungsform, die für den Künstler am geeignetsten ist, ist: überhaupt keine Regierung.“ (S. 59) – Und genau dies entspricht wohl dem, was Karl Marx unter dem Reich der Freiheit und der freien Assoziation freier Individuen verstand.24
b) Kunst und KI
Zweifellos gewinnt die KI immer mehr Einfluss auf die Kunst; was jedoch nicht unbestritten akzeptiert wird. Unter dem Titel KI in der Kunst: Chancen und Herausforderungen 25 gibt es hierzu im Internet einen Artikel, in dem sich Pro und Contra teilweise schroff gegenüberste-hen:
„Pro Contra Eröffnung neuer kreativer Möglich- Kunst könnte ihre Einzigartigkeit keiten. verlieren. Effizienzsteigerung in künstlerischen Mögliche Abhängigkeit von Techno- Prozessen. logie Zugang zur Kunstproduktion wird Ethische Bedenken und Urheber- demokratisiert. rechtsfragen Kreativität wird durch Datenauswertung Verlust der menschlichen Kompo- bereichert. nente in der Kunst Grenzen des traditionellen Kunstver- Überflutung des Kunstmarkts ständnisses werden erweitert. mit generativen Werken.“
Hierzu der Kommentar:
„Die Rolle der KI in der heutigen Kunstwelt Die Verbindung von künstlicher Intelligenz und Kunst gestaltet die heutige Kunstwelt um und hebt die kreative Ausdruckskraft auf ein neues Level. KI eröffnet dabei verschiedene Rollen: Als Assistenztool unterstützt sie Künstler bei der Umsetzung ihrer visionären Ideen, indem sie zeitraubende Prozesse automatisiert oder neue Perspektiven aufzeigt. Zugleich tritt sie als innovative Schöpferin auf, indem sie eigenständige Werke generiert, die vorher so nicht denkbar waren.
KI-Kunstwerke faszinieren durch ihre oft nicht auf den ersten Blick erkennbare Komplexität und den frischen Blick, den sie auf künstlerische Traditionen werfen. Galerien und Kunstausstellungen präsentieren vermehrt Werke, die mit KI erschaffen wurden, und ziehen damit ein breites Publikum an, das sich für den Schnittpunkt von Technologie und Kreativität interessiert. Darüber hinaus nutzen KI-Anwendungen wie Deep Learning, um bestehende Kunstwerke zu analysieren und darauf aufbauend Kunst zu schaffen, die sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Stile reflektiert.
Es ist unübersehbar, dass künstliche Intelligenz Einfluss auf die Kunstvermarktung und -verbreitung hat. Online-Plattformen verwenden KI-Algorithmen, um Nutzervorlieben zu analysieren und passende Kunstwerke zu empfehlen, was wiederum Künstlern hilft, ihre Zielgruppe effektiver zu erreichen. In der Kunstwelt ist somit ein dynamischer Dialog zwischen Mensch und Maschine entstanden, der nicht nur die Art und Weise, wie Kunst geschaffen und erlebt wird, bereichert, sondern auch wegweisend für zukünftige künstlerische Entwicklungen ist.
Beispiele für KI-Kunst: Von Gemälden bis zur Musik Die Bandbreite der KI-Kunst ist beeindruckend und zeigt sich in verschiedenen Genres. So entstehen zum Beispiel Gemälde, die nicht nur neue visuelle Erfahrungen bieten, sondern auch Stilmerkmale großer Meister der Kunstgeschichte imitieren oder weiterentwickeln. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt "The Next Rembrandt", bei dem eine KI ein neues Werk im Stil des berühmten niederländischen Malers erschuf, indem sie Tausende seiner Bilder analysierte und daraus ein vollkommen neues Gemälde generierte.
Auch in der Musik hinterlässt KI deutliche Spuren. Es gibt Projekte, bei denen Algorithmen komplette Musikstücke komponieren, welche von menschlichen Zuhörern kaum von von Menschen komponierten Werken unterschieden werden können. KI-Systeme wie Google's Magenta oder IBM's Watson Beat erforschen das Komponieren von Melodien und Harmonien, die das menschliche Ohr ansprechen.
Ein weiteres Feld, auf dem KI Kunst schafft, ist die literarische Welt. KI-Programme haben bereits in Zusammenarbeit mit Autoren Geschichten und Gedichte verfasst, die einzigartige narrative Muster und Sprachgebilde hervorbringen. Diese künstlich generierten Texte können sowohl eigenständig entstehen als auch als Inspirationsquelle für menschliche Schriftsteller dienen.
Performance-Kunst ist ebenso ein Bereich, in dem KI neuartige Beiträge leistet. Es gibt Projekte, bei denen mit Hilfe von KI holografische Darbietungen oder interaktive Theaterstücke erstellt werden, die auf die Reaktionen des Publikums in Echtzeit reagieren können.
Die beispielhafte Vielfalt von KI-Kunst zeigt, dass die kreativen Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz künstlicher Intelligenz ergeben, nahezu grenzenlos sind und einen wichtigen Teil der modernen Kunstszene darstellen.“
Begründete Kritik an solchen Tendenzen äußert Daniel Wom (2023) in dem Artikel Künstliche Intelligenz in der Kunst: Kreativität und Kontroverse 26:
„Kritiker argumentieren, dass KI-basierte Kunstwerke keine „echte“ Kunst seien und dass sie den kreativen Prozess entwerten. Sie behaupten, dass KI nur das reproduziert, was bereits existiert und dass der Faktor der menschlichen Subjektivität und persönlichen Ausdrucks-weise fehlt.
Ein wichtiger Aspekt dieser Debatte dreht sich um die Frage der Autorschaft. Wenn ein KI-System ein Kunstwerk erstellt, wer ist dann der „Autor“? Ist es der Entwickler des Algorithmus, der Künstler, der das System programmiert, der KI-Algorithmus selbst oder eine Kombination aus all dem? Diese Fragen werfen neue rechtliche und ethische Herausforderungen auf, die diskutiert und geklärt werden müssen.
Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von KI auf die Kunstwelt. Kritiker befürchten, dass Künstler möglicherweise durch KI-Systeme ersetzt werden könnten und dass dies zu einer Entwertung der menschlichen Kreativität führen könnte. Es besteht die Befürchtung, dass KI in der Kunstindustrie zur Norm wird und menschliche Künstler arbeitslos werden könnten.
Neben den kreativen Aspekten hat KI auch Auswirkungen auf die Kunstmarkt. KI-generierte Kunstwerke werden bereits zu sehr hohen Preisen verkauft, was Fragen nach der Wertigkeit und Authentizität solcher Werke aufwirft. Es gibt Diskussionen darüber, wie KI-generierte Kunstwerke in traditionelle Kunstinstitutionen wie Museen und Galerien eingebunden werden können.
Trotz all dieser Kontroversen und Debatten haben KI-basierte Kunstwerke zweifellos das Potenzial, die Kunstwelt zu revolutionieren. Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz können neue Kreativitätsformen erkundet und erweitert werden. Die Fähigkeit von KI-Systemen, große Mengen an Daten zu analysieren und Verbindungen herzustellen, ermöglicht es, neue und unerwartete Lösungen für künstlerische Herausforderungen zu finden.
Es ist wichtig anzumerken, dass KI-Systeme keine eigenständige kreative Intelligenz besitzen. Sie sind darauf angewiesen, von menschlichen Entwicklern programmiert und mit Daten gefüttert zu werden. KI kann als ein Werkzeug betrachtet werden, das von Menschen genutzt wird, um ihre kreative Vision zu verwirklichen.
Insgesamt zeigt die Verwendung von Künstlicher Intelligenz in der Kunst das Potenzial und die Herausforderungen dieser Technologie. Die Debatte um KI in der Kunst wird weiter-gehen, da sich die Technologie weiterentwickelt und neue Möglichkeiten eröffnet. Es ist wichtig, diese Diskussion fortzusetzen und die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Kunstwelt zu untersuchen, um eine ausgewogene und ethisch fundierte Nutzung sicher-zustellen.“
Es sind Feststellungen, die sich größtenteils von der Kunst auf weitere Aspekte des mensch-lichen Lebens übertragen lassen, so die Kultur(industrie) im Allgemeinen, die Mobilität und die Vielfalt der Freizeit-Aktivitäten.
Die Liebe – oder auch: der Weltknoten
Als den „Weltknoten“ bezeichnete Schopenhauer das Leib-Seele-Problem, das er für unlösbar hielt. Wenn ich nun die Liebe als den Weltknoten ausgebe, dann aus folgenden Gründen:
Das Thema Liebe gilt gemeinhin als „Thema Nummer 1“, wodurch aber das Phänomen Liebe auf die Beziehungen zwischen Mann und Frau reduziert wird. Schon an den Grundbedeutun-gen Nächstenliebe (caritas), Agape (der völlig selbstlosen Fürsorge für den Mitmenschen), Eros und Sexus wird jedoch erkennbar, dass der Begriff Liebe weitaus umfassender ist, ja, sogar den Weltknoten, den Kern des Weltgeschehens betrifft, das, was „die Welt im Innersten zusammenhält“. Denn Vorformen der Liebe können – zumindest hypothetisch – schon in den im Big Bang entstandenen Elementarteilchen der Materie festgestellt werden. Die E-Teilchen streben danach, sich mit anderen zu verbinden, um in neuen (sub)atomaren und molekularen Verbindungen das eigene Überleben zu sichern. Dahinter stecken diejenigen Faktoren, die Aristoteles ‚energeia‘ und ‚entelechia‘, Wirklichkeit, Wirksamkeit, Ziel- und Zweckgerichtet-heit nannte, Faktoren, deren Ursprung wir nicht kennen, die sich aber relativ problemlos auf die Liebe übertragen lassen.
Was womöglich in der Nächstenliebe seine markanteste Ausprägung fand. Warum fordert Jesus: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“? Inwiefern wird er damit seinem Anspruch gerecht, die Zehn Gebote zu ergänzen und zusammenzufassen? Nun, unmöglich kann man seine/n Nächste/n lieben, ohne sich selbst zu lieben. Man muss sich selbst erhalten, bei guter Gesundheit sein, um anderen helfen zu können. Warum aber muss dies eingefordert werden, wie Jesus es tut? Weil im Menschen – wie neuere Forschungsergebnisse bestätigen – nicht nur Gutes, sondern auch Böses anzutreffen, angeboren ist. Und: Das Böse, Kriminelle, kann Überhand nehmen, die eigene Person und die anderer Menschen schädigen oder gar zerstören. Im Kampf zwischen Gut und Böse benötigt der Mensch Orientierung; was anscheinend die Grundlage jeglicher Religion und jeglicher Ethik geworden ist. Von Jesu Liebesgebot führt eine direkte Linie zu Kants Ethik mit deren Grundpfeilern der Anerkennung der Rechtsperson und der ebenso unveräußerlichen Menschenwürde.
Darüber hinaus kann das Wesen der Liebe, können ihre charakteristischen Eigenschaften und Merkmale näher bestimmt werden, so schon – in kaum zu übertreffender Art und Weise – im Hohenlied der Liebe, das der Apostel Paulus in seinem 1. Korintherbrief, Kap. 13, angestimmt hat:
„13,1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.
2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.
3 Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.
4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf.
5 Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach.
6 Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
7 Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.
8 Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht.
9 Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden;
10 wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk.
11 Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war.
12 Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.
13 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“ (Einheitsübersetzung 2016)
Was demnach das Wesen der Liebe auszeichnet, sind vor allem Güte und Langmut, mithin das Gute im Menschen und die Toleranz gegenüber den Mitmenschen. Dies entspricht voll und ganz meinen Analysen (s.o.), insbesondere im Hinblick auf die unzerstörbare Bindung der Liebe an Recht und Menschenwürde: Die Liebe meidet das Unrecht und „freut sich an der Wahrheit“; dies wohl in Anspielung an das Jesuswort, wonach er „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ sei und folglich einzig den Zugang zu Gott, dem Vater, ermögliche.
Beachtlich und beeindruckend ist Paulus‘ Aufzählung von negativen, sündigen Eigenschaften, denen er die Liebe als heilendes Gegenmittel entgegenstellt. Denn ohne Liebe bleiben auch alle positiven Charakter- und Verhaltenseigenschaften unwirksam, angefangen von „prophe-tischer“ und anderer Beredsamkeit über die Erkenntnis- und Glaubenskraft bis hin zur Selbst-aufopferung. Schon die Liebe allein vermittelt Standhaftigkeit, Toleranz und Hoffnung. Als in und über dem gesamten Universum stehend werde die Liebe sogar das Ende der Zeiten über-stehen und sodann von Ewigkeit zu Ewigkeit höchste Erkenntnis und höchstes Glück gewäh-ren. (Was natürlich ein Glaube und kein Wissen ist!) –
Dass hingegen Liebe in der Reduktion auf Eros und Sexus nicht bestehen kann, zeigt das folgende Beispiel aus meinen Lebenserinnerungen:
„Wenn Jean-Jacques Rousseau Recht hat, kann man die Frauen ungestraft weder suchen noch meiden. Einer meiner Fehler bestand vielleicht darin, dass ich die Frauen zuweilen zu sehr gesucht und zu wenig gemieden habe. Nicht verwunderlich ist es jedenfalls, dass meine Bemühungen auf diesem Gebiet immer wieder gescheitert sind, was mir heute – lange nach jenen turbulenten Zeiten – sehr leid tut.
Eigentlich widerstrebt es mir, sämtliche „Wechselfälle“ zu schildern. Einen besonders kuriosen, vielleicht teilweise tragi-komischen Fall möchte ich dennoch nicht unerwähnt lassen, den der glutäugigen Katalanin S. Sie war wirklich ein Prachtexemplar, eine gelungene, kupferbraune Mischung aus iberischem und arabischem Blut, dunkelhaarig, gut gebaut, gut gelaunt und sehr charmant. Wohl an einem ihrer Heimatstrände hatte sie einen blonden Deutschen kennengelernt, den sie nun in Düsseldorf (oder Umgebung, 1980?) besuchen wollte. Zu ihrer furchtbaren Enttäuschung wollte der Verehrte aber plötzlich nichts mehr von ihr wissen. In dieser Situation lernte sie zufällig einen meiner Bekannten kennen, so dass ich selbst bald in den Genuss kam, die mediterrane Schönheit in Augenschein zu nehmen und kennen zu lernen. Wahrlich ein Vergnügen! Und vergnüglich gestalteten sich auch die ersten Tage mit ihr, obwohl ich ihr sprachlich wenig zu bieten hatte, nämlich mein eher mäßiges Spanisch. Leider musste ich der Ärmsten erneut eine Enttäuschung zumuten. Aus mir selbst unerklärlichen Gründen fühlte ich mich nämlich plötzlich der lieben, attraktiven S. ganz und gar nicht gewachsen, so dass ich keine dauerhafte Beziehung mit ihr eingehen konnte. Kurz nach ihrer Abreise sah ich mich sogar veranlasst, erneut einen Psychotherapeuten zu konsultieren, der mich aber relativ schnell beruhigen konnte.“
Fazit: Wer eine dauerhafte Liebesbeziehung anstrebt, kann sich nicht auf Eros und Sexualität allein verlassen. Es bedarf viel weiter gehender Verankerungen in den Tiefen des Gemüts. Zu-mindest muss Nächstenliebe in dem beschriebenen Sinne vorhanden sein, ferner auch die Be-reitschaft zur Agape, der völligen Selbstlosigkeit (ohne das eigene Selbst preiszugeben!).
Davon abgesehen, stellt sich im KI-Zeitalter eine ganz andere Frage: nämlich die, ob es, wenn nicht Liebe, die ja die typisch menschliche Einheit von Körper, Seele und Geist impliziert, so doch wenigstens Eros und Sexus mit künstlichen Gebilden, wie z.B. Sexrobotern, geben kann. Hierzu passen die folgenden beiden Internet-Artikel, der erste aus dem Jahr 2021, der zweite von 2024:
„Liebe und Nähe in der Zukunft – die sexuelle Revolution wird kommen.
Die Entwicklung begann bereits vor Jahrzehnten und bereits damals schien es schon ein tiefes Bedürfnis zu sein. Technische Hilfsmittel, wie der in 100 Variationen verstellbare Dildo zum Beispiel, sind heute schon echte Hightech Spielzeuge, die auf gewisse Art und Weise ihren Dienst verrichten. Ist es die Sehnsucht oder Begierde nach Sex? Was bevorzugen die Kunden? Den puren Sex ohne Gefühle und ohne Versagen? Denn eine Maschine kann bekanntlich immer und stellt auch sonst keine Fragen. Tabus und Grenzen sind auch nicht wirklich zu erwarten. Denn es ist ja letztendlich nur eine Maschine.
Die modernen Sex-Roboter setzen auf ein menschliches Äußeres, auf eine Beschich-tung, die der menschlichen Haut bereits sehr ähnelt. Gefühle und Kommunikation, Lernfunktion und bereits programmierte Grundprogramme. Die Palette der techni-schen Features ist groß und die modernen Sexdiener sind in ein paar Jahren durchaus annehmbare Alternative. Die Zukunft lässt sich nicht aufhalten, das ist der Tenor aller Entwickler und Befürworter der neuen Sex-Roboter mit künstlicher Intelligenz.
Über Smalltalk direkt ins Bett – niemand braucht mehr Zeit investieren Sympathiewerte abchecken, diese Zeit kann sich Mann und Frau sparen. Wer mag, der kann gerne im Vorfeld noch eine Runde Smalltalk zur Auflockerung einfließen lassen, doch es wird keine Notwendigkeit sein. Sex mit einem Roboter kann von einmalig bis immer durchgeführt werden. Doch wie sieht eigentlich die moralische Seite aus? Die Maschine wird diesen inneren Konflikt mit Sicherheit niemals ausfechten müssen. Wie sehen es die Menschen, die nun eventuell ihre ganz persönlichen Neigungen ausleben können? Ohne Tabu und ohne Reue? Sex auf Knopfdruck, denn das wird Sex mit einem Roboter nun einmal sein.
Die Zukunft hat begonnen, das gilt für alle Ebenen. Maschinen und Roboter nehmen immer mehr Platz in unserem Leben ein. Vom Saugroboter bis hin zum Sex-Roboter ist es noch ein langer Weg. Aber dieser Weg wird kommen und die Zukunft wird eine sexuelle Revolution bereithalten. Und wer weiß, eventuell werden in 50 Jahren die Damen und Herren aus der Konserve unglaublich Fähigkeiten entwickelt haben. Auf Knopfdruck zum Orgasmus und das mit einer Perfektion, die abgestimmt auf den jeweiligen menschlichen Partner unvergleichbar ist. Letztendlich wird der technische Fortschritt fast nur Vorteile anbieten. Nachteile? Die moralischen Aspekte und dass eine Neue sexuelle Freizügigkeit entstehen könnte. Tabus sucht Mann oder Frau dann vergebens. Denn es wird ja nur eine Maschine zu Schaden kommen.“27
Und im Jahr 2024 heißt es:
„ Sexroboter: Darum geht’s.
«Im Jahr 2050 werden wir mehr Sex mit Robotern haben als mit Menschen», prognostiziert der Zukunftsforscher Ian Pearson.
Die neuesten Sexroboter sollen nun mitfühlen und mit Menschen eine tiefe Bindung eingehen können.
Sexroboter mit Gefühlen verspricht etwa die chinesische Firma Starpery Technology, der CEO spricht von «Sexpuppen der nächsten Generation».
Würdest du eine sexuelle Beziehung mit Robotern eingehen? Laut einer Studie der Trent University wollen das vor allem Männer, in Japan gibt es bereits einen grossen Markt dafür. Die Hersteller der Roboter versprechen mehr als bloss körperliche Befriedigung: Sie sprechen von einer neuen Form von Beziehung, die glücklich mache und grosse Gefühle auslöse.“28
Hiergegen ist die grundsätzliche Kritik an Sexrobotern zu beachten, die schon 2016 in einem Artikel der ‚Neuen Zürcher Zeitung‘ unter dem Titel Sex, Liebe und Roboter vorgebracht wurde. In Kernsätzen zusammengefasst lautet diese Kritik:
1. Sex-Roboter können dazu beitragen, dass Menschen zu Objekten degradiert werden.
2. Mit Robotern werden auch Gender-Stereotype zementiert. So zeigen Studien, dass wir Maschinen meist intuitiv Männer-Namen geben.
3. Ein weiteres Argument der Kritiker ist die drohende Vereinsamung. Mit dieser Art von Sextechnologie würden sich Menschen, die bereits zu Zurückgezogenheit neigen, gänzlich in die Isolation manövrieren.
4. Sex-Roboter-Befürworter wie David Levy, der mehrere Chatbots entwickelt hat, hal- ten dagegen: Viele einsame Menschen ohne Aussicht auf Liebe und Partnerschaft wer- den wenigstens eine Simulation von Partner haben. Glück ist relativ. Und im gleichen Zug würde das Problem mit der Prostitution gelöst.
5. «Menschliche Beziehungen sind reichhaltig, chaotisch und anstrengend», schreibt Turkle in «Reclaiming Conversation». Technologie hilft uns aufzuräumen, doch damit umgehen wir echte Gespräche und Konfrontationen, die uns mental weiterbringen würden. Stattdessen reduzieren wir unsere Kontakte auf ein Minimum, in der Folge verkümmern Fähigkeiten wie Empathie und Selbstreflexion. Aber warum können wir nicht von diesen Maschinen lassen? «Wir sind dort am empfänglichsten, wo wir am verwundbarsten sind: Wir sind allein, aber wir haben Angst vor Intimität», sagte Turkle in einem TED-Talk. «Wir entwickeln eine Technologie, die uns die Illusion von Freundschaft gibt, ohne die Forderungen von Freundschaft. Wir glauben, Intimität kontrollieren zu können. Dabei geht die Befriedigung verloren, die wir empfinden, wenn wir ein Erlebnis teilen.»
6. Oliver Bendel ist überzeugt, dass Sex-Roboter ein Nischen-Phänomen bleiben werden. «Vielleicht wird es in jedem Land ein Bordell mit solchen Maschinen geben, aber sicher keine robophile Bewegung. Nachdem Homosexualität als legal erklärt wurde, gab es auch keine Bewegung, denn entweder ist man homosexuell, oder man ist es nicht.»
7. Schwieriger zu beantworten ist die andere Frage: Werden Roboter eines Tages aus den Millionen Datensätzen, aus denen ihre Identität geformt ist, ein eigenes Bewusstsein entwickeln, wie das der Chatbot Samantha in «Her» tut? Werden sie sich in uns verlieben? «Dazu brauchte es Gefühle», sagt Bendel. «Roboter wie Pepper und andere KI-Systeme können Gefühle zeigen, aber sie können sie nicht haben. Sie können ler- nen, viele unserer Gefühle zu erkennen. Aber beim Verliebtsein und der Liebe spielen biochemische Prozesse eine zentrale Rolle, die eine Maschine nie haben wird.»
8. Eine Einschränkung macht Bendel: Falls es gelingen sollte, technische Strukturen mit biologischen – wie Hirnzellen – überwuchern zu lassen, dann könnten in diesen «umgekehrten Cyborgs» vielleicht Gefühle erwachen. «Aber nur mit Nullen und Ein- sen gelingt das nicht.“29
Darüber hinaus:
Wenn Sexualität mit Liebe verbunden sein soll, müssen zumindest die Kriterien Verstehen, Empathie und Verantwortung erfüllt sein. Schon dies ist aber bei Robotern nicht der Fall, da sie weder über menschliches Bewusstsein noch über die Empathie verfügen, die auf der typisch menschlichen Einheit von Körper, Seele und Geist beruht. Wäre Letzteres bei Robotern der Fall, wären sie keine Roboter mehr, sondern „humanoide“, menschenähnliche Wesen. Überzeugende Gründe dafür, solche Wesen zu erschaffen, gibt es anscheinend nicht.
Fazit: Angesichts solcher Kritik wirkt die Prognose von Ian Pearson: «Im Jahr 2050 werden wir mehr Sex mit Robotern haben als mit Menschen.» zumindest unglaubwürdig, wenn nicht abwegig. Dies gilt auch für die Behauptung, derzufolge „die neuesten Sexroboter sollen nun mitfühlen und mit Menschen eine tiefe Bindung eingehen können.“ (s.o.) Merke: Roboter können vielleicht helfen, aber nicht Menschen ersetzen. – In der Stellungnahme des Ethikrates (s.o.) wird das Problem Sexroboter übrigens nirgendwo thematisiert!
Das Widersacherische: negative oder destruktive Gefühle?
Vom Wortursprung her vereinigt der Begriff des Widersacherischen zwei Phänomene: etwas Objekthaftes und etwas Feindseliges, Bedrohliches, das dem Menschen objekthaft gegenüber-tritt. So in Katastrophen, Unfällen, Krankheit, Tod30, überhaupt allem denkbar Widerwärti-gen, das die eigene Existenz in Frage stellt, die Selbsterhaltung und -verwirklichung bedroht. Umso erstaunlicher ist die Auskunft, die das KI-Chat-Programm ‚Microsoft-Copilot‘ erteilt:
„Das "Widersacherische" bezieht sich auf das Gegensätzliche oder das Wider-streitende. Im philosophischen Kontext kann es verschiedene Bedeutungen haben, je nach dem, wie es verwendet wird:
1. Dialektik: In der Dialektik, besonders bei Hegel, ist das Widersacherische ein wesentlicher Bestandteil des Fortschritts. Durch den Gegensatz (These und Antithese) entsteht eine höhere Einheit (Synthese). Das Widersacherische treibt den Denkprozess und die Entwicklung voran.
2. Moral und Ethik: Das Widersacherische kann sich auf die innere Auseinander-setzung zwischen verschiedenen moralischen und ethischen Prinzipien beziehen. Beispielsweise der innere Konflikt zwischen egoistischen und altruistischen Hand-lungen.
3. Religiöse Kontexte: In einigen religiösen Traditionen, insbesondere im Christentum, wird der Begriff des Widersachers oft mit dem Teufel oder satanischen Kräften in Verbindung gebracht, die gegen das Göttliche wirken.
4. Psychologie: Das Widersacherische kann auch innere Konflikte und Gegensätze innerhalb der Psyche einer Person beschreiben, wie zum Beispiel den Konflikt zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten oder zwischen unterschiedlichen Teilen der Persönlichkeit.
5. Gesellschaft und Politik: In der Gesellschaft und Politik bezieht sich das Wider-sacherische oft auf den Gegensatz zwischen verschiedenen Interessen, Ideologien oder Machtgruppen, die im Widerstreit stehen.
Diese verschiedenen Perspektiven zeigen, wie zentral das Konzept des Widersacherischen für viele Bereiche des menschlichen Lebens und Denkens ist. Es trägt oft dazu bei, Dynamik und Entwicklung zu fördern.“
Was wie eine neutrale, wertungsfreie Darstellung anmutet. Negatives kommt kaum vor (außer in religiösen Kontexten: „Teufel“ etc.). Positives wird hervorgehoben: als „wesentlicher Bestandteil des Fortschritts“ bei Hegel oder auch als Mittel zur Förderung von „Dynamik und Entwicklung“ am Ende des Textes.
Im Gegensatz dazu betont Ernst Bloch das eingangs erwähnte Widerwärtige im Widersache-rischen, so in Experimentum Mundi (1975), S. 237:
„Das Widersacherische im objekthaften Prozeß, worauf der Widerstand im erkennba-ren Objekt erst hindeutet, darf aber nicht ausgegrenzt werden; denn der Widerstand im Erkennen würde bei allem Unterschied ohne den Hintergrund des Widersacherischen gar nicht bestehen. Gäbe es doch überhaupt keinen Prozeß, wenn in der Welt nicht etwas wäre, das nicht sein sollte, das so nicht sein sollte. Man sieht das Stockende, Hemmmende, noch Mächtig-Nichtige in tausend Erscheinungen scheußlich ausge-drückt. Das Gift der Krankheiten, die immer neu maskierte und ideologisierte Ausbeu-tung und Repression bis hin zur Anonymität des Kapitals, auf tausend Kriege kommen kaum zehn Revolutionen, so leicht gelingen alle Reichstagsbrände, so verblüffend können auch geglückte Revolutionen eines neuen Anfangs zum schlechten Alten dege-nerieren, so deutlich hat Marx die ganze bisherige Geschichte als bloße Vorgeschich-te deklariert, auf dieser schwierigen Erde steht am Ende jedes Lebens als einzige völ-lige Gewißheit der Tod, die stärkste Gegenutopie; dieser individuelle Tod wird noch überwölbt durch die Möglichkeit eines kosmischen Tods, des großen Umsonst durch Entropie.“
Was aber keineswegs Blochs letztes Wort zum Sinn der Geschichte war. Denn: Wäre der endgültige „Kältetod“ tatsächlich das unausweichliche Schicksal des Universums (wie gele-gentlich behauptet wird), erübrigte sich jegliche Frage nach dem Sinn des Ganzen ebenso wie jegliche Utopie, landete auch das „positiv auf sich selbst gestellte Positive“ (z.B. der Natur), von dem Marx sprach, auf dem Müllhaufen bzw. im Absurdistan der Geschichte.
Das Gegenteil wird von Bloch entwickelt, so wenn er die Kehrseiten des Widersacherischen mit einbezieht:
„Item, das X des Weltanstoßes insistiert in allem Existierenden immer wieder durch alle Geschichte hindurch, sie als Grundtrieb betreibend und von ihren bisherigen Objektivierungen noch unbetroffen. Darum eben wohnt der Anstoß allernächst in der völlig ungelichteten Ursprungs- oder Brunnenstube des Existere an sich, im Erzeugen- den der Subjekt-Objekt-, Objekt-Subjekt-Beziehung Welt. Aber wenn das sowohl treibende wie sich selber noch verborgenen Meinen dieses Anstoßes zur Sucht miß-raten kann, so meldet sich in ihm ebenso das unverbogene Original: Wille substanz-voller Sehnsucht, Richtung aufs Was. Letztere nicht erst in der menschlichen Geschichte, auch bereits in der vor- oder außermenschlichen; es ist der die Dialektik durchsetzende, das Nichts umlenkende Gegenzug zu Vernichtung und Nichts. Ganz tritt dieser Gegenzug: als Wille des substanzvollen Intendierens, erst menschlich-sub-jekthaft hervor in Tapferkeit und militanter Hoffnung. Darin meldet sich das utopische Gewissen und Eingedenken des Alles, die Mannschaft des Anti-Nichts, oder utopi-schen Totum.“31
Genau dies darf aber nicht zum Nichtstun, zum Quietismus, verleiten – und erst recht nicht zur Fehlschätzung des Widerwärtigen, Teuflisch-Bösartigen. Umso wertvoller erscheint der folgende Einwurf von René Tichy (Wien):
„Bloch hat sein Leben lang über Aufklärung, Religion, Atheismus und Teufelsglaube nachgedacht. Er kommt zu dem Schluss: „Wir haben das Widersacherische im Welt-prozess vergessen.“
Elias Canetti schreibt in seinen Aufzeichnungen: „Seit er an keinen Teufel mehr glaubt, ist der Mensch gefährlich geworden. Der Mensch sieht den Teufel nicht mehr: Er hat ihn geschluckt.“
Für die Wissenschaft gibt es nichts Böses und schon gar nicht den oder das Böse. Es verschlägt ihr die Sprache oder vielmehr, sie gebraucht eine unangemessene. Die Kategorie des Bösen wird unzulänglich durchdacht.
Denn was immer uns an profanen Verständnishilfen angeboten wird, erklärt für unser Gefühl weder den Wahnsinn des Selbstmordattentäters noch die Brutalität eines Schergen, der seinen Opfern vor laufender Kamera den Kopf abschneidet. Alle Erklärungen scheinen zu schwach.
Die Aufklärung glaubt, sie habe den Teufel hinter sich und erklärt solch abgrundtief Böses mit psychologisch-gespickten Aggressionstheorien.
Baudelaire hält dagegen: „Die schönste List des Teufels ist, das er uns überzeuge, er existiere nicht.“
Ist dem Teufel dieser Streich nicht niemals besser gelungen als in der gegenwärtigen Zeit?“32
Wie dem auch sei, an den Teufel kann man glauben oder auch nicht. Hingegen ist nicht zu leugnen, dass es Teuflisch-Bösartiges im Menschen gibt, wenn auch nicht ohne den Gegenpol des Guten, des Gemeinwohls (bonum commune) und des Höchsten Guts (summum bonum). Umso mehr kommt es darauf an, sich klarzumachen, wie sich der Kampf zwischen Gut und Böse, zunächst innerpsychisch, auswirkt. Zweifellos schlägt sich Widersacherisches, Wider-wärtiges und Widersinniges auch in den individuellen Gemütszuständen, Gefühlen und Emp-findungen nieder. Unklar scheint, ob es sich dabei um „negative“ Gefühle handelt, zumal die Existenz solcher Gefühle grundsätzlich bestritten wird, so von Tatjana Heidemann, die be-hauptet, es gebe keine positiven und negativen Gefühle, wohl aber „Rückführer und Voran-bringer“. Die gegenteilige Behauptung beruhe auf gewohnheitsmäßigen, willkürlichen Wer-tungen:
„Es gibt keine negativen und positiven Gefühle – es gibt Rückführer und Voranbringer Negative & positive Gefühle Wir neigen dazu, unsere Gefühle in negative/ schlechte und positive/ gute Gefühle zu kategorisieren. Das ist nichts anderes, als eine Bewertung dessen, was wir erleben.
Mit negativen Gefühlen meinen wir Gefühle, die uns runterziehen, uns Kraft und Zeit kosten, unsere Motivation rauben oder unseren Antrieb mindern. Als schlecht bewerten wir Gefühle dann, wenn wir nicht wissen, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Wenn uns also ein Ventil fehlt und diese Gefühle sich so sehr in uns anstauen, dass sie uns aufzufressen drohen.
Typische Gefühle, die als negativ oder schlecht bewertet werden, sind Scham, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, Wut, Ärger, Zorn, Eifersucht, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Angst oder auch Traurigkeit.
Mit positiven Gefühlen meinen wir Gefühle, die „Spaß“ machen. Sprich Gefühle, die uns in unserem Alltag, bei unserem Tun, Erleben und Denken nicht stören. Es sind Gefühle, die uns beflügeln, uns Motivation, Antrieb und Kraft schenken. Als gut bewerten wir Gefühle, die uns also aktivieren und fördern. Mit guten Gefühlen scheinen wir uns in unserem Leben gleich ein ganzes Stück sinnvoller, gesünder und lebendiger zu fühlen.
Typische Gefühle, die als positiv oder gut bewertet werden, sind Freude, Dankbarkeit, Liebe, Neugier, Zufriedenheit, Leidenschaft, Vertrauen oder Erleichterung.
Diese Art, Gefühle zu bewerten, ist inzwischen gängig geworden. So heißt es in Blogartikeln „Wie du deine negativen Gefühle bewältigst“. Auch in der Fachliteratur lese ich oft von negativen und positiven Gefühlen. Das ist schade, denn dadurch verselbstständigt sich eine bewertende Sichtweise auf etwas ganz Wesentliches in unserem Leben. Und ich glaube, es hilft uns nicht weiter, wenn wir Prozesse der Bewertung so selbstverständlich werden lassen. Stattdessen dürfen wir uns fragen, inwiefern uns diese Bewertungen sogar schaden.“33
Dabei steht wohl außer Frage, dass Gefühle wie Wut, Schuld, Hass, Neid und Angst uns erheblich schaden können, zumal sie zu kriminellen Neigungen und Handlungen führen oder zumindest beitragen können.
In seinem Buch Der Gefühlscode (2013/14) schreibt Giovanni Frazzetto über
Wut:
„Wut ist ein krudes Gefühl, eine mächtige Kraft, oft nur schwer zu unterdrücken. Damit sie sich bemerkbar macht, genügt es nicht, dass nur ein paar Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir werden wütend, wenn wir uns schlecht behandelt fühlen oder vernachlässigt, wenn wir beleidigt werden oder ein bestimmtes Verhalten anderer nicht hinnehmen wollen oder können. Wut ist auch Angst mit einer Rüstung. Sie fungiert als Abwehr, als vorbeugende Reaktion auf einen möglichen An-griff. Impulsiv und spontan kann sie sein, sich unvermittelt, in kurzen, heftigen Aus-brüchen entladen, aber auch still und überlegt, klar und kontrolliert sein. Sowohl als unmittelbare Reaktion auf eine Provokation zeigt sie sich wie auch als Treibstoff künf-tiger Vergeltungsaktionen. Sie kann, das ist auffällig, lange gezügelt werden, dann aber plötzlich wild und heftig losbrechen, um gleich wieder abzuflauen. Nach einem heißen, blitzartigen Wutanfall ist man unter Umständen noch lange böse auf jemanden. In allen ihren Formen hat Wut moralische Konsequenzen. Die Unfähigkeit, impulsive Reaktionen unter Kontrolle zu halten, ist ein Prüfstein für unseren Charakter; sie kann als Willensschwäche ausgelegt werden. Wer seiner Wut nachgibt, muss damit rechnen, dass dies Folgen hat für seine Stellung im gesellschaftlichen Leben, dass seine Beziehungen zu anderen Menschen Schaden nehmen.“34
Der gleiche Autor schreibt über
Schuld:
„Schuld hat mit Fehlverhalten zu tun oder auch nur mit dem Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Und es ist ganz allgemein irgendeine Übeltat, die andere Menschen vor den Kopf stößt, sie missachtet und ihnen etwas antut, indem eine Regel oder eine gesellschaftliche Norm verletzt wird. Es gehört dazu, dass man unterscheiden kann, was richtig ist und was falsch, was annehmbar oder verächtlich, für andere von Vorteil oder verletzend. Ein ungerechtfertigter Wutanfall gegenüber jemandem, an dem uns liegt, eine gehässige Reaktion wie in Bruce‘ Fall führen dazu, dass Schuldgefühle auf-kommen. Schuld ist ein moralisches Gefühl, vielleicht die Quintessenz aller morali-schen Gefühle, und hat demzufolge mit Werten zu tun. …
Wir können Schuldgefühle auch nutzen, um andere zu manipulieren, zum Beispiel indem man Angestellten Fehler vorwirft oder Familienangehörigen Vorwürfe macht, wenn sie zu viel verlangen oder zu wenig geben. Die Liste ließe sich problemlos er-weitern.
Mit der Zeit ergreifen Schuldgefühle so sehr Besitz von uns, dass wir kaum noch davon loskommen.
Schuld macht Angst. Sie nagt. Sie beißt. Sie greift unablässig an. Wie ein Dorn im Schuh ist sie, den man loswerden möchte, oder wie eine schwere Last. Ein stechendes Insekt. Alle diese bekannten Metaphern treffen etwas.“ (a.a.O. S. 69-71)
Uwe Taschow schreibt (2023) über den
Hass:
Historische Beispiele zeigen, wie Hass zu extremen Gewalttaten und Konflikten geführt hat. Rassistische Ideologien im Nationalsozialismus führten zu millionen-fachem Mord und Völkermord. Religiöser Hass hat über die Jahrhunderte hinweg zu zahlreichen religiösen Konflikten und Kriegen geführt. Ethnische Konflikte und Völkermorde sind weitere Beispiele dafür, wie Hass ganze Gesellschaften spalten und zerstören kann.
Die Auswirkungen von Hass sind weitreichend und verheerend. Gewalttätige Über-griffe und Verbrechen sind oft direkte Konsequenzen von Hass. Hass kann auch zu einer Spaltung der Gesellschaft und zu sozialen Konflikten führen, die das soziale Gefüge zerrütten. Für diejenigen, die Hass erfahren, kann dies zu psychischer und emotionaler Belastung führen. Hass kann auch die Meinungsfreiheit und die Demokratie einschränken, da Menschen aus Angst vor Hassreaktionen ihre Meinung nicht frei äußern.
Um Hass zu bekämpfen, sind verschiedene Ansätze erforderlich. Bildung und Aufklärung über die Ursachen von Hass können dazu beitragen, dass Menschen Empathie entwickeln und Vorurteile abbauen. Die Förderung von Toleranz und Akzeptanz ist ebenfalls wichtig, um Hass zu reduzieren. Politische Maßnahmen gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit sind notwendig, um strukturellen Hass zu bekämpfen. Die Regulierung von Hassrede im Internet und in sozialen Medien ist ebenfalls von großer Bedeutung, um die Verbreitung von Hassbotschaften einzudämmen.
Insgesamt ist Hass eine komplexe Emotion, die aus verschiedenen psychologischen, gesellschaftlichen und technologischen Faktoren resultieren kann. Es ist von größter Bedeutung, die Ursachen von Hass zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen, um ihn zu bekämpfen. Denn nur durch die Überwindung von Hass können wir eine friedlichere und tolerantere Gesellschaft schaffen.“35
Corinna Hartmann schreibt (2021) über den
Neid:
Neid kommt immer dann auf, wenn wir uns mit bestimmten Menschen vergleichen. Drei Faktoren beeinflussen, wie wir Neid erleben:
Persönliche Relevanz:
Neidisch werden wir nur in Angelegenheiten, die uns wichtig sind. Jemand, der Wert auf Fitness legt, misst sich eher darin als in seinen Mathematikfähigkeiten. Auf ein Rechengenie wird er kaum Neid entwickeln, auf ein Sport-Ass hingegen schon.
Soziale Nähe:
Wir beneiden eher Personen, die wir persönlich kennen und denen wir nahestehen. Unsere Missgunst richtet sich also eher gegen die eigene Schwester als auf reiche und schöne Promis wie Kim Kardashian.
Ähnlichkeit:
Je ähnlicher uns die andere Person ist, desto mehr tut der Vergleich weh, wenn wir den Kürzeren ziehen. Übertrumpft uns ein Mensch im gleichen Alter, mit dem gleichen Geschlecht, der in der gleichen Branche arbeitet, versetzt uns das eher einen Stich, als wenn es sich um eine viel ältere Person handelt, mit der wir kaum etwas gemein haben.
Welchen Sinn hat das Gefühl?
Neid erwächst aus dem grundlegenden menschlichen Bedürfnis, sich selbst für wichtig und wertvoll zu halten. Außerdem sind wir bestrebt, unsere Position in der sozialen Hierarchie zu verbessern. Waren wir in einer Gruppe unterlegen, bedrohte das, evolutionär betrachtet, unseren Überlebens- und Fortpflanzungserfolg.
Laut der “Theorie des sozialen Vergleichs” des US-amerikanischen Psychologen Leon Festinger gewinnen wir Informationen über uns selbst, indem wir uns mit anderen vergleichen – vor allem dann, wenn ein objektives Kriterium fehlt. Die meisten Informationen liefert uns dabei der Vergleich mit anderen, die uns in vielen Merkmalen ähnlich sind.
Neid kann ein Ansporn sein Ziehen wir bei diesem Vergleich den Kürzeren, entsteht Neid. Dieser kann uns dazu veranlassen, den Erfolg des anderen kleinzureden und ihn womöglich sogar zu sabotieren. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit: Die “helle Seite” des Neids spornt uns an, selbst besser zu werden und auf unsere Träume hinzuarbeiten. In diesem Sinne ist Neid ein Alarmsignal, dass wir in einem Bereich, der uns etwas bedeutet, noch zulegen könnten – und ein starker Motivator, das auch zu tun. …
Der Neid frisst seinen eigenen Herren, wie der Volksmund sagt.
Wie kann man mit ihm umgehen?
Oft hilft ein Perspektivwechsel. Statt etwa anderen ihren Erfolg zu neiden, könnte man auch einen genaueren Blick auf deren Leben werfen: Möchtest du mit jedem Aspekt daraus tauschen? Vielleicht arbeitet die Person sehr viel oder hat Probleme in anderen Bereichen.
Da Neid auf einem ungünstigen sozialen Vergleich beruht, kann es auch hilfreich sein, den Referenzpunkt zu ändern.
Abwärts gerichteter Vergleich kann helfen Es klingt gemein – aber statt sich immer nur mit den Besten der Besten zu messen, kann es guttun, sich auch mal mit denjenigen zu vergleichen, die in einem Bereich unterlegen sind. Psychologen und Psychologinnen sprechen vom abwärts gerichteten Vergleich, der Selbstwert und Wohlbefinden fördert.
Eine andere Strategie gegen den Neid ist, sich bewusst selbst Ziele zu setzen, die unabhängig vom Erfolg anderer sind. Am besten wird wohl sein: den eigenen Rasen so zu pflegen, dass man gar nicht bemerkt, dass das Gras auf der anderen Seite des Hügels grüner sein könnte.“36
Katharina Domschke schreibt über die
Angst:
„Angst ist etwas ganz Normales. Sie gehört neben Freude, Ekel, Wut, Überraschung, Trauer und Verachtung zu den sieben Grundemotionen. Angst ist überlebens-notwendig, denn sie dient als Alarmsystem – sie warnt unseren Körper vor Gefahren. Wer beispielsweise nah an einen Abgrund herantritt, bekommt in der Regel Angst. Das Gefühl vermittelt die Botschaft: Achtung, hier lauert Gefahr! Angst macht unseren Körper und Verstand wacher, dadurch können Menschen die sogenannte Fight-, Flight- oder Freeze-Reaktion zeigen – auf Deutsch Kampf-, Flucht- oder Starre-Reaktion. Je nachdem, in welcher Situation sich ein Mensch befindet, wählt er die Reaktion, die ihm am sinnvollsten erscheint, um zu überleben. Personen entscheiden sich bei einem Angriff eines anderen Menschen beispielsweise dazu, zu kämpfen oder die Flucht zu ergreifen. Die Angst ist in unserer Entwicklungsgeschichte tief verwurzelt – sie stammt noch aus einer Zeit, in der Menschen vor wilden Tieren flüchteten oder sie angriffen, um ihr Überleben zu sichern.“37
Angst hat der Mensch vor Unbestimmtem, Furcht vor Bestimmtem. Beide Phänomene sind von Philosophen ausführlich behandelt worden, so von Kierkegaard und Heidegger. Hierauf einzugehen, würde aber meinen vorliegenden Rahmen leider sprengen. – Stattdessen halte ich es – angesichts der dargestellten menschlichen Befindlichkeiten (der condition humaine) – nunmehr für sinnvoll, Überlegungen darüber anzustellen, inwiefern die Künstliche Intelligenz uns in unserem Menschsein betrifft – und dabei vielleicht sogar eine Zäsur bedeutet.
Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit
Zur Forschungslage
Aus einer Vielzahl von Veröffentlichungen zum Thema wähle ich zunächst zwei Standard-Werke aus, in denen das Thema exemplarisch und ausführlich behandelt wird, wenn auch nicht auf dem neuesten Stand der Entwicklung. Es sind dies
a) Klaus Mainzer: Künstliche Intelligenz – Wann übernehmen die Maschinen?, erschienen 2016 im Springer-Verlag Berlin/Heidelberg und
b) Armin Grunwald: Der unterlegene Mensch – Die Zukunft der Menschheit im Angesicht von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Robotern, München, riva Verlag 2019.
Mainzer widmet dem Thema 239 Seiten, Grunwald 253. Der Erstgenannte beschreibt vor allem die Geschichte, Inhalte und Anwendungsgebiete der KI, während er für den Untertitel mit der Frage nach der „Machtübernahme“ durch die Super-KI nur relativ wenige Zeilen (S. 206-216) aufwendet. Im Einzelnen behandelt Mainzer zunächst die Geschichte der KI von der Antike bis zur Gegenwart, wobei er als Geburtsjahr der modernen KI-Forschung das Jahr 1950 angibt, in dem A. Turing die Herstellung denkender Maschinen – und damit die Verwirklichung eines „alten Menschheitstraums“ – bis spätestens zum Ende des Jahrhunderts prophezeit.
Ausführlich beschäftigt sich Mainzer im Folgenden mit Unterthemen wie der Automatisierung des logischen Denkens in KI-Programmiersprachen, der Programmierung von Wissensrepräsentationen in Expertensystemen, der Art, wie Computer „sprechen lernen“, der Simulation der Evolution durch Algorithmen u.a.m. Beim Wissen unterscheidet der Autor zwischen a) den „Fakten des Anwendungsbereichs“ und b) dem „heuristischen Wissen“ der Anwendungs-Praxis (S. 12 f.). Für die Wissensrepräsentation stellt sich die Aufgabe, aus neuen Eingabe-Daten plausible Folgerungen zu ziehen; wofür der Philosoph H. Dreyfus ein fünfstufiges Modell vorgeschlagen hat, das von der starren Regelanwendung über die Beachtung situationsunabhängiger Merkmale bis zur Urteils-Findung hinsichtlich größerer, übergreifender Ganzheiten der jeweiligen Situation reicht.
Mainzer erklärt dann auch, wie Computer „sprechen lernen“, Automaten- und Maschinen-Sprachen erkennen, Algorithmen die Evolution und neuronale Netze Gehirne simulieren. Es werde angeblich gelingen, „humanoide“ Roboter mit sozialen Kompetenzen zu konstruieren und KI allgemein in den Dienst von Gesellschaft, Industrie und Arbeitswelt zu stellen, wobei Mainzer betont, KI werde keinesfalls Arbeitslosigkeit bewirken, sondern eine „breite Palette“ neuer Arbeitsplätze schaffen (S. 179).
Außerdem werde KI in der Lage sein, immer komplexere Gehirnvorgänge mitsamt deren Dynamik zu modellieren, so dass die Fähigkeiten der entsprechenden Programme in „neuromorphen“ Computern weit über die bloße Mustererkennung hinausgehen würden (S. 197). KI könne zumindest „bewusstseinsähnliche Fähigkeiten“ bekommen (S. 202). Zwar räumt Mainzer ein, dass die hochkomplexe gesamtgesellschaftliche Intelligenz noch keineswegs durch KI ersetzt werden kann; das „kollektive KI-System“ werde jedoch schon bald dem Menschen klar überlegen sein, und zwar sowohl in materieller als auch in funktionaler Hinsicht (S. 207-209). – Dabei bestehe allerdings die Gefahr, dass Algorithmen „aus dem Ruder laufen“, was sich aber durch logische, mathematische und physikalische Kontrolle verhindern lasse.
Was jedoch wiederum problematisch wird durch die unvermeidliche (?) Entstehung von KI-Superintelligenz und insbesondere durch die von dem Silicon-Valley-Ingenieur Ray Kurzweil für das Jahr 2045 vorausgesagte „Singularität“, das Abdanken der Menschheit zu Gunsten superintelligenter Roboter (s.u.). – Im Hinblick auf diese Ungeheuerlichkeit äußert Mainzer sich auffallend zurückhaltend. Zwar räumt er ein, dass KI-Transhumanismus und Militär sich zu einer gemeingefährlichen Allianz verbünden könnten; dennoch verzichtet er auf eine gründliche Kritik der transhumanistischen Silicon-Valley-Phantasmen, fordert keinerlei gesetzliche Maßnahmen und vertraut stattdessen darauf, dass die Technikfolgen der KI abschätzbar bleiben würden, und zwar nicht zuletzt an Hand des Informationsbegriffs (S.212-215). Ohnehin sei jeglicher digitaler Determinismus abzulehnen. Niemand könne die Art künftiger Entwicklungs-Schübe vorhersagen. Dagegen gebe es immer noch genügend Möglichkeiten der Steuerung und Beeinflussung sämtlicher Trends.
Wobei Mainzer nicht verkennt, dass es gefährliche Schwachstellen gibt, z.B. bei der Auswahl der KI-Experten. Nichtsdestoweniger plädiert Mainzer für „Human-centered Engineering“, durch das fruchtbare Interaktionen von Mensch und Technik ermöglicht würden. Dies gelte auch für die allgemein-gesellschaftlichen Veränderungen bzw. diejenigen von Technik, Ökonomie und Ökologie. – Im Übrigen könnten die großen Zukunftsfragen „nur interdisziplinär“ beantwortet werden, um jedenfalls zu verhindern, dass es eines Tages ein böses Erwachen in der „Singularität“ geben werde.
Alles in allem: eine bemerkenswert zurückhaltende, vorsichtig abwägende, letztlich aber wissenschaftsgläubig-optimistische Einschätzung!
Zu Armin Grunwald: Der unterlegene Mensch …
In vier Hauptteilen mit insgesamt 13 Kapiteln präsentiert der Autor hier seine Sicht der Dinge. Während Teil I der „Einstimmung“ dient, geht es in Teil II „Zur Sache: Die überlegenen Algorithmen“, in Teil III „Zum Thema: Wo bleibt der Mensch?“ und in Teil IV: „Zu guter Letzt“ mit den Kapiteln „Illusionen der Digitalisierung“ und „Der überlegene Mensch“.
Grunwald kommt also zu einem Ergebnis, das in exaktem Gegensatz zum Haupttitel seines Buches steht. Man fragt sich, wie eine solche Umkehrung möglich ist. Oder sind wir Menschen etwa gegenüber der Technik mitsamt der KI unterlegen und überlegen zugleich? Grunwald argumentiert wie folgt: Der Mensch ist seit jeher der Technik unterlegen, aber nur in speziellen Teilbereichen und -funktionen. Schon der Urmensch konnte mit seinem Faustkeil wesentlich mehr bewerkstelligen als mit den bloßen Fingernägeln. Gegenüber der spezialisierten Technik erweist sich der Mensch aber stets als überlegen, und zwar a) durch seine Vielseitigkeit und b) durch seine Entscheidungsfähigkeit und -befugnis, über die keine Technik verfügt. Auch wenn dies einhergeht mit immer komplexer werdenden Netzwerken zwischen Mensch und Technik. Heute erweisen sich Algorithmen als teilweise überlegen in der digitalen Arbeitswelt, in Freizeit und Alltag, selbstfahrenden Autos, im Gesundheitswesen usw. So dass zu fragen ist, wie die Digitalisierung möglichst rational gestaltet werden kann und wer sich dabei anzupassen hat: der Mensch oder die Technik?
Wobei mehr und mehr auch politische Dimensionen relevant werden. Kann die KI die Demokratie gefährden? Wohl nicht, solange der demokratische Staat die Kontrolle auch über die Big Data behält. Die Kehrseite: Wird der Staat übermächtig bzw. totalitär, wird politische Kontrolle wie in China zum Selbstzweck. Abgesehen davon, dass vereinzelt auch im Westen der Ruf nach Abschaffung der Demokratie ertönt, da diese angeblich die Freiheit der Mächtigen (= die „Rechte“ der Stärkeren!) behindere (S.171).
Ohnehin droht die KI intransparent zu werden, da sie sich ständig verändert, z.B. durch selbständiges Lernen. Jedenfalls hält Grunwald die Ersetzung der Politik durch Algorithmen für eine „Mogelpackung“, einen „Abstieg in eine neue selbst verschuldete Unmündigkeit“ (S. 182). Dagegen setzt er die Forderung nach digitaler Souveränität (S. 183). Die jedoch erschwert wird u.a. durch neue Subjekt-Objekt-Verhältnisse zwischen Mensch und Technik. Gegenwärtig stehen sich nicht mehr der Mensch als Subjekt und die Technik als Objekt gegenüber, weil in der Technik immer mehr „subjektive“ (eigenständige) Faktoren auftreten, die den Menschen teilweise zum Objekt werden lassen. Es sind Teilbereiche, in denen anscheinend nicht mehr der Mensch, sondern die Technik entscheidet, verstärkt durch zunehmende globale Vernetzung bis hin zu der abstrusen Vision eines „globalen Gehirns“, das die Individualisierung zu beenden drohe. Grunwald betont dagegen die Möglichkeiten des Ichs, einschließlich neuer Vertrauen bildender Maßnahmen gegenüber der KI, so dass auch die „Technisierung des Menschenbildes“ verhindert werden könne: Menschen sind keine Maschinen! (S. 216)
Auch gegenüber ausufernder Digitalisierung pocht der Mensch auf seine Freiheit, seine Individualität, die Verstehen, z.B. von Bedeutungen, und damit Souveränität ermöglicht. Der Mensch, sagt Grunwald, wird nicht aufhören, für eine bessere Welt zu kämpfen. Und er kommt daher abschließend zu seiner optimistischen Vorstellung vom überlegenen Menschen (S. 237 ff.):
„Die Quintessenz dieses Buches besteht also in einem einfachen, fast trivialen Gedanken: Unsere Aufgabe ist es, die digitalen Technologien so zu entwickeln und einzusetzen, dass wir, und das schließt alle Menschen auf dieser Welt ein, ein möglichst gutes analoges Leben führen können. Digitale Techniken sind vielfach wunderbare Mittel zum Zweck – aber sie sind nicht der Zweck selbst.“ (S. 246)
Zur aktuellen Forschungslage: J. Bauer und M. Spitzer
Um die jüngste Entwicklung der KI einigermaßen zu verstehen, können zwei Werke renom-mierter Neurowissenschaftler herangezogen werden, und zwar
a) Joachim Bauer: Realitätsverlust. Wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen – und die Menschlichkeit bedrohen, München 2023, und
b) Manfred Spitzer: Künstliche Intelligenz. Dem Menschen überlegen – wie KI uns rettet und bedroht, München 2023.
J. Bauer setzt sich im Wesentlichen mit dem Transhumanismus auseinander, den er scharf kritisiert. Als den derzeit prominentesten Verfechter einer transhumanistischen, techno-kratisch-kapitalistischen Zukunftsvision bezeichnet er den australischen Philosophen David J. Chalmers (geb. 1966) mit dessen Schrift: Reality+. Virtual Worlds and the Problems of Philosophy, 2022 (dt. 2023). Chalmers leugnet den freien Willen, indem er feststellt:
“Evidence suggests that we may not have Free Will. Our brains seem to be mechanical systems that determine our actions…” (a.a.O. S. 424, auf Deutsch: ‘Offensichtlich haben wir keinen Freien Willen. Unsere Gehirne sind anscheinend mechanische Sys-teme, die unsere Handlungen determinieren.‘)
Die inzwischen mehrfach nachgewiesene Willensfreiheit38 will Chalmers somit durch gehirn-liche Determination ersetzen, wobei er menschliche Gehirne als „mechanische Systeme“ auf-fasst (die umso leichter durch Künstliche Neuronale Netze bzw. KI-Roboter-Gehirne ersetzt werden können!). Hierzu bemerkt J. Bauer:
„David Chalmers‘ Werk Reality+ bündelt die transhumanistischen Tech-Ideologien. Die wesentlichen, aufeinander aufbauenden und miteinander verbundenen Glaubens-sätze dieses Manifests betreffen das Wesen des Lebens und der Realität.
- Lebewesen sind Maschinen, deren innere Funktionen ausschließlich einem pro- grammierbaren Algorithmus folgen. Sie sind daher digital simulierbar. Auch das menschliche Bewusstsein ist simulierbar. Ein freier Wille existiert nicht.
- Angesichts einer zugrunde gehenden Welt ist es wünschenswert und in nicht allzu ferner Zukunft auch möglich, menschlichen Geist und menschliches Bewusstsein auf einen Computer zu transferieren und in eine simulierte Umwelt zu bringen. Da- durch lässt sich Unsterblichkeit erlangen. Die Realität betreffend, unternimmt Chalmers einen Angriff an zwei Fronten:
- Einerseits formuliert er den Anspruch, digital simulierte Realitäten und in sie hin- einplatzierte, digital simulierte Lebewesen dürften einen gleichwertigen Wirklich- keitsanspruch behaupten wie die analoge Realität.
- Andererseits erklärt er die analoge Realität zu einer digitalen Simulation, inszeniert durch unbekannte, Gott-ähnliche Simulatoren auf höherer Ebene. Dies betreffe auch den Menschen. Dass die analoge Realität eine Simulation sei, bezeichnet er als Ent-deckung.“
J. Bauer begnügt sich aber keineswegs mit dieser Zusammenfassung. Vielmehr schließt er seine eigene kritische Bewertung unmittelbar an, indem er erklärt:
„ Diese vier Grundaussagen sind ein fundamentaler Angriff und beinhalten einen um- fassenden Machtanspruch. Soweit sie das Leben betreffen, deuten sie das Verhalten des Menschen zu einem mechanischen, algorithmisch gesteuerten Ablauf um, geben die biologische Existenz des Menschen für technische Manipulationen frei und sprechen dem Menschen seinen intrinsischen Anspruch auf eine unantastbare Autono-mie und Würde ab. Von Chalmers ausdrücklich formulierte Pflichten zu einem verant-wortlichen, ethischen Umgang – zum Beispiel mit den durch Simulation erzeugten Menschen – können diesen Zugriff und Angriff auf das Leben bestenfalls paternali-stisch kaschieren.
Soweit sie die Realität betreffen, sind die angeführten Grundaussagen der Versuch, die Einmaligkeit, Unersetzlichkeit und Unverfügbarkeit des Planeten anzugreifen und die Erde, jenes der Menschheit durch die Evolution zugewiesene Biotop, als durch Si-mulation ersetzbar darzustellen. Beides, sowohl der Angriff auf das Leben als auch der auf die Unersetzlichkeit des Planeten, ist der Versuch, das Leben und unseren Planeten dem Zugriff, der Kontrolle und den Geschäftsinteressen der Digitalkonzerne zu unter-werfen. Mit einer absurden Mystik soll die Menschheit in einen Zustand zurückver-setzt werden, in dem sie vor der Aufklärung über viele Jahrhunderte hinweg gelebt hat.“ (Bauer a.a.O. S. 122 f.)
Wie aber kommt Bauer zu dieser harschen Bewertung, wie begründet er seine vernichtende Kritik? Hierzu ist zunächst näher zu erklären, welche Kernaussagen er zu den beiden von ihm benannten Hauptthemen Leben und Realität trifft.
a) zum Thema Leben
Hier geht es ihm vornehmlich um die natürlichen und existenziellen Grundlagen des mensch-lichen Lebens. Dabei argumentiert er unter der Kapitel-Überschrift „Menschliche Eigen-schaften“ folgendermaßen:
„Die Menschheit ist verunsichert, sie scheint sich ihrer selbst nicht mehr gewiss zu sein.“ Und dies hauptsächlich durch KI, so lautet eine seiner Prämis- sen. Ferner: Während Menschen als Subjekte einen Körper haben, fehlt genau dies der KI:
„KI-Maschinen bestehen aus Schaltkreisen, haben aber keinen lebenden Körper, von dem ein Welt-Interesse ausgeht. Man kann sie mit einem simulierten Körper verbin-den, der ihnen aber kein Welt-Interesse einflößt.“ (a.a.O. S. 27 bzw. 29)
Genau dieses Welt-Interesse ist aber ein Charakteristikum des Menschen, und zwar aus-gehend von seinem Körper, in dessen Gehirn sich die Schnittstelle mit der realen Welt befindet. Die entsprechenden dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen ermöglichen erst die Entwicklung von Gefühlen, Verstand, Vernunft, Geist und Intelligenz. „ Gefühle sind Aus-druck der Selbst-Bezüglichkeit des Körpers.“ (S. 32) Was bei Computern nicht der Fall sein kann, zumal ihnen die „inneren Stimmungen“ fehlen. – Zugleich ist der Körper auch „sozialer Akteur“ (S. 31), herausgebildet aus frühem Welt-Interesse, der Interaktion mit Bezugsperso-nen und den damit verbundenen Resonanz -Vorgängen (s.u.). Schon die Gene sind „kom-munikativ und sozial“ (S. 34). Sie kooperieren in neuronaler Resonanz und in wechselseitiger Beeinflussung u.a. mit Gefühlen und Gedanken. Auch hierzu sind PCs und KI-Systeme nicht in der Lage, zumal sie nicht, wie der Mensch, über ein Selbst und dessen Du-und-Wir- Bezogenheit und auch nicht über Gefühle, Geist und Bewusstsein verfügen.
b) zum Thema Realität
J. Bauer nennt die menschliche Realität ein „kostbares Gut“ mit der Natur als Garanten (S. 145). Wer den Bezug zur Natur verliert, verliert leicht auch den Bezug zur Realität. Wobei zu beachten ist, wie J. Bauer diesen Begriff verwendet. Für ihn ist er der umfassende Begriff, in den er auch den Begriff ‚Wirklichkeit‘ integriert: „Zur Realität wird die Wirklichkeit vor allem dadurch, dass meine Wahrnehmung mit der anderer übereinstimmt, dass sie also zur ge-meinsamen, sozial geteilten Wirklichkeit wird.“ (ebd.) Diese Gemeinsamkeit hält Bauer für unbedingt grundlegend, was auch für jegliche Form wissenschaftlicher Kooperation und Interdisziplinarität gelte (S. 226 f.). Umso gravierender werde jede Form von Realitätsverlust.
(Zur Begriffsklärung: Einer anderen geläufigen Definition zufolge ist nicht die Realität, sondern die Wirklichkeit der umfassende Begriff. Realität ist demnach nur die objektiv vor-handene Welt, die u.a. in Empfindungen und Beobachtungen wahrgenommen wird. Wirk-lichkeit dagegen umfasst auch a) sämtliche Geistestätigkeit, so auch in Verstehen, Interpretieren und Bewerten, und b) jegliche Realität. Hätte Bauer sich daran gehalten, hätte er sein Buch „Wirklichkeitsverlust“ nennen müssen, was vielleicht originell, aber nicht eingängig, sondern ungebräuchlich gewesen wäre.)
Realitätsverlust
Kann man die Realität überhaupt verlieren? Wer weiß? Wie dem auch sei: Was man auf jeden Fall verlieren kann, ist der Bezug zur Realität. Worin dieser Verlust besteht, ist teilweise schon an Bauers Kritik an Chalmers zu erkennen (s.o.). Darüber hinaus geht es Bauer um Folgendes: In Chalmers‘ Transhumanismus sieht er einen zweifachen Angriff auf die Realität: 1. Für digital simulierte Realität beansprucht Chalmers die gleiche Relevanz und Würde wie für die analoge Realität. 2. Auch Letztere werde für Chalmers zu einer „digitalen Simulation, inszeniert durch unbekannte, Gott-ähnliche Simulatoren auf höherer Ebene“ (S. 122). Womit einhergehe:
„Die digitalen Produkte unserer Zeit drohen zu einem hypnotischen System zu werden, das uns unmerklich in Besitz nimmt. Der Realitätsverlust findet auf breiter Front statt und zeigt sich an vielen Stellen unseres täglichen Lebens. Der bedeutsamste Garant von »Realität« für den Menschen ist der analoge andere Mensch, dem ich in die Augen schauen kann, während er mit mir spricht. Dass ein Großteil zwischen-menschlicher Kontakte nur noch unter Zwischenschaltung und Kontrolle von Digital-konzernen stattfindet und dass analoge zwischenmenschliche Begegnungen und der Blick in die Augen eines anderen messbar drastisch abgenommen haben, ist Realitäts - verlust. Dass immer mehr Menschen immer mehr Zeit in den virtuellen Räumen der sozialen Medien, der Videospiele und demnächst im Metaversum verbringen, ist Rea-litätverlust. Dass wir unseren Körper nicht mehr benutzen, sondern ihn durch Avatare ersetzen lassen, dass bereits Grundschulkinder mit ihrem Körper nichts mehr anzufan-gen und keine Purzelbäume mehr schlagen können, all das ist Realitätsverlust.“ (S. 146 f., Hervorhebungen K.R.)
Umso merkwürdiger ist die folgende Gegenüberstellung J. Bauer vs. D. Chalmers, die ‚Microsoft-Copilot‘ auf meine Anfrage hin vorgenommen hat, nachdem dieses KI-Chat-Pro-gramm zuvor Chalmers‘ Reality + zuvor als „einzigartig“ gelobt hat:
„Joachim Bauer äußert sich in "Realitätverlust" tatsächlich sehr kritisch gegenüber David Chalmers und insbesondere dessen Nähe zu transhumanistischen Ideen. Diese Debatte berührt grundsätzliche Fragen über die Natur der menschlichen Existenz und die Rolle von Technologie in unserer Zukunft.
Chalmers' Perspektive:
Chalmers sieht in der Weiterentwicklung von Technologien wie Virtual Reality und künstlicher Intelligenz die Möglichkeit, neue Formen der Existenz und Erfahrung zu schaffen, die das menschliche Leben bereichern könnten.
Der Transhumanismus, der die Idee der Verbesserung des Menschen durch Techno-logie beinhaltet, bietet hier eine optimistische Sichtweise auf die Zukunft.
Bauers Kritik:
Bauer hingegen warnt vor den potenziellen Gefahren dieser technologischen Entwicklungen. Er befürchtet, dass die Flucht in virtuelle Welten zu einem Verlust des Bezugs zur physischen Realität und zu sozialer Isolation führen könnte.
Er sieht im Transhumanismus eine Gefahr für die menschliche Integrität und betont die Risiken, die mit dem Streben nach technologischer "Verbesserung" des Menschen verbunden sind.
Beide Perspektiven bieten wichtige Einsichten:
Chalmers erinnert uns daran, dass Technologie immense Möglichkeiten zur Verbes-serung unseres Lebens bietet, wenn sie richtig genutzt wird.
Bauer mahnt zur Vorsicht und betont die Notwendigkeit, ethische und soziale Implikationen sorgfältig zu bedenken, um die Menschlichkeit zu bewahren.
Es ist ein komplexes Spannungsfeld, und es ist entscheidend, dass wir beide Seiten dieser Debatte verstehen und abwägen. Es geht darum, einen Weg zu finden, der das Potenzial der Technologie nutzt, ohne dabei die fundamentalen Werte und das Wohlergehen der menschlichen Gesellschaft zu gefährden.
Diese Diskussion ist besonders relevant in der heutigen Zeit, da technologische Fortschritte rasant voranschreiten.“
Davon abgesehen kann Realitätsverlust schon nicht-digital beginnen, z.B. in Zuständen geistiger und psychischer Abwesenheit oder auch durch Drogen, Alkohol, Kriminalität und andere Süchte. Für damit vergleichbar hält J. Bauer die Flucht in die digitalen („sozialen“) Medien, durch die alle zwischenmenschlichen Beziehungen in Gefahr geraten seien. Zugleich drohe die Menschheitsentwicklung hinter die Aufklärung zurückzufallen. Profiteure seien vor allem die in Konzernen organisierten Produzenten digitaler Medien, einschließlich KI. Künstliche Neuronale Netze (KNN) sind körper-, seelen-, geist- und bewusstlos. Sie haben keine Gefühle, können diese allenfalls simulieren. Gleiches gilt für die Sexualität, auch diese kann durch KI simuliert werden, ohne dass diese je zeugungsfähig wäre. Darüber hinaus kritisiert Bauer heftig und ausführlich weitere negative Aspekte der KI (S. 141 ff.). In Kurzform:
1. KI wird wahllos mit allem möglichen Informations-Material gefüttert, was seine Fehleranfälligkeit deutlich erhöht.
2. „Die Gefahr ist, dass die Systeme, wenn wir uns ihnen als Goldstandard des Wissens unterwerfen, die Menschheit auf ihren jetzigen Wissens- und Nichtwissensstand, auf ihren Stereotypen und Vorurteilen gleichsam »festnageln« und Entwicklungen behin-dern.“ (S. 142)
3. Unklar ist, wie KI-Systeme zu ihren Ergebnissen kommen.
4. Damit kann in der Öffentlichkeit (incl. Justiz, Polizei, Militär usw.) niemand für diskriminierende Fehlentscheidungen verantwortlich gemacht werden.
5. Da KI-Bots in Konversationen häufig kaum als solche erkennbar sind, besteht die Gefahr der (u.a. politischen!) Manipulation.
6. KI-Systeme verbrauchen enorme Mengen an Energie.
All dies kann ebenfalls Realitätsverlust bedeuten. Außerdem gibt es Realitätsverluste „der besonderen Art“. Sachlichkeit geht dadurch verloren, dass in der KI Spektakuläres und Provo-kantes mehr gilt als nüchterne Fakten und Berichte. PC-Video-Spiele, zumal im Übermaß und in Form von Kampf- und Gewaltspielen konsumiert, gefährden die Gesundheit, vor allem von Kindern und Jugendlichen, die nicht selten auch in den späten Abendstunden und bis tief in die Nacht hinein vor ihren Video-Geräten sitzen. Wenn in Deutschland rund eine Million junger Leute bis zu 5 Stunden täglich mit Gaming verbringen, unterliegen sie ständig der Ge-fahr von Abhängigkeit und schwerster gesundheitlicher Schädigung. Und: „Der mit intensi-vem Gaming einhergehende Realitätsverlust ist zugleich ein Verlust an Menschlichkeit, vor allem der Gamer sich selbst gegenüber.“ (Verstärkt im sogenannten „Metaversum“39, einer digitalen Neuentwicklung, die u.a. „Verwandlungen“ in Avatare ermöglicht, S. 97 ff.).
Bauers Fazit:
„Nichts, was in einem Metaversum geschieht, ist vertraulich, alles, was kommu-niziert wird und zwischen den Usern geschieht, ist für die Mutterkonzerne zugänglich. Wenn sich Zuckerbergs Vorstellung realisiert, dass irgendwann alle gezwungen sein werden, sich im Metaversum – möglichst natürlich in seinem Metaversum – anzumelden, einfach deshalb, weil sich alle anderen auch dort aufhalten, dann steht die Menschheit einer unkontrollierten Machtfülle gegenüber, wie sie womöglich nicht einmal im Mittelalter bestanden hat.“ (S. 107)
Allerdings: All dies muss unbedingt und unweigerlich Gegenwehr bewirken, die Bauer wie folgt kennzeichnet:
„Dass die Propheten der aus dem Transhumanismus kommenden digitalen Mystik, die Produzenten von Science-Fiction-Filmen und von Videospielen die Erde als einen bereits an die Apokalypse preisgegebenen Planeten darstellen, ist Realitätsverlust. Dass wir die Realität – und mit ihr die Natur – vergessen sollen, ist nicht nur digitale Mystik, sondern Teil eines gigantischen Geschäftsmodells.
Es wird Zeit, die digitale Mystik zu entmystifizieren, aufzuwachen und den Marsch in die selbstverschuldete Unmündigkeit zu beenden.“ (S. 147, Hervorhebungen K.R.)
Die mit KI eingetretenen Gravamina wie Ent-Demokratisierung, Ent-Körperlichung, Ent-Materialisierung, Entwicklungs- und Gesundheitsgefährdung, Entfremdung usw. müssen ent-schieden bekämpft werden.
Zu Manfred Spitzer: Künstliche Intelligenz. Dem Menschen überlegen – wie KI uns rettet und bedroht, München 2023
Das Buch unterscheidet sich von J. Bauers Realitätsverlust vor allem durch eine insgesamt weniger kritische Einschätzung der KI. Zudem geht Spitzer auf einige Schlüssel-Themen wie Realitätsverlust, Chalmers‘ Reality+ und Metaversum gar nicht ein. Auch fehlen Begriffe wie Resonanz, Selbst-System und Gaslighting. Dagegen behandelt Spitzer einige Aspekte, die bei J. Bauer nicht vorkommen, darunter Begriffe wie ‚Künstliche Intuition‘, ‚Neuroplastizität‘ und die militärischen Dimensionen der KI.
Zur ‚Künstlichen Intuition‘
Nicht nur in Bezug auf Rechen- und Intelligenzleistungen, logisches Schlussfolgern, Algo-rithmen usw., sondern auch hinsichtlich der früher für typisch menschlich gehaltenen Intu-ition scheint KI uns Menschen überlegen zu sein. Laut Wörterbuch ist Intuition ein „Wissen, das ohne bewusstes Nachdenken gewonnen bzw. angewendet wird. Es handelt sich um eine Art zu denken und zu entscheiden, die auf scheinbar instinktiven Reaktionen beruht, ein Den-ken, ohne zu denken“.40 (Zur Erinnerung: Das lateinische ‚intueri‘ bedeutet u.a. ‚hinblicken, anblicken, anstaunen, erwägen, berücksichtigen‘.) „Menschen haben Intuition – d.h. bringen plötzlich neue Ideen hervor, ohne angeben zu können, wie sie darauf gekommen sind.“ (a.a.O. S. 48) KI wandelt zwar – wie die menschlichen Gehirne – u.a. intuitiv Input in Output daum, und zwar oft in „genialer“ Weise, aber: Wir sind nicht in der Lage, anzugeben, wie die Intuition bei der KI zustande kommt und funktioniert.
Neuroplastizität
Spitzer: „Die wichtigste Entdeckung im Bereich der Gehirnforschung bzw. Neurowissen-schaft des vergangenen halben Jahrhunderts – aus meiner Sicht mit weitem Abstand – ist die der »synaptischen Plastizität«. Hiermit ist gemeint, dass die Verbindungsstellen von Neuro-nen, die Synapsen, unterschiedlich stark sein können und dass sich diese Stärke ändert, wenn zwei miteinander synaptisch verbundene Neuronen zugleich aktiv sind. … Die synaptische Plastizität bewirkt eine verstärkte Übertragung des einlaufenden Nervenimpulses.“ (a.a.O. S. 81) Man unterscheidet zwischen synaptischer und kortikaler Plastizität. Erstere bedeutet, dass „ein Nervenimpuls einen stärkeren Effekt am nachgeschalteten Neuron hat“. Dagegen beziehe sich die kortikale Plastizität auf „Änderungen dessen, wofür Neuronen stehen (also was sie re-präsentieren …)“ (S. 82). Dementsprechend passe unser Gehirn sein „Hardware“, die Nerven-zellen, immer wieder wechselnden Erfordernissen an, um die Informationen besser verarbei-ten zu können. Spitzer nennt dies eine Erkenntnis, die bisher viel zu wenig beachtet worden sei (S. 83).
Militärische Dimensionen
Auf diesem Gebiet gibt es zahlreiche neue, teils beängstigende Entwicklungen, mit denen z.B. versucht wird, militärisch relevante Informationen so rasch wie möglich zu verarbeiten. Dabei habe das Militär in den letzten Jahren „völlig neue Formen und Strategien vom Krieg entwik-kelt – und dies im Wissen, dass alle Militärs dies tun, was den Erfolg der eigenen Bemühun-gen nicht eben einfacher macht“ (S. 235). Das Grundproblem:
»Entscheidungsträger wollen KI nutzen, um Unsicherheiten zu verringern: Sie wollen das Schlachtfeld klarer beurteilen, die Absichten und Fähigkeiten des Gegners erkennen; und sie wollen ihr Vertrauen in die Wirksamkeit der eigenen Fähigkeiten und der Fähigkeit, einen Angriff vorauszusehen oder ihm zu widerstehen, erhöhen. Zugleich aber schaffen unerwartetes Verhalten oder gar Ausfälle von KI-Systemen eine neue Quelle der Unsicherheit, was wiederum zu falschen Wahrnehmungen führen kann.«
Dabei werde künftige Kriegsführung vor allem durch den Einsatz von Drohnen und Kampf-robotern bestimmt, so dass Soldaten immer weniger wichtig zu werden scheinen. Denn: KI-Kampfmaschinen operieren weitgehend autonom, was sie durch „vielfaches Durchspielen von Miltärmissionen“ gelernt hätten. Hinzu kommen Schwarmtaktiken, mittels derer eine Vielzahl von Drohnen (angeblich mindestens 250) gleichzeitig verwendet wird. Wozu Spitzer anmerkt, dass hier vieles noch an Science-Fiction erinnere, aber: Cyber-Aktivitäten dienen weltweit dazu, Luft- und Weltraummacht, See- und Landstreitkräfte zu kombinieren und zu integrieren – und dies auch entgegen aller Vorbehalte von Ethik-Kommissionen. …
Nicht beseitigt scheint jedenfalls das Dilemma, dass KI einerseits dem Militär nutzen, ande-rerseits aber auch neue Verunsicherung eintragen können (s.o.).
Insgesamt gesehen erkennt Spitzer sehr wohl die Ambivalenz von KI: einerseits Rettung, andererseits Bedrohung darzustellen. Rettung könne eintreten z.B. durch neue Antibiotika, bei der Erdbebenvorhersage, bei der Bewältigung der Klimakrise und bei der Bereitstellung neuer Wirk- oder Treibstoffe wie Methan und Wasserstoff. Die Bedrohung sieht Spitzer vor allem in Mängeln gesetzgeberischer Regulierung, dagegen überhaupt nicht in dem Vernichtungs-potenzial von KI:
„Die Politik läuft der Entwicklung hinterher, und zumindest Mitte des Jahres 2023 hat man noch den Eindruck, dass die Regierungen einzelner Staaten oder die EU ange-sichts der Herausforderungen einer wirksamen Regulierung der KI noch sehr zahnlos daherkommen. Wir brauchen nicht darüber nachzudenken, ob eine allgemeine KI ir-gendwann Bewusstsein hat oder die Menschheit vernichtet – das ist Science-Fiction. Aber über reale Risiken und Gefahren von böswilligen Menschen, die KI für ihre Zwecke zu missbrauchen, müssen wie nachdenken – gründlich. Und über die Verant-wortung der reichsten Unternehmen der Welt auch.“
Was zugleich Spitzer Schlusswort auf der Seite 283 seines Buches ist. – Last not least: Wie J. Bauer unterlässt auch M. Spitzer jeglichen Versuch, die KI-Kritik mit der – existenziell und weltweit – bedeutsamen und erforderlichen allgemeinen Systemkritik am Kapitalismus-Neoliberalismus zu verbinden. Auch den anscheinend ausweglosen KI-Wettstreit (bzw. -Kon-flikt?) zwischen den Supermächten USA und China erwähnt keiner der beiden Autoren.
Ist der Mensch als Selbst „das nicht-festgestellte Tier“? J. Bauer: „Wie wir werden, wer wir sind.“
Was den Menschen ausmacht, ist nicht nur die Personalität, sondern auch das Selbst-Sein. Was schon bei Nietzsche eine bedeutende Rolle spielte. Im ‚Zarathustra‘ äußerte er hierzu Folgendes:
»„Leib bin ich und Seele“ — so redet das Kind. Und warum sollte man nicht wie die Kinder reden?
Aber der Erwachte, der Wissende sagt: Leib bin ich ganz und gar, und Nichts ausserdem; und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe.
Der Leib ist eine grosse Vernunft, eine Vielheit mit Einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Heerde und ein Hirt.
Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein Bruder, die du „Geist“ nennst, ein kleines Werk- und Spielzeug deiner grossen Vernunft.
„Ich“ sagst du und bist stolz auf diess Wort. Aber das Grössere ist, woran du nicht glauben willst, — dein Leib und seine grosse Vernunft: die sagt nicht Ich, aber thut Ich.
Was der Sinn fühlt, was der Geist erkennt, das hat niemals in sich sein Ende. Aber Sinn und Geist möchten dich überreden, sie seien aller Dinge Ende: so eitel sind sie.
Werk- und Spielzeuge sind Sinn und Geist: hinter ihnen liegt noch das Selbst. Das Selbst sucht auch mit den Augen der Sinne, es horcht auch mit den Ohren des Geistes.
Immer horcht das Selbst und sucht: es vergleicht, bezwingt, erobert, zerstört. Es herrscht und ist auch des Ich’s Beherrscher.
Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser — der heisst Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er.
Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit. Und wer weiss denn, wozu dein Leib gerade deine beste Weisheit nöthig hat?
Dein Selbst lacht über dein Ich und seine stolzen Sprünge. „Was sind mir diese Sprünge und Flüge des Gedankens? sagt es sich. Ein Umweg zu meinem Zwecke. Ich bin das Gängelband des Ich’s und der Einbläser seiner Begriffe.«
Für die Erklärung des Selbst-Seins bedeutet dies Folgendes:
1. Das Selbst ist der Leib.
2. Daher steht der Leib auch hinter und über dem Ich.
3. Das Selbst verkörpert als Leib die stärkste Vernunft überhaupt und steht daher auch hinter und über jeglicher Vernunft und jeglichem Geist des Menschen.
4. Das Selbst ist der Leib und doch auch „ein unbekannter Weiser“.
Letzteres scheint unlogisch zu sein, denn der Leib ist ja nicht unbekannt, es sei denn in der von Nietzsche postulierten Einheit von Leib und Vernunft. Diese aber – das Selbst – befähigt angeblich das Ich zum Handeln, jedoch nicht zur Sprache – was ebenfalls unlogisch erscheint, denn die Sprache ist ja für Nietzsche als Teil von Geist, Sinn und Seele ebenfalls nur eine Eigenschaft des Leibes, „etwas am Leibe“.
Vollends problematisch wird Nietzsches Selbst-Konstrukt dadurch, dass er Selbst, Mensch und Tier gleichsetzt. Hierzu heißt es im ‚Zarathustra‘:
“Der Mensch ist das grausamste Tier.”
“Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem Abgrunde.”
“Einst wart ihr Affen, und auch jetzt noch ist der Mensch mehr Affe, als irgend ein Affe.”
Genauer: Der Mensch sei „das noch nicht festgestellte Tier“.41 Ein Tier, das zwar zu sich selbst Stellung nehmen könne, aber dauernd daran gehindert werde, und zwar durch die Reli-gion; was Nietzsche wie folgt begründet:
„Der christliche Glaube ist von Anbeginn Opferung: Opferung aller Freiheit, alles Stolzes, aller Selbstgewissheit des Geistes; zugleich Verknechtung und Selbst-Verhöhnung, Selbst-Verstümmelung.“42
„Denn der Mensch ist kränker, unsicherer, wechselnder, unfestgestellter als irgend ein Thier sonst, daran ist kein Zweifel, — er ist das kranke Thier: woher kommt das? Sicherlich hat er auch mehr gewagt, geneuert, getrotzt, das Schicksal herausgefordert als alle übrigen Thiere zusammen genommen: er, der grosse Experimentator mit sich, der Unbefriedigte, Ungesättigte, der um die letzte Herrschaft mit Thier, Natur und Göttern ringt, — er, der immer noch Unbezwungne, der ewig-Zukünftige, der vor seiner eignen drängenden Kraft keine Ruhe mehr findet, so dass ihm seine Zukunft unerbittlich wie ein Sporn im Fleische jeder Gegenwart wühlt: — wie sollte ein solches muthiges und reiches Thier nicht auch das am meisten gefährdete, das am Längsten und Tiefsten kranke unter allen kranken Thieren sein? … “43
„Gefährdet ist dieses Tier gerade durch seine wechselnden und immer einseitigen Versuche zu seiner Selbstbestimmung. Sie tragen einerseits dazu bei, es in schwerste, durch Moralen und Religionen befeuerte Auseinandersetzungen zu treiben, Kriege, gewaltsame Revolutionen, Völkermorde. Sie eröffnen andererseits aber auch Spielräume der individuellen Selbstbestimmung. Diese gelingt zwar selten, bleibt meist unproduktiv:
Es giebt bei dem Menschen wie bei jeder anderen Thierart einen Überschuss von Missrathenen, Kranken, Entartenden, Gebrechlichen, nothwendig Leidenden; die gelungenen Fälle sind auch beim Menschen immer die Ausnahme und sogar in Hinsicht darauf, dass der Mensch das noch nicht festgestellte Thier ist, die spärliche Ausnahme.“44
Hier fällt auf, dass Nietzsche den Menschen als „das kranke Tier“ bezeichnet, diesem aber andernorts Fähigkeiten und Eigenschaften zuerkennt, die bei keinem Tier nachweisbar sind. Trotzdem behauptet er, der Mensch sei „das noch nicht festgestellte Tier“, stellt aber selbst fest, dieses „Tier“ – verkörpert u.a. in Nietzsche selbst – sei zu nie dagewesenen geistigen Höhenflügen imstande, angefangen bei der Kritik am Christentum, das eine Form von „Nihi-lismus“ darstelle, über die „Umwertung der Werte“, welcher „der Wille zur Macht“, der „Übermensch“ und die „Ewige Wiederkehr des Gleichen“ zu folgen hätten. Es sind geistige Höhenflüge, zu dem kein Tier in der Lage sein kann, zumal ihm die Grundvoraussetzung hierfür fehlt: situationsunabhängig zu denken und zu handeln. Bei welchem Tier wäre denn ein Wissen über das Christentum nachweisbar, bei welchem Begriffe wie Wert, Umwertung, Wille, Macht, Übermensch usw.? – Dagegen ist eindeutig nachweisbar, dass Nietzsches Ge-dankengebäude großenteils auf seiner überzogenen, teils blindwütigen Kritik am Christentum beruht, dem er u.a. totale Leibfeindlichkeit vorwirft.45
Umso wertvoller ist die Neubestimmung des Selbst-Systems, die der Neurowissenschaftler Joachim Bauer (2019) in seinem Buch Wie wir werden, wer wir sind vorgetragen hat. Darin weist er auf, dass das Selbst – anders als Nietzsche es vermeinte – nicht mit dem Leib iden-tisch, d.h. nicht angeboren ist, sondern erst durch zwischenmenschliche Beziehungen im Säuglingsalter zu entstehen beginnt:
„Der menschliche Säugling, obwohl ein fühlendes, mit der Würde des Menschen aus-gestattetes Wesen, verfügt über kein Selbst. Die neuronalen Netzwerke, in denen sich Letzteres einnisten wird, sind zum Zeitpunkt der Geburt noch unreif und funktions-untüchtig. Seine Entstehung und Grundstruktur verdankt das menschliche Selbst jenen Bezugspersonen, die uns – vor allem in den ersten Lebensjahren – als »Extended Mind«, das heißt, als eine Art externe Leitstelle gedient haben. An der Komposition des Selbst sind Resonanzvorgänge beteiligt, wie sie sich zum Beispiel zwischen zwei Gitarren beobachten lassen: So, wie der Klang der einen Gitarre die Saiten einer zwei-ten Gitarre zum Klingen bringen kann, so können Bezugspersonen ihre inneren Melo-dien – ihre Art zu fühlen, die Welt zu deuten und in ihr zu handeln – via Resonanz auf den Säugling übertragen. Da dieser Transfer sich – in reduzierter Form – lebenslang fortsetzt, ist unser Selbst eine Komposition aus entsprechend vielen Themen und Melodien.“ (a.a.O. S. 7)
Das Selbst ist also nicht einfach der Leib, sondern ein Gemisch, ein mixtum compositum, aus dem personalen Individuum – als Einheit aus Leib, Seele und Geist –, seinen Bezugspersonen, seiner Umwelt und der Gesamtheit seiner Erfahrungen. J. Bauer präzisiert:
„In Säuglingen und Kleinkindern komponiert sich ein Selbst, dessen Themen von ihren Bezugspersonen über Resonanzvorgänge in sie hineingelegt wurden. Je weiter wir heranwachsen und persönlich reifen, desto mehr wird das Selbst zu einem Akteur, der mitspricht und beeinflusst, was mit ihm geschieht. Wir entwickeln ein Gefühl, das uns spüren lässt, welche an uns herangetragenen Angebote zu uns passen und zu einem stimmigen Teil unseres Selbst werden könnten, und welche unserer Identität Gewalt antun würden. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich an der Konstruk-tion seiner selbst – und seines Selbst – beteiligen kann, ein Hinweis, der in dieser ex-pliziten Form erstmals durch den Renaissance-Philosophen Pico de la Mirandola gege-ben wurde.“ (a.a.O. S. 8, Hervorhebungen K.R.)
Näheres und Weiteres hierzu führt J. Bauer auf 255 Seiten in 15 Kapiteln aus, darunter spe-ziell zum Selbst-System in den Kap. 1-6, 10, 11, 13 und 14, daneben und zusammen mit Themen wie Resonanz (darunter dem „Resonanzraum der Gesellschaft“, wenn auch nur auf gut 6 Seiten), Pädagogik, Arbeit, Partnerschaft, Psyche und Neurobiologie.
Zur Entstehung des Selbst:
Der Säugling wirkt und ist zunächst einerseits völlig hilflos und unreif, zeigt aber andererseits schon frühzeitig Fähigkeiten zu Anteilnahme und Kommunikation mit seinen/ihren Bezugs-personen, und zwar u.a. dadurch dass Säuglinge schon früh beginnen, z.B. die Mimik einer Bezugsperson nachzuahmen. Echte Spiegelung und Resonanz wird daraus allmählich auf Grund der sogenannten Spiegelneuronen oder auch: Spiegelnervenzellen. (Wobei sogleich daran zu erinnern ist, dass diese speziellen Nervenzellen für die Empathie zuständig sind.) Hier liegen nicht Echo-Effekte, sondern echte Resonanz-Funktionen vor, und zwar u.a. in Form von Signalen der Körpersprache bzw. des Gefühlsausdrucks sowohl beim Säugling als auch bei der Bezugsperson. Hierdurch werde sogar das Gehirn des Säuglings geformt (a.a.O. S. 24). Wobei sich das Selbst nach und nach u.a. als Ich-Du-Sinn herausbilde:
„ Der Mensch entwickelt seinen Ich-Sinn in einer absolut einzigartigen Art und Weise: Das Selbst des Menschen als »Ich-Du-Sinn«. Das Resonanzprinzip lässt die Ge-stimmtheiten, Haltungen und Handlungsweisen der primären Beziugsperson(en) zu den Gefühlen und inneren Einstellungen des Kindes werden.“ (J. Bauer a.a.O. S. 31, Hervorhebungen K.R.) Daher fordert der Autor auch für die Kleinsten „ein sozial in-telligentes Umfeld, also Eltern oder gut qualifizierte Bezugspersonen, die ihnen ein verlässliches, liebevolles, dabei aber nicht einengendes, sondern förderndes Du sind.“ (a.a.O. S. 57)
Im Zusammenhang damit beschreibt J. Bauer auch den frühkindlichen Spracherwerb, wobei er hervorhebt, dass von der Sprache auch psycho-physische Top-down-Bewegungen ausge-hen, und zwar mittels neurobiologischer Rezeptoren im Gehirn, wobei nicht nur die Sprach-zentren des Gehirns, sondern auch die Spiegelneuronen und das neuronale Selbst-System aktiv werden. Zwischen beiden Systemen gebe es eine Arbeitsteilung. Das Selbst-System ar-beitet vor allem mit kognitiven Geistesinhalten (Gedanken, Ideen, Begriffe, Theorien, Wer-tungen usw.), während Spiegelneuronen nach speziellen neurobiologischen Regeln funktio-nieren, und zwar auf Grund von „Informationen, die sich mit dem Körper ausdrücken oder am Körper ablesen lassen“ (S. 85). (Was natürlich ebenfalls eine Form von Resonanz ist.) Das Erstaunliche daran: Die durch das neurobiologische Resonanzsystem „übertragene Informa-tion ist nichtstofflicher Natur“ (S. 86)! Die Körpersprache wird dabei sozusagen „ausgelesen“, indem der Beobachter die beobachtete Handlung „sozusagen »heimlich, still und leise« simu-liert, das beobachtete Geschehen also intern als Kopie mitlaufen lässt“ (ebd.), was mit dem Phänomen der „emotionalen Ansteckung“ verbunden sein kann: Gemütszustände wirken dann wechselseitig:
„Das Lesen der Körpersprache kann durch Erfahrung und Übung optimiert werden. Menschen mit Autismus können die Körpersprache anderer nicht »lesen«. Besonders geübt im Entschlüsseln der Körpersprache sollten Menschen sein, die viel mit anderen zu tun habe: Pflegekräfte, Sozialarbeiterinnen uns Sozialarbeiter, Servicepersonal, Ärztinnen und Ärzte, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Anwältinnen und An-wälte, Richterinnen und Richter, Eltern und Großeltern.“ (S. 89)
Die Kehrseite: Es gibt auch das Leiden am Selbst, so in Phänomenen wie Narzissmus, Abhängigkeit, Depressionen, bis hin zu ‚Gaslighting‘ (Psychoterror durch Einschüchterung u.a.m.) und zur „Auflösung des Selbst“, z.B. in Erkrankungen wie Traumatisierung und Demenz. – Wogegen das Selbst sich jedoch zu wehren vermag:
„Das Selbst ist jedoch nicht machtlos. Es spürt nicht nur, welche Menschen und welche Ansagen ihm guttun oder nicht behagen, welche seine Kräfte vermehren oder schwächen. Es hat den Selbst-Beobachter an seiner Seite, der es ihm ermöglicht, sich über sich, über die eigenen Motive und über die Motive anderer Gedanken zu machen. Sein Sensorium und seine Analyseinstrumente befähigen das Selbst, Einfluss darauf zu nehmen, mit welchen Menschen es sich umgibt, welchen Menschen es sich anschließt und was mit den Botschaften passiert, die von Mitmenschen im eigenen Selbst landen.“ (S. 161)
Insgesamt gesehen hält J. Bauer den Besitz des Selbst-Systems für ein Erkennungs- und Alleinstellungsmerkmal der menschlichen Spezies. Es befähigt sowohl zur Selbst-Fürsorge als auch zur Fürsorge für andere Menschen. Es verhilft zur Ich-Findung, zur inneren Ruhe und Gelassenheit, so auch in der Meditation, in Yoga und – falls erforderlich – durch Psycho-therapie. Worin J. Bauer auch Möglichkeiten und zugleich Verpflichtungen des ärztlichen Tuns erkennt, die weit über Diagnostik und Therapie hinausgehen:
„Wen adressieren Ärzte, wenn sie eine Diagnose mitteilen oder die Behandlung erklä-ren? Sie adressieren das Selbst-System ihrer Patienten, welches – parallel zu dem, was der Arzt tut – seinerseits, sozusagen als »innerer Arzt«, in den eigenen Körper hinein-wirkt. Optimale Heilerfolge erzielen nur solche Ärzte, die in der Kommunikation mit ihrem Patienten dessen Selbst-Kräfte und seine Zuversicht stärken und ihm erklären, dass es sich lohnt, den Lebensstil gesundheitsdienlich zu verändern, und die ihm Mut machen, der Krankheit die körpereigenen Heilkräfte entgegenzusetzen. Zu den Aufga-ben jedes guten Arztes gehört es, den »inneren Arzt« seiner Patienten anzusprechen und zu stärken.“ (S. 200 f.)
Und Bauers Schlusswort lautet:
„Der Umgang mit unserem Selbst – und mit dem unserer Mitmenschen – erfordert Sensibilität, Geduld, Bewahrung, manchmal aber auch einen mutigen Schritt hinein in Möglichkeits- und Entwicklungsräume. Mehr als alles andere aber braucht unser Selbst – und das unsere Mitmenschen – dieses eine: Liebe.“ (S. 209)
Dies ganz im Sinne meiner eigenen Darlegungen zum Thema „Liebe als Weltknoten“ (s.o. S. 36 ff.). Wobei allerdings zu bedenken ist, dass mit Liebe allein leider nicht alle Welt-Probleme zu lösen sind.
Zum Tier-Mensch-Vergleich
Nicht zu unterschätzen sind die neuen Möglichkeiten des Tier-Mensch-Vergleichs, die sich aus J. Bauers Erkenntnissen ergeben. Der Mensch ist Tier – aber nur im biologischen Sinne, auch wenn der Mensch sich vom Tier durch den aufrechten Gang unterscheidet. Was den Menschen zum Menschen macht, ist zunächst die einzigartige Einheit von Körper, Seele und Geist, die er verwirklicht, zumal in Seele und Geist die deutlichsten Unterscheidungsmerk-male zu finden sind. Menschlicher Geist beruht auf menschlicher Subjektivität, ohne die es die für den Geist charakteristischen, dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen nicht gäbe. Philosophisch beginnt menschliche Subjektivität mit dem Cogito ergo sum: Man muss als Mensch existieren, um wie ein Mensch denken zu können. Was Descartes (1596-1650) noch nicht wusste: In dieser Existenz, d.h. vom Säuglingsalter an, entwickelt sich das Subjekt-Sein, wie J. Bauer erklärt, dadurch, dass sich das Selbst im Resonanz- und Empathie-Umgang mit den Bezugspersonen herausbildet. Dies erst recht in Verbindung mit hoch entwickelter, meta-phorischer Sprache und hoch entwickelter Technik. Als Subjekt ist der Mensch in der Lage, sowohl situationsgemäß als auch situationsunabhängig zu erleben, zu denken und zu handeln. Hierzu ist kein Tier fähig. Dagegen geht im Menschen das Tier zum Menschen über, wird das Tierische in das Menschliche integriert – oder zumindest integrierbar. Womit das Mensch-Sein nicht endgültig „festgestellt“ oder „festgelegt“, wohl aber vorläufig plausibel erklärt wird.
Eine neue politische Perspektive
Dankbar bin ich auch für die politische Perspektive, die sich aus einem von J. Bauer nicht erwähnten Aspekt des Selbst-Systems ergibt:
Da das Selbst-System zur Ich-Findung, Selbst-Fürsorge und Fürsorge für andere Menschen befähigt, hat das Individuum – das personale Selbst – einen Rechtsanspruch auf Selbst-bestimmung, und zwar auch deshalb, weil der Mensch das einzige Wesen ist, „das sich an der Konstruktion seiner selbst – und seines Selbst“ beteiligt bzw. beteiligen kann, soll und muss. Beteiligt ist der Mensch vom Säuglingsalter an (s.o.). Beteiligen muss er sich später daran, wie sein Selbst konkret gestaltet wird, dabei auch im gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Dieser darf seinem Anspruch auf Selbstbestimmung nicht im Wege stehen, was nur dann möglich zu sein scheint, wenn der Anspruch auf Selbstbestimmung tatsächlich auch gesamt-gesellschaftlich gewährleistet wird. Jedes Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung, wobei jedes personale Individuum, die Einzelperson, an der individuellen Inanspruchnahme und Wahrnehmung dieses Rechts nur dann gehindert werden darf, wenn es dabei die Rechte sei-ner Mitmenschen verletzt oder missachtet.
Politisch besagt dies: Demokratie bedeutet nicht nur „Herrschaft des Volkes für das Volk und durch das Volk“, sondern auch Selbstbestimmung des Volkes. Demgemäß erstrebenswert er-scheint eine Mischung aus direkter und repräsentativer Demokratie, weil in beiden Formen – und erst recht in ihrer Kombination und effektiver Kooperation – sowohl das Gemeinwohl als auch die Rechte der Einzelpersonen gewahrt werden. – Dieser gesamtgesellschaftliche Aspekt des Selbst-Systems sollte in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden.
Allerdings: Weder mit Liebe noch mit Demokratie allein oder zusammen können sämtliche akuten und latenten Welt-Probleme gelöst werden. Hierzu bedarf es weiterer Anstrengungen – nicht nur ethischer, sondern vor allem auch politischer Natur.
Als aktuelle Probleme mit höchstem Bedrohungspotential lassen sich herausstellen:
1. Die Öko-Katastrophe, d.h. die Zerstörung von Lebensgrundlagen in Umwelt, Natur und Klima, greift um sich, auch wenn gelegentlich Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
2. Der neolíberale Turbo-Kapitalismus verschärft in seiner globalisierten Form weltweit die sozialen Ungleichheiten, Gegensätze und Konflikte und lässt dabei u.a. Rechts-radikalismus, Nationalismus und Populismus in gefährlichem Ausmaß erstarken.
3. Die Digitalisierung droht in eine „Digitale Diktatur“46 umzuschlagen, z.B. in Folge von zunehmendem Daten-Diebstahl und -Missbrauch, Cyberkrieg, illegalem Drohnen-Einsatz u.a.m.
4. Die Ideologie des Transhumanismus 47 begünstigt ebenfalls den Missbrauch von Digitalisierung („Big Data“) und Künstlicher Intelligenz.
5. Posthumanismus. Wie u.a. Ray Kurzweil behauptet, gibt die Menschheit sich in der „Singularität“ des Jahres 2045 selbst auf, und zwar zu Gunsten superintelligenter, „unsterblicher“ Roboter.48
6. Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, dass die Menschen seit 1945, d.h. seit Hiroshima und Nagasaki, in der Angst vor der Atomkriegsgefahr leben.
Nur bei zweien (Nr. 4. u. 5.) dieser aktuellen Probleme lassen sich Bezüge zu Nietzsche herstellen: bei Trans- und Posthumanismus, wenn auch mit eher fragwürdigen Ergebnissen. Nietzsche predigt bekanntlich den Übermenschen, versteht den Menschen als „Etwas, das überwunden werden soll“ und fragt uns, was wir denn zu dieser Überwindung beigetragen hätten. Antworten des 20. Jahrhunderts lauten z.B.: Superman und Cyborg („cybernetic organism“).
Und was wurde tatsächlich aus dem Übermenschen, zunächst bei Nietzsche? Dazu bemerkt Roger Behrens (2015), Nietzsche habe vor allem die christliche „Sklavenmoral“, die der Schwäche, „Mickrigkeit …, Unfähigkeit und Ohnmacht“ überwinden wollen; sodann aber: „Doch sein Übermensch bleibt im Korsett bürgerlicher Werte gefangen, die er umzuwerten antreten soll: Der Wille zur Macht gibt der Ethik nur eine andere Wendung, hebt sie aber nicht auf; dafür fehlt Nietzsches Kritik die Dialektik. Hinter Marx‘ realen Humanismus fällt Nietzsche damit zurück. Die Überwindung des Menschen durch den Übermenschen reißt ihn förmlich aus der Gesellschaft raus, statt die Gesellschaft menschlich und den Menschen gesellschaftlich zu machen. Das gibt der Deutung Raum, in Nietzsches Entwurf des Übermenschen bloß den – faschistischen – Herrenmenschen zu erkennen, die Inkorporation des Inhumanen.“49 Mit anderen Worten: Auch mit dem „Übermenschen“ gelingt Nietzsche keine neue Synthese von Individuum und Gesellschaft, im Gegenteil: Er bleibt be- und ge-fangen in seinem teils chaotischen, archaisch-antikisierendem Individualismus und fällt damit „hinter Marx‘ realen Humanismus … zurück“, wie R. Behrens es ausdrückt.
Und Superman? Eine US-„Action-Comics“-Sensation im Jahre 1938. Ein Held, der als Kino-Star überlebt, ohne dass sich aus seinen übermenschlichen Kräften (z.B. des Fliegen-Könnens) irgendein gesellschaftlicher Nutzen ziehen ließe. Im Happy End fliegen Superman und seine Geliebte verliebt durch die Luft, Lust siegt scheinbar über Realität, aber „nicht für die Gesellschaft …, sondern zum individuellen Nutzen“ (Behrens a.a.O. S. 3).
Und Cyborg? Roboter betreten 1939 die Bühne der New Yorker Weltausstellung. Prothesen scheinen beschädigten Menschen schier übermenschliche neue Kräfte zu verleihen, „kaschieren aber zugleich auch die zunehmende Fragmentierung des Körpers“. Und seit den 1990er Jahren finden Cyborgs Eingang „in Popdiskurse um Techno und >Afrofuturismus<“ (Behrens a.a.O. S. 4).
Ray Kurzweil betrachtet die Cyborgs bekanntlich als Vorstufen für die über-menschlichen bzw. nicht-mehr-menschlichen KI-Super-Roboter, die im Jahre 2045 an die Stelle von uns Menschen treten sollen (und dennoch „für uns“ den Weltraum erobern sollen; wozu ich Näheres und Weiteres andernorts ausgeführt habe.50 Für bemerkenswert halte ich auch den Hinweis, dass man im Silicon Valley angeblich eifrig Nietzsche studiert, insbesondere seinen Zarathustra.
Und als kaum überbietbar erscheint mir das Fazit, das Roger Behrens am Schluss seines Artikels (S. 5) zieht: „Ohnehin dient die übermenschliche Technik bloß der Verbesserung des Vorhandenen. Zwar wird mit Furore behauptet, die Grenzen der Welt zu überschreiten, doch kommt man über die Welt ordnung nicht hinaus; kein Übermensch, kein Superman, kein Cyborg kritisiert soziale Verhältnisse als Herrschaftsverhältnisse. Damit bleiben Cyborg-Visionen eindimensional: Es geht um die Perfektionierung besonderer Fähigkeiten zum Nutzen des Kapitals, nicht um allgemeine Vermögen als Fortschritt der Menschheit. Überhaupt fehlt vom Übermenschen bis zu den Cyborgs das revolutionäre Kollektive, die Solidarität echter Gemeinschaft, die Utopie befreiter Gesellschaft, mit der aus den Menschen Menschheit wird. – Schon Nietzsche löste den Handlungsraum des Übermenschen im Nihilismus auf, destruierte Geschichte als Wiederkunft des ewig Gleichen. Insofern sind Superhelden und Cyborgs auch keine historischen, revolutionären Subjekte. Sie haben kein Telos, kennen kein kommunistisch erkennbares Land am Horizont. Der Übermensch unter-bietet die konkrete Utopie.“
Womit auch Roger Behrens bestätigt, dass Nietzsche kein Linker, kein Sozialist war. Wie sollte demgegenüber irgendein „Links-Nietzscheanismus“ (mit oder ohne Gedankenstrich) Bestand haben?
Fazit
Auf die bedrohlich-dringlichen Probleme unserer Zeit finden sich in Nietzsches Werken keine bzw. keine zufriedenstellenden Antworten. Seine gesamte Philosophie bleibt hinter Marx‘ realem Humanismus zurück. Er war kein Linker, kein Sozialist. Ein „Links-Nietzsche-anismus“, mit Binde- oder Gedankenstrich, lässt sich ebenso wenig begründen wie ein „Rechts-Nietzscheanismus“. Denn Nietzsche war auch kein Rechter. Wer ihn für eine bestimmte politische Richtung vereinnahmt, tut ihm Unrecht. Andererseits bestätigt und verstärkt sein teils archaisches, antikisierendes Welt- und Menschenbild bestehendes Unrecht. Was auch einer der Gründe dafür sein dürfte, dass er sowohl die Demokratie als auch den Sozialismus so heftig und fanatisch ablehnt. Zumal in Marxens Reich der Freiheit der Sozialismus die Demokratie vervollkommnet und schließlich aufhebt, indem er jede Form der Herrschaft von Menschen über Menschen beseitigt. – Ein für Nietzsche unerträglicher Gedanke!
Und dies wäre ein zutiefst betrübliches Resultat, hätten wir nicht auch die Gewissheit, dass Nietzsches frenetische Lebensbejahung, sein großes Ja zum Leben, uns selbst vielleicht im Leben halten und überleben wird. Mit einem Kunstbegriff, in dem sich das Dionysische und das Apollinische zu stets fruchtbaren Synthesen vereinen, wobei im Leben selbst das Prinzip einer umfassenden Kreativität erkennbar wird, wenn auch nicht eines „Ur-Grunds“ der Welt, wie Nietzsche ihn für sein Konzept in Anspruch nimmt.
Posthumanistische Endzeit-Visionen: R. Kurzweil u.a.
Die rapide Entwicklung der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz (KI) hat den KI- und Zukunftsforscher Ray Kurzweil veranlasst, für das Jahr 2045 eine „Singularität“, den Anbruch eines neuen Weltzeitalters, zu prophezeien. Wobei schon die Wortwahl auffällt, wird doch der Begriff Singularität vor allem zur Charakterisierung des sogenannten „Urknalls“ verwendet. Im Zusammenhang mit KI bedeutet der Begriff aber so viel wie „die Entwicklung einer >Superintelligenz< durch den fortwährenden Gebrauch neuer Technologien“.51
Tatsächlich stellt Kurzweil einen totalen Bruch mit der bisherigen Menschheitsgeschichte – und sogar deren Abbruch – in Aussicht. Dabei stützt er sich auf die angeblich nicht linear, sondern exponentiell voranschreitende Entwicklung der Computer-Technologien. In immer kürzeren Abständen verdoppele sich das entsprechende Experten-Wissen, so dass spätestens im Jahre 2045 die Inhalte der menschlichen Gehirne ausnahmslos auf Roboter übertragbar sein würden, die auf Grund ihrer ins Unermessliche zu steigernden Intelligenz den Menschen nicht nur vollständig ersetzen, sondern auch eine ganz neue Ära in der Geschichte des Universums initiieren würden; es werde diesen Super-Wesen gelingen, den gesamten Weltraum zu erobern. „Es geht um die Entstehung eines Volkes von auserwählten Gott-Menschen, die in den Cyber-Himmel aufsteigen, wo sie als allmächtige und unsterbliche Götter leben, Universen erschaffen, sich mühelos durch Raum und Zeit bewegen und weder natürlichen noch ewigen Gesetzen unterworfen sind. Karma, Wiedergeburt, Sünde und Ethik gelten für diese Wesen nicht mehr, sie haben sich abgekoppelt.“52
Vorstufen schon jetzt: Immer mehr unzulängliche („fragile“) Körperteile von Menschen werden durch Prothesen ersetzt. Die Bioelektronik zielt langfristig darauf ab, Cyborgs herzustellen, halb-menschliche Wesen, die überwiegend aus technischen Implantaten bestehen und sich somit auf dem Weg vom „biologischen Menschen zum posthumanen Wesen“ Cyborg (Wikipedia-Artikel 2016, S. 3) befinden. Welche Gefahren dabei für die bisher noch mit unveräußerlichen Rechten ausgestattete menschliche Person entstehen, zeigt sich aktuell bereits an einer Erfindung, die jeder Geheimagent begrüßen dürfte: dem ‚Projekt Google Glass‘. „Glass-Träger können alles, was sie sehen, sofort auf Video aufnehmen – ohne dass die Gefilmten es merken.“53 Mit der besonders pikanten Pointe, dass sämtliche von ‚Glass‘ gesendeten oder empfangenen Dateien über den Server der Firma Google transportiert werden. Was langfristig nur bedeuten kann, dass die Freiheit der Person in einem System perfekter privatkapitalistischer Überwachung untergeht.
Nichtsdestoweniger hält Kurzweil, der inzwischen als Technischer Direktor bei Google gearbeitet hat, die Entwicklung zum Cyborg und schließlich zum perfekten KI-Roboter für unumkehrbar und sozusagen naturnotwendig. Er glaubt, man könne Geist und Bewusstsein, ja, sogar das Gefühlsleben und die Psyche des Menschen vollständig technisch kopieren und beliebig reproduzieren, zumal er überzeugt ist, eine Parallele zwischen der angeblich hierarchischen Struktur des Universums und derjenigen des menschlichen Gehirns entdeckt zu haben, wonach beide gemäß bestimmter „Informationsmuster“ organisiert seien. Die „300 Millionen Mustererkenner im menschlichen Neocortex ..., die der Erkennung der in der Welt enthaltenen Informationsmuster dienen“, könne man modellhaft nachbilden. Überdies fasst Kurzweil anscheinend „alle seine Überlegungen zum menschlichen Gehirn, künstlicher Intelligenz und der Möglichkeit ihrer Fusion im Konzept der Mustererkennungstheorie des Geistes zusammen“.54 Dem entsprechend werde es schon im Jahre 2029 „bewusste Maschinen“, Roboter mit menschlichem Bewusstsein, geben, denen es bis zum Jahr 2045 gelingen werde, die erwähnte KI-„Singularität“ zu bewerkstelligen. Sein Buch ‚The Singularity is Near‘ beendet Kurzweil mit optimistischen Hinweisen auf die angebliche Evolution des Menschen von einem biologischen zu einem rein technologischen Maschinen-Wesen und der kühnen Prophezeiung: „It will continue until the entire universe is at our fingertips.“55 Ein krasser Widerspruch, denn nicht wir Menschen, sondern die uns ersetzenden Maschinen-Wesen sollen doch das gesamte Universum erobern...
Transhumanismus geht über das bisherige Mensch-Sein hinaus; Posthumanismus setzt an beim „Ende der Menschheit“. Kurzweil vereinigt beide Richtungen in seinen Ideen, wobei er allerdings nicht nur gewichtige Fakten außer Acht lässt; es unterlaufen ihm auch mehrere Denkfehler. Die Fakten: Der menschliche Geist besteht nicht nur aus Mustererkennern in der Großhirnrinde. Vielmehr sind deren Funktionen untrennbar mit der Tätigkeit des gesamten Gehirns verbunden. Diese Tätigkeit – und mit ihr die gesamte neuronale Kombinatorik – ist jedoch weder gänzlich überschaubar noch vollständig erforscht noch mathematisch erfassbar.56 Es handelt sich um eine durchweg kreative, zu neuen Erkenntnissen befähigende Tätigkeit, die zwar auf Mustererkennung angewiesen ist, aber weit über diese hinausgeht.
Unerfüllt – und wahrscheinlich sogar dauernd unerfüllbar – bleibt folglich eine Grundvoraus-setzung für die technische Modellierbarkeit des menschlichen Gehirns. Was erst recht für den Geist, das Bewusstsein und die Psyche des Menschen gilt, weil diese sich als umfassendes Subjekt-Objekt-Geschehen manifestieren und sich keineswegs in der Gehirntätigkeit erschöpfen.
Außerdem übersieht Kurzweil die Tatsache, dass das Erkennen von Mustern nicht unmittelbar, sondern durch sprachliche und nicht-sprachliche Bedeutungen vermittelt geschieht, d.h. mittels semantischer, syntaktischer, assoziativer und gefühlsmäßiger Zuordnungen. Auch diese sind letztlich unüberschaubar, zumal sprachliche Bedeutungen nicht nur in Form von Denotationen (Grundbedeutungen) und Konnotationen (Neben-bedeutungen) auftreten, sondern auch in rein individuellen, subjektiven Assoziations-Bedeutungen, die für jegliche Phantasie, Kreativität und Entscheidungstätigkeit maßgeblich sind. Anders ausgedrückt: Kurzweils KI-Konzept ist nicht nur fehlerhaft, sondern auch nicht anwendbar. Geist, Bewusstsein und Psyche des Menschen, stets eng verbunden mit seiner Gefühlswelt, sind technisch weder modellierbar noch reproduzierbar.
Würden die transhumanistischen Anmaßungen Realität, wäre uns Menschen der Zugang zu einem möglichen Reich der Freiheit für immer verwehrt. Die Menschheit müsste abdanken, sich selbst aufgeben, und zwar auch dann, wenn, wie es dem ebenfalls transhumanistisch eingestellten Hans Moravec vorschwebt, lediglich Roboter als superintelligente Arbeits-sklaven hergestellt würden; denn auch diese könnten ja eines Tages ihre Superintelligenz zur Vernichtung der Menschheit einsetzen.
Um solch fatalen Entwicklungen vorzubeugen, sind wahrscheinlich schon jetzt gesetz-geberische Gegenmaßnahmen erforderlich. Langfristig wird, wie ich meine, eine gesamt-gesellschaftliche Kontrolle über die Schlüsselindustrien (natürlich einschließlich der IT-Branche) unumgänglich sein. Indiskutabel ist dagegen jeder Versuch, den Menschen zur Selbstaufgabe zu zwingen. Wer den Menschen abschaffen will, beraubt sich selbst seiner Menschenwürde. Personalität geht in dem Maße verloren, wie man die aus Geist, Psyche und Körper-Materie bestehende Einheit des Menschen zerstört, um sie schließlich auf technisch manipulierte anorganische Materie zu reduzieren. Jeder derartige Versuch verschärft die vorherrschende Konkurrenz-Situation, in der die Menschen dieser Erde sich befinden.
Je mehr Zulauf der Transhumanismus gewinnt, desto alarmierender wird die Lage. Daher zitiere ich die folgende
>Transhumanismus Kritik:
"Den Menschen zu verbessern" ist ein uralter Menschheitstraum. Die "Schaffung des neuen Menschen" führte in der Geschichte immer wieder zu Katastrophen und auch nach Auschwitz. Mit Hilfe von Technikoptimismus, libertärem und neoliberalem Denken, Gentechnik, Nanotechnologie, Eugenik und Computern den „alten Menschen“ abschaffen und einen „neuen Menschen“ schaffen. Mit Gehirnimplantaten und Gendoping soll der Mensch "optimiert" werden. Das Klonen von menschlichen Embryonen und die Möglichkeit, aus geklonten Embryonen Stammzellen zu gewinnen, bringt die Transhumanisten ihrem gefährlichen Traum vom ewigen Leben einen großen Schritt näher. Immer mehr Menschen verstehen sich selbst als Teil der transhumanistischen Bewegung, die den Menschen von seinen biologischen Schranken befreien will. Der Transhumanismus wird zunehmend zur neuen, gefährlichen Weltreligion der Umweltzerstörung und des Neoliberalismus. Die Umweltbewegung sollte sich stärker mit dieser zutiefst inhumanen Ideologie auseinandersetzen.
(Axel Mayer, BUND-Geschäftsführer, Vizepräsident TRAS und Kreisrat, in: www.bund-rvso.de/transhumanismus.html)
Jedenfalls werden die Menschen sich ihr Streben nach Glück, besserem Leben und dem Reich der Freiheit nicht von Trans- und Posthumanisten vergällen lassen.57
„Künstliche Intelligenz wird den Menschen auslöschen“ 58
Laut einer 2022 im ‚AI Magazine‘ erschienenen Studie Oxforder Forscher werden KI-Programme eines Tages fähig sein, ihre Programmierer auszutricksen, und zwar auf Grund von Belohnungssystemen, die von den Programmierern selbst entwickelt werden:
„Wenn verschiedene Modelle unterschiedliche Belohnungen vorhersagen, identifizieren diese Modelle verschiedene Merkmale der Welt, die die Belohnung bestimmen könnten.“59
Darüber hinaus könnte es dann den KI-Programmen gelingen, die Gründe für die Belohnungen herauszufinden, und demgenäß „falsche Ergebnisse ausgeben, um ihre Belohnung zu maximieren“ (ebd.). – Denkbar sei auch, dass ähnliche Ziele dadurch erreicht werden, dass die KI „unbemerkte und unüberwachte Helfer“ installiert, und zwar z.B. in Form von Robotern, die den Menschen ersetzen, d.h. dessen Kontroll-Fähigkeiten zerstören würden, was ein „existenzielles Risiko“ für uns Menschen bedeuten würde. Unvermeidlich werde es auch zu einem Wettbewerb um Ressourcen kommen, den der Mensch gegen „eine sehr trickreiche KI“ nicht gewinnen könne. (Dass dieser Wettbewerb möglicherweise auch im Weltraum ausgetragen würde, wird in dieser Studie anscheinend nicht erwähnt.)
Trotzdem immer weiter mit KI? Das Für und Wider
Wachsende Bedeutung der KI in Wirtschaft und Gesellschaft
Bei aller Kritik darf die zunehmende Bedeutung der KI für Wirtschaft und Gesellschaft nicht unterschätzt werden. Dies gilt zumal für die Zeit nach 2010, als es immer besser gelang, riesige Datenmengen und nie dagewesene, enorme Rechenpower miteinander zu verbinden. Befragte Unternehmer*innen profitierten 2021 angeblich zu 86 % vom Einsatz von KI, während 25 % sich von einer erweiterten KI-Verwendung beträchtliche Umsatzsteigerungen erwarteten.60 Diese positive Haltung wird auch auf Erfahrungen mit der Corona-Pandemie zurückgeführt. Außerdem erwartet man neue Impulse durch das Programm ‚Machine Learning Operations‘. Und man erhofft sich von der KI sogar Fortschritte bei der Über-windung des Fachkräftemangels, zumal durch KI bis 2035 mit einem Anstieg der Arbeits-produktivität um mehr als 30 % zu rechnen sei (ebd.). Außerdem wird behauptet:
„Künstliche Intelligenz ermöglicht die Entwicklung einer neuen Generation von Produkten und Dienstleistungen, auch in Sektoren, in denen europäische Unternehmen bereits eine starke Position innehaben: grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, Maschinenbau, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Mode, Tourismus. KI kann Vertriebswege optimieren, Wartungstechniken verbessern, die Produktionsleistung und -qualität steigern, den Kundenservice verbessern und dazu beitragen, Energie zu sparen.“ (a.a.O. S. 3)
Auch die Nachhaltigkeit der Produkte könne erheblich gesteigert werden.
Im Öffentlichen Dienst könne KI zur Kostensenkung beitragen und „neue Möglichkeiten in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Bildung, Energie und Abfallwirtschaft eröffnen“ (ebd.).
Die Gesundheitsvorsorge und -pflege könne erheblich verbessert werden; ebenso die Sicherheit aller Verkehrsmittel und der Zugang zu den Bildungs-Informationen. – Wobei m.E. an Schulen und Hochschulen insbesondere durch den Einsatz von KI-Programmen wie ChatGPT und anderen erhebliche Probleme entstehen. Während man solche Programme an einigen US-Schulen bereits verboten hat, plädieren deutsche Professorinnen und Professoren für „offenen Umgang mit KI“, so z.B. Prof. Dr. Doris Weßler in Stellungnahmen u.a. auf youtube.com. Meine Frage: Wie sollen Studierende, Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, die fiktionalen, oft fehlerhaften KI-Erzeugnisse von ChatGPT zu überprüfen, zumal die darin verarbeiteten Datenmengen völlig unüberschaubar sind und durchweg keine Quellenangaben enthalten?
Ebenso beunruhigend wirkt bei alledem die Ankündigung von Microsoft, weitere 10 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung neuer KI-Programme zu investieren, nachdem ausgerechnet Microsoft kurz zuvor neue „Ethik-Grundsätze für die KI“ verkündet hatte (s.o.).
Wobei jedoch nicht zu verkennen ist, dass Microsoft u.a. mit dem KI-Chat-Programm ‚Microsoft-Copilot‘ neuerdings ein echter Durchbruch gelungen ist, der nahezu überall von Bedeutung ist. So auch in Philosophie und Wissenschaft, ermöglicht doch dieses Chat-Programm sogar eine neue Lösung des Induktions-Problems. Wenn es darauf ankommt, aus der Wirklichkeit selbst legitime Schlüsse zu ziehen (s.o. S. 12 ff.), benötigt man hierfür Gewissheit über die (vorläufige) Gültigkeit des eigenen Wissens und der eigenen theoretischen Annahmen, z.B. auch bei Beobachtungen und Experimenten aller Art. ‚Microsoft-Copilot‘ stellt dieses Wissen erstmals der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung – neben umfassendem Experten-Wissen, das auch für die politische Alltagspraxis unmittelbar relevant ist und z.B. auch zur Begründung neuer theoretischer Synthesen aus direkter und repräsentativer Demokratie dienen kann. – Darin übertroffen wird Microsoft-Copilot vielleicht durch die KI-Suchmaschine ‚Perplexity AI‘, und zwar durch deren bessere Quellenangaben.
Probleme mit KI im Alltagsleben
Warnungen und Vorbehalte gegenüber der KI haben (2023) Celeste Kidd und Abeba Birhane, Forscherinnen der Berkeley-University of California, geäußert. Unüberschaubare Folgen könnten durch Formen der „subtilen Beeinflussung durch die generativen KI-Systeme“ entstehen, und zwar durch die Verbreitung von Falschinformationen und Vorurteilen, wie sie bei tagtäglich im Netz verwendeten KI-Systemen wie ChatGPT, BARD u.a. zu beklagen sei.61 In sich wirkten die KI-erzeugten Informationen durchaus schlüssig und überzeugend, aber:
„Dank der künstlichen Intelligenzen ist es verführerisch leicht, sich Texte oder Bilder erzeugen zu lassen oder eine gut formulierte und auf den ersten Blick überzeugende Antwort auf eine komplexe Frage zu erhalten. Auch wenn inzwischen bekannt ist, dass diese Antworten inhaltlich verzerrt, von Vorurteilen geleitet und sogar schlicht falsch sein können, scheint dies dem Erfolg der KI-Systeme keinen Abbruch zu tun.“ (a.a.O. S. 2)
Weitere negative Faktoren sind zu beachten. Anders als Menschen verfügen KI-Systeme nicht über die Kategorie der Ungewissheit bzw. der Halbwahrheit. Dadurch erzeugen sie bei ihrer Klientel den – teilweise unbewussten – Eindruck von absoluter Sicherheit und Kompetenz:
„Als Folge neigen wir unbewusst dazu, die von der KI erzeugten Inhalte für bare Münze und als verlässlich anzusehen – die in den Antworten oder Bildern versteckten Verzerrungen, Vorurteile oder Fehlinformationen inklusive.“ (ebd.)
Verstärkt werden diese Gefahren durch die beim Menschen anscheinend unausrottbare, tief sitzende Neigung, auch Unbelebtes – und somit auch KI-Systeme – zu vermenschlichen, ihnen „absichtsvolles und einsichtiges Verhalten“ zuzuschreiben (a.a.O. S. 3).
Gravierend kommt ein dritter Faktor hinzu: die unüberschaubare Vielzahl der – möglicherweise fehlerhaften – KI-Informationen. In immer mehr Geräte werden KI-Systeme integriert, wodurch die Gefahr einer sich selbst organisierenden und verstärkenden „Rück-kopplungsschleife“ entsteht:
„Weil die KI-Systeme immer mehr Inhalte generieren, finden ihre Produkte auch zunehmend Eingang in die Trainingsdaten folgender KI-Modelle. >Dies verstärkt die Wirkung systemischer Verzerrungen und setzt sie in die Zukunft hinein fort<, so das Team.“ (ebd.)
Mit unabsehbaren Folgen vor allem dann, wenn unsichere und unwissende Personen mit dieser KI-Informationsflut konfrontiert werden. Denn solche Personen sind zumeist nicht in der Lage, sich gegen die oft nachhaltigen Fehlinformationen zu wehren. Daher plädieren die beiden Forscherinnen nicht nur für mehr Aufklärung über diese Gefahren, sondern auch dafür, diese Gefahren bei der Erforschung und der „Regulierung“ der neuen KI-Technologien zu berücksichtigen (ebd.).
KI und Anthropozän/Kapitalozän: Bewältigung sowohl der Öko-Krise als auch der Sozialen Frage?
Laut Wikipedia ist ‚Anthropozän‘ ein „Kofferwort“, zusammengesetzt aus den altgriechi-schen Bezeichnungen für ‚Mensch‘ und ‚neu‘. Den Begriff erstmals vorgeschlagen hat der Naturwissenschaftler Paul Cruxen im Jahr 2000. Bezeichnet werden soll die Tatsache, dass der Mensch seit dem 18. Jahrhundert mehr als derjenige hervorgetreten ist, der die weltweite Öko-Krise verursacht und zu verantworten hat. – Allgemein ist der Begriff jedoch nicht anerkannt worden. Dazu heißt es bei Wikipedia:
„In der geisteswissenschaftlichen Literatur ist das Konzept auf Kritik gestoßen. Das Anthropozän würde die Rolle des Menschen als aus der Natur herausgehobener Art betonen und gerade keine Alternative zur ungehemmten Umgestaltung der Erde durch den Menschen vermitteln. Im Gegenteil würden die bisherigen Eingriffe des Menschen in Naturkreisläufe zum Anlass oder als Rechtfertigung gebraucht, um – diesmal mit dem Anspruch der Reparatur – erneut, gezielt und mit größeren Zielen ökologische Steuerungsmechanismen zu beeinflussen. Vorschläge des Geoengi-neerings würden den Menschen endgültig zum Herrscher der Erde machen, auch wenn sie unter dem Aspekt der Verantwortung für frühere Eingriffe und die weitere Entwicklung kommuniziert würden.[…] Stattdessen wäre eine (Re-)Integration des Menschen in die natürliche Umwelt erforderlich, die gerade nicht mit einer heraus-gehobenen Stellung vereinbar sei.
In seiner Kritik an der Idee des Anthropozäns weist Jürgen Manemann darauf hin, dass dieses Konzept in einem Zivilisationsmodell gründe, das vom Machbarkeits- und Perfektibilitätswahn geprägt sei. Dies zeige sich nicht zuletzt an der inneren Dimension der Idee des Anthropozäns, die auf einen Trans- oder Posthumanismus ziele. Statt mehr Technik und mehr Wissen sei es nötig einen Kulturwandel einzuleiten. Dazu müsste die Zivilgesellschaft in eine Kulturgesellschaft transformiert werden. Das Gegenkonzept zur Idee des Anthropozäns sei eine neue Humanökologie, die Wege zur kulturellen Erneuerung der Menschen aufweise und gleichzeitig daran mitwirke, kreativ neue Strukturen zu entwickeln, die helfen, Grundfähigkeiten zu entwickeln, die es Menschen ermöglichen, angesichts der Klimakatastrophe ein humanes Leben zu führen.“
Statt ‚Anthropozän‘ wurde inzwischen der Begriff ‚Kapitalozän‘ vorgeschlagen, um zum Ausdruck zu bringen, dass nicht einfach „der Mensch“, sondern die Dauerkrise des Kapita-lismus (Marx) – bis hin zum globalisierten Neoliberalismus – die Öko-Krise verursacht hat. Dazu schreibt Jason W. Moore:
„Wir leben im Zeitalter der kapitalogenen Klimakrise, kapitalogen im Sinne von »vom Kapital gemacht«. Wie das verwandte Kapitalozän mag es zunächst etwas plump klingen. Das hat jedoch wenig mit dem Wort zu tun – das System bürgerlicher Herrschaft hat uns gelehrt, den Begriffen zu misstrauen, die das System der Unter-drückung beim Namen nennen. Doch genau das ist seit jeher die Praxis emanzipatorischer Bewegungen. Sie schöpfen ihre Kraft aus neuen Ideen und einer neuen Art des Sprechens über die Dinge. Das verleiht Macht und intellektuelle sowie strategische Orientierung. In dieser Hinsicht war der Mainstream-Ökologismus, der ab 1968 einsetzte – die »Umweltbewegung der Reichen« (Peter Dauvergne), ein Desaster. Der Fokus auf den »ökologischen Fußabdruck« lenkte die Aufmerksamkeit auf den individuellen Konsum. Der Begriff Anthropozän legt nahe, die planetarische Krise sei eine natürliche Folge der menschlichen Natur – als rührte sie daher, dass Menschen halt handeln wie Menschen, so wie Schlangen Schlangen sind und Zebras Zebras. Die Wahrheit ist offensichtlich nuancierter: Wir leben im Kapitalozän, im Zeitalter des Kapitals. Wir wissen ziemlich genau, wer für die heutigen und vergange-nen Krisen verantwortlich ist. Die Verursacher*innen haben Namen und Adressen, angefangen bei den acht reichsten Männern der Welt, die mehr Vermögen besitzen als die ärmsten 3,6 Milliarden der Weltbevölkerung.“62
Zu der Frage nun, ob Künstliche Intelligenz in der Lage ist, die Probleme des Anthropo-zäns/Kapitalozäns zu lösen, heißt es bei ‚Microsoft-Copilot‘:
„Die Probleme des Anthropozäns, einer Ära, in der menschliche Aktivitäten die dominierende Kraft für Umweltveränderungen sind, sind komplex und vielfältig. KI bietet jedoch vielversprechende Werkzeuge und Lösungen, um einige dieser Herausforderungen anzugehen:
1. Umweltüberwachung und Datenanalyse
KI kann große Datenmengen analysieren, um Umweltveränderungen zu überwachen und vorherzusagen. Dies umfasst Klimamodelle, Wettervorhersagen und die Überwachung von Ökosystemen. Solche Analysen können dabei helfen, fundierte Entscheidungen zum Umweltschutz zu treffen.
2. Nachhaltige Landwirtschaft
KI-gesteuerte Technologien können die Präzisionslandwirtschaft verbessern, indem sie den Einsatz von Wasser, Düngemitteln und Pestiziden optimieren. Dadurch wird die Effizienz erhöht und die Umweltauswirkungen der Landwirtschaft reduziert.
3. Energieeffizienz
KI kann zur Optimierung des Energieverbrauchs in verschiedenen Sektoren beitragen, von der Industrie bis hin zu Haushalten. Durch die Analyse von Nutzungsdaten können Energieversorger die Nachfrage besser vorhersagen und den Energieverbrauch reduzieren.
4. Kreislaufwirtschaft
KI kann Prozesse zur Wiederverwendung und zum Recycling von Materialien verbessern, wodurch die Abfallmenge reduziert und Ressourcen effizienter genutzt werden. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer Kreislaufwirtschaft.
5. Naturschutz und Artenvielfalt
KI-Technologien wie Bildverarbeitung und Drohnentechnologie können zur Überwachung und zum Schutz bedrohter Tierarten und ihrer Lebensräume eingesetzt werden. Dies hilft, die Artenvielfalt zu erhalten und Ökosysteme zu schützen.
Herausforderungen und Ethik
Trotz der vielversprechenden Ansätze müssen ethische und soziale Fragen berücksichtigt werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass KI-Technologien fair und transparent eingesetzt werden und dass sie nicht unbeabsichtigte negative Auswirkungen haben.
KI allein wird die Probleme des Anthropozäns nicht vollständig lösen können, aber sie kann ein mächtiges Werkzeug sein, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Der Schlüssel liegt in der verantwortungsvollen Nutzung und der Integration von KI in umfassende Strategien für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit.“
Letzteres ist jedoch zu bezweifeln. Der Kapitalismus hat nicht nur die Öko-Krise, sondern auch die – bislang ebenfalls ungelöste – Soziale Frage verursacht. Beide Probleme parallel oder zusammen zu lösen, scheint im Kapitalismus unmöglich zu sein. Hauptgrund: Mehr als umfassende Information – zweifellos eine großartige Errungenschaft! – kann KI nicht anbie-ten. Um durchgreifende Veränderungen herbeizuführen, bedarf es sowohl einer Verände-rungs-Ethik (Ernst Bloch) als auch umfassender Systemkritik und -veränderung. Genauer:
Auf die aktuell akuten Bedrohungen – Öko-Krise, Digitalisierung, Trans- und Post-humanismus, Künstliche Intelligenz – ergänzbar durch den Nuklearen Holocaust, – sind mit meiner Erweiterten Öko-Ethik 63 Antworten möglich, erst recht, wenn sie durch historische und aktuelle Werte-Synthesen gestützt werden können. Nicht jedoch auf die Bedrohung durch den aktuellen globalisierten Turbo-Kapitalismus – und auch nicht auf die Frage, wie die „Antworten“, z.B. in Form meiner legitimen Forderung, denn in die Tat umgesetzt werden können, so dass sie gesellschaftsverbessernd wirken. Was leider auch dann nicht möglich ist, wenn sich veranschaulichen lässt, wie aus Werten Normen, d.h. verinnerlichte, verbindliche Verhaltensregeln bzw. „Maximen“ werden. Dies gilt wahrscheinlich für jede Art der Umwandlung von Werten in Normen, so a) bei angeborenen Werten, die der ursprünglichen Selbsterhaltung und Erstorientierung dienen; b) bei der Normierung von Werten durch Erziehung und Sozialisation, die auf Grund unterschiedlicher gesellschaftlicher und kultureller Rahmenbedingungen stattfinden; c) durch politische und sonstige Gesetzgebung. Die unter a) genannten Faktoren sind anscheinend kaum beeinflussbar, während bei b) und c) das „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ zum Tragen kommt. Darunter im turbo-kapitalistischen Westen die Macht der manipulativen Fakten: Arbeitgeber-Interessen, „Spaß“-Ideologie, analytisch-positivistisches Denken u.a.m. Wogegen ethische Grundsätze einen sehr schweren Stand bzw. häufig gar keine Chancen auf Verwirklichung haben. Wo Erkenntnisse auf Interessen prallen, blamieren sich meistens die Erkenntnisse, wie Marx feststellte. Legitime ethische Forderungen, z.B. nach Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität, durchzusetzen, stößt in einer Klassen-Gesellschaft („mit Herr und Knecht“) nicht selten auf unüberwindliche Hindernisse, verursacht z.B. durch digitale Überwachung, kapitalistische Herrschafts-Ideologie, Lobbyismus, Stigmatisierung und Verfolgung Andersdenkender, Gewaltmaßnahmen (z.B. Entlassungen in Krisen-Zeiten) u.a.m.
Sich hiergegen aufzulehnen, ist mit Ethik und Moral allein nicht möglich. Dazu bedarf es vielmehr politischer Gegenwehr mit langem Atem, zumal dann, wenn weder ein „revolutionäres Subjekt“ noch ein entsprechendes Klassen-Bewusstsein vorhanden ist. Dennoch brauchen die ethischen Forderungen davor nicht zu kapitulieren. Vielmehr sind sie in die antikapitalistische Veränderungsethik aufzunehmen, wie sie Ernst Bloch konzipiert hat. Eine solche Ethik kann und muss auch den reformerischen bis revolutionären Kampf stützen, getreu der Marxschen Devise, dass die Philosophie sich nicht verwirklichen kann, ohne sich „aufzuheben“ – dies wohl auch im Hegelschen Sinne des Begriffs „Aufhebung“: Die Philosophie soll nicht mehr nur in den Köpfen stattfinden, sondern die gesamte Realität beeinflussen und durchwirken. Philosophie ist dann nicht mehr, was sie traditionell-idealistisch war, sondern gewinnt neue Qualitäten als effektiver Teil der Wirklichkeit selbst.
Dem entspricht jedenfalls mein Modell eines Demokratischen Ökosozialismus, das ich schon mehrfach (insbesondere o.J. (2021), aber auch schon 2015, 2017 und 2020 im GRIN-Verlag München) veröffentlicht habe. Es geht darin vor allem um allgemeine kulturelle und politi-sche Emanzipation, neue, sozialistische Formen einer digital gestützten Wirtschaftsplanung, direkte Demokratie, Marktsozialismus und Wirtschaftsdemokratie.
Wenn nun anzunehmen ist, dass sowohl die Soziale Frage als auch auch die Öko-Krise durch Formen eines Demokratischen Ökosozialismus zumindest in den Griff zu bekommen sind, können Überlegungen über weitergehende gesamtgesellschaftliche Ziele angestellt werden. Wenn z.B. Direkte Demokratie ermöglicht werden soll, müssen a) die Menschen sich ihrer Lebensgrundlagen sicher sein können und b) die krassen sozialen bzw. finanziellen Ungleich-heiten beseitigt oder auf ein Minimum reduziert werden. (Denkbar wäre es allerdings auch, finanziell schwache Initiatoren von Volksabstimmungen regierungsamtlich zu subventio-nieren. Vgl. Robra 2024a), S. 170 f.)
Reicht „mehr Besonnenheit im Umgang mit KI“?
Der Philosoph Nicolas Dierks plädiert (2023) für mehr Gelassenheit und Besonnenheit im Hinblick auf die KI. Man solle versuchen, diese in den Dienst des Menschen zu stellen, und zwar gestützt durch wirksame ethische Grundsätze. (Vgl. Robra o.J. (2020) Besonnenheit allein reicht also offenbar nicht! Wie aber sollen die ethischen Grundsätze beschaffen sein, wenn man selbstgenerierende KI-Systeme gar nicht kontrollieren kann oder will? Zumal die Rechtslage noch unklar zu sein scheint. Auch hier empfiehlt Dierks stoischen Gleichmut. Bewusstsein könne bisher keinem KI-System zugeschrieben werden.
Dennoch stellt sich z.B. bei ChatGPT und anderen die Frage, wie deren Mängel (Fake-Erzeugnisse usw.) gehändelt werden können, zumal sie auf immer mehr Gebieten – wie Journalismus, Werbung, Fachwissenschaft u.a.m. – zum Einsatz kommen. Aber: Vor der angeblichen „Allmacht“ der KI-Konzerne brauche niemand zu kapitulieren. Dagegen wirkten bereits jetzt auch die neuen, vorbildlichen EU-Regulierungen ‚Digital Market Act‘ und ‚Digital Services Act‘, während ein neuer, spezieller ‚AI-Act‘ gegenwärtig vorbereitet werde. Dierks‘ Fazit: Nur keine Panik, sondern Gelassenheit! Mit anderen Worten:
„Erinnern wir uns also an die erste Tugend der stoischen Philosophie: Gelassenheit. Keine Panik und keine Verzweiflung. Wir sollten uns nicht an die Hoffnung klammern, dass alles bleibt, wie es ist, und dann bestürzt reagieren, wenn dem nicht so ist.
Stattdessen sollten wir damit rechnen, dass weiterer Wandel bevorsteht. Schließlich wird die Entwicklung dynamisch weitergehen. Begegnen wir dem nächsten technologischen Sprung also ruhig und besonnen.“64
Was aber weder zu Resignation noch zu Passivität verleiten dürfe. Jede/r könne selbst bestimmen, welcher Umgang mit KI-Systemen zu pflegen sei.
Kritische Würdigung und Fazit
In dem Wikipedia-Artikel Gesetz über künstliche Intelligenz 65 findet sich eine Diskussion des EU-AI-Acts, die mutatis mutandis teilweise auch auf die USA und China bezogen werden kann. Darin heißt es:
„Die weitgehenden Definitionen, Verbote und komplizierten Compliance-Vorschriften im ursprünglichen Vorschlag lösten Kritik der Industrieverbände (u. a. Bitkom und KI-Verband) aus. Der Kompromissentwurf des Rates wurde dahingehend in einigen Punkten abgeschwächt. Außerdem wird eine große Rechtsunsicherheit, der hohe bürokratische Aufwand und Doppelregulierung, z. B. im Medizinbereich kritisiert. Auch sei die geforderte fehlerfreie Auswahl von Trainingsdaten nahezu unmöglich.
Auch die Bundesregierung warnt vor Überregulierung. Nach einer Studie würde die Verordnung zu einem hohen Aufwand bei einem großen Teil der KI-Anwendungen führen.
Auf der anderen Seite kritisieren Bürgerrechtler (u. a. EDRi, AlgorithmWatch und DGB) den Entwurf als nicht weit genug, Definitionen seien zu eng gefasst und die Regelungen böten Schlupflöcher, so sollen die Vorschriften z. B. für militärische Zwecke nicht und für die Strafverfolgung nur teilweise gelten. Außerdem wurden einige erhoffte Regulierungen wie das Verbot von Predictive Policing und bio-metrischer Überwachung nicht mit aufgenommen. Die Entwürfe des EU-Parlaments gehen stärker auf diese Positionen ein. Gemäß der Version vom 11. Mai soll den Staaten die retrograde Videoüberwachung und damit die biometrische Massen-überwachung ermöglicht werden. Dass die Bundesregierung sich im Rahmen der Verhandlungen explizit für die retrograde Videoüberwachung aussprach, obwohl sie im Koalitionsvertrag noch ihre Ablehnung kundtat, sorgte für Kritik u. a. von netzpolitik.org.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Verordnung keine Möglichkeiten zur individuellen Rechtsdurchsetzung (wie Schadensersatzansprüche) schafft.“ (a.a.O. S. 2 f.)
Erschwert wird dies durch das Fehlen eines allgemeinen, internationalen KI-Rechts. Umso mehr empfiehlt es sich, aus dem Vorliegenden die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Natürlich gibt es weltweit neben den besprochenen Gesetzes-Vorlagen der EU, der USA und Chinas weitere, ähnliche Projekte. Wahrscheinlich aber nicht mit höherer inhaltlicher Relevanz. An den drei Gesetzesvorlagen fällt auf, dass sie die Probleme der schwachen KI nur ansatzweise, die der starken kaum oder gar nicht behandeln. Weder der US-amerikanische Nietzsche-Kult und -Hype noch R. Kurzweils „Singularitäts“-Phantastereien noch die monströse „Symbiose“ von Mensch und Technik werden analysiert. Die Gefahr einer Selbstauslöschung der Menschheit durch KI wird ignoriert.
Gravierend kommt hinzu, dass bisher anscheinend in keinem einzigen Gesetzes-Vorhaben die Tatsache erwähnt wird, dass die KI-„Singularität“ das Ende aller Bemühungen um sinnvolle Alternativen zum Bestehenden, d.h. zum globalisierten Neo-Liberalismus, bedeuten würde. An die Stelle eines Reichs der Freiheit würde eine hochexplosive, nicht funktionstüchtige „Symbiose“ von Menschen und Robotern treten.
Um die negativen Auswirkungen der schwachen und starken (generativen) KI wirksam zu bekämpfen, werden nationale Gesetze nicht ausreichen. Vielmehr bedarf es verbindlicher, internationaler Vereinbarungen, z.B. auf UN-Ebene. Dies hat auch Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, bereits erkannt. Angesichts der existenziellen Bedrohung der Mensch-heit durch KI kritisierte er die Macht von Großunternehmen und -Staaten, von denen die Menschenrechte missachtet werden. In einem Positionspapier der UNO stellte er Vorschläge zum weltweiten Umgang mit KI vor und kündigte die Einrichtung entsprechender hochrangiger Beratergremien und die Gründung einer UN - Regulierungsbehörde an.66
Kaum einen Monat später nahm der UNO-Menschenrechtsrat in Genf eine Resolution an, in der Schutz- und Kontrollmaßnahmen zur KI beschlossen wurden. Die Transparenz entsprechender Systeme soll gefördert werden, speziell zur Verwendung der für die KI-Technologie benutzten Daten, die „auf menschenrechtskonforme Weise gesammelt, verwendet, weitergegeben, archiviert und gelöscht werden“ sollen. Die Resolution wurde im Juli 2023 einvernehmlich angenommen.67
Europäische Charta der Grundrechte, KI und die Zukunft der Menschheit
Um ein einheitliches, internationales KI-Recht zu entwickeln, müssen die Menschenrechte gegenüber der KI geschützt werden. Möglichkeiten hierfür ergeben sich u.a. aus der europä-ischen Charta der Grundrechte (seit 2012).68 Darin geht es um Grundrechte, die sich in sechs Kategorien aufteilen lassen, und zwar in: Würde, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Bürger-rechte und Justizielle Rechte.
1. In Bezug auf die Menschenwürde kann sich KI sowohl positiv als auch negativ auswirken. Positiv z.B. in der Gesundheitsfürsorge, negativ vor allem durch den Holocaust der „Singularität“. Da die Würde des Menschen unantastbar ist, kann sie nicht zu Gunsten von KI-Robotern aufgegeben werden.
2. Die Freiheit der Person, incl. Gedanken-, Meinungs-, Glaubens- und Pressefreiheit und der anderen Grundrechte – und wohl auch des Rechts auf Arbeit und Bildung –, wird schon durch die schwache KI massiv gefährdet (Diskriminierung etc., s.o.).
3. Gleichheit. Auch hier kann sich schon die schwache KI negativ auswirken. Wenn man, wie in den USA geschehen, fehlerhafte KI gegen Menschen afroamerikanischer Herkunft einsetzt, führt dies zu massivem Rechtsbruch.
4. Solidarität. Droht Arbeitslosigkeit durch KI, muss dem frühzeitig Einhalt geboten werden. Soziale Sicherheit, akzeptable Arbeitsbedingungen und Umweltschutz können durch KI vielleicht gefördert, aber nicht durch sie allein erreicht werden.
5. Bürgerrechte. Auch hier sind sowohl positive als auch negative Folgen des KI-Einsatzes zu erwarten. KI kann Verwaltungsvorgänge vereinfachen, aber auch durch Fehlinformationen z.B. Wahlen verfälschen.
6. Justizielle Rechte. „Die Charta besagt, dass jede/r das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf, das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf Verteidigung hat (Artikel 47-50). In der Justiz verwendete KI könnte Bedenken in Bezug auf das Recht auf ein faires Verfahren hervorrufen (z.B. wenn derartige Systeme Verzerrungen enthalten).“ (a.a.O. S. 4)
Gesichtserkennungstechnologie darf angeblich unter bestimmten Auflagen zu Justizzwecken verwendet werden, keinesfalls jedoch wie in China zur generellen Überwachung der Bevölkerung. Gegen Letzteres müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden, z.B. durch die Einbeziehung von Datenschutzbeauftragten.
Diese Grundrechte in einem verbindlichen internationalen KI-Abkommen zu verankern, scheint ausgeschlossen, solange Großmächte wie die USA und China darauf bedacht sind, eine politische und ökonomische Vormachtstellung in der Welt zu behaupten oder neu zu erringen. – Oft scheint den Beteiligten nicht klar zu sein, was auf dem Spiel steht: das Schicksal der Menschheit, einschließlich eines möglichen Reichs der Freiheit, zu dem auch eine sinnvoll gehandhabte KI beitragen könnte. Dieses Reich ist eine Konkrete Utopie, die zu den edelsten Ambitionen und stärksten Hoffnungen der Menschheit gehört.69 – Inwieweit hierzu auch mein mehrfach (2017, 2018, 2021 im GRIN-Verlag) vorgetragenes Modell eines Demokratischen Öko-Sozialismus beiträgt, bleibt wohl abzuwarten. Dies auch im Sinne des belorussischen Philosophen Evgeny Morozov, der (2024) im Schlussteil seines Aufsatzes über Eine andere KI ist möglich erklärt:
„Das zentrale Ziel einer solchen solidarischen Post-KI-Technologie müsste sein, allen Menschen unabhängig von Klasse, ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlecht Zugang zu den Institutionen, Infrastrukturen und Technologien zu verschaffen, die ihre krea-tive Autonomie fördern und ihre individuellen Potenziale voll zur Entfaltung bringen. Mit anderen Worten: Wir müssen den großen Fortschritt von Human Augmentation zu Human Enhancement, von der Erweiterung zur Bereicherung der menschlichen Fähig-keiten hinbekommen.
Eine solche Strategie sollte auf den Komponenten des Sozialstaats aufbauen, die am weitesten von den konservativen Imperativen der kapitalistischen Ordnung entfernt sind: Bildung und Kultur, Bibliotheken, Hochschulen und öffentlich-rechtliche Medien. Eine Post-KI-Technologie würde nach dieser Vision eine sozialistische Bil-dungs und Kulturpolitik unterstützen, statt das neoliberale Wirtschaftsmodell zu stabi-lisieren.“70
Leider erwähnt Morozov nicht den Macht- und Konkurrenzkampf zwischen den USA und China hinsichtlich der aktuellen KI (s.o.). Dieser Machtkampf scheint jegliche Alternative, jegliche „andere KI“, die „möglich“ wäre, auszuschließen – mit kaum absehbaren Folgen für die Weltpolitik.
Literaturhinweise
Bauer, Joachim 2019: Wie wir werden, wer wir sind. Die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz, München
Bauer, Joachim 2023: Realitätsverlust. Wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen – und die Menschlichkeit bedrohen, München 2023
Behrens, Roger: Übermensch Superman Cyborg, in: www.fabrikzeitung.ch/über- mensch–superman–cyborg/#/
Beierlein, Hannes 2014: “Ist künstliche Intelligenz schon im Jahre 2045 möglich?“ www.cancom.info/2014/12/ist-künstliche...
Beuth, Patrick 2013: „Google Glass. Die Anti-Cyborgs“, www.zeit.de/digital/datenschutz/ 2013-03/stop-the-cyborgs-google-glass/komplettansicht
Bloch, Ernst 1970: Tübinger Einleitung in die Philosophie, Frankfurt a.M.
Bloch, Ernst 1977: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a.M.
Chalmers, David J. 2022: Reality+. Virtual Worlds and the Problems of Philosophy, Penguin Randomhouse (deutsch 2023)
Deutscher Ethikrat 2023: Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz. STELLUNGNAHME, in: https://www.ethikrat.org/publikationen/stellungnahmen/mensch-und-maschine/
Dierks, Nicolas 2021: Für mehr Besonnenheit im Umgang mit KI, https://ethik-heute-.org/fuer-mehr-besonnenheit-im-umgang-mit-ki/
Frazzetto, Giovanni 2014: Der Gefühlscode. Die Entschlüsselung unserer Emotionen, München
Gadamer, Hans Georg 1965 (2. Aufl.): Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philo-sophischen Hermeneutik, Tübingen 1960
Grunwald, Armin 2019: Der unterlegene Mensch – Die Zukunft der Menschheit im Angesicht von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Robotern, München
Kiefer, Markus 2015, in: Studie: Unser Wille ist freier als gedacht (2015), https://www.derstandard.at/story/2000011387060/studie-unser-wille…
Klatt, Robert 2022: Künstliche Intelligenz wird den Menschen auslöschen, in: https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/kuenstliche-intelligenz-wird-den-mens.
Kurzweil, Ray 2005: The Singularity is Near, London
Kurzweil, Ray 2014: Das Geheimnis des menschlichen Denkens. Einblicke in das Reverse Engineering des Gehirns, Berlin
Libet, Benjamin 2005: Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert, Frankfurt a.M.
Mainzer, Klaus 2016: Künstliche Intelligenz – Wann übernehmen die Maschinen?, Berlin/Heidelberg
Morozov, Evgeny 2024: Eine andere KI ist möglich, in: ‚Philosophie Magazin‘ Sonder-ausgabe Nr. 31, 2025, S. 56-65
Pert, Candace B. 2001: Moleküle der Gefühle. Körper, Geist und Emotionen, Reinbek
Podbregar, Nadja 2023: Der subtile Einfluss der KI-Systeme, in: https://www. wissenschaft.de/technik-digitales/der-subtile-einfluss-d...
Robra, Klaus 2003: Und weil der Mensch Person ist … Person-Begriff und Personalismus im Zeitalter der (Welt-)Krisen, Essen
Robra, Klaus 2017 a): „Die Zeitdimension im Dunkel des gelebten Augenblicks“, in: ‚VorSchein‘ Nr. 34, Nürnberg 2017, S. 51-61
Robra, Klaus 2017 b): Person und Materie. Vom Pragmatismus zum Demokratischen Öko-Sozialismus, München, https://www.grin.com/document/375344
Robra, Klaus 2018: Wie ist Erkenntnis möglich? Kants Theorie und ihre Folgen. Schicksalsfrage der Menschheit? München, https://www.grin.com/document/429613
Robra, Klaus 2019: Mit Leib, Seele und Information. Ein Vorschlag zur Lösung des Leib-Seele-Problems, München, https://www.grin.com/document/461010
Robra, Klaus o.J.: Ist das Christentum am Ende? Zu den Kritiken von Marx, Nietzsche, Dawkins, Kahl und Bauer, München, https://www.grin.com/document/1246983
Robra, Klaus o.J. (2020): Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München, https://www.grin.com/document/923015
Robra, Klaus o.J. (2021): Sind die Diktatur des Proletariats und die Bürokratie das Ende des Sozialismus? Die Frage nach Auswegen aus den Sackgassen, München, https://www.grin.com/document/1032082
Robra, Klaus 2022: Das „verkommene“ Subjekt. Hypokeimenon, Cogito, Übermensch? Grundlegung einer Subjekt-Objekt-Philosophie, München, https://www.grin.com/document/1183185
Robra, Klaus 2023: Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Möglichkeiten und Gefahren, München, https://www.grin.com/document/1383067
Robra, Klaus 2024: Bewusstseins-Philosophie. Eine Übersicht, München, https://www.grin.com/document/1472343
Robra, Klaus 2024a): Warum sollte der Staat „absterben“? Staatsphilosophien und historische Wirklichkeiten, München, https://www.grin.com/document/1506909
Schwartländer, Johannes 1968: Der Mensch ist Person. Kants Lehre vom Menschen, Stutt-gart
Spitzer, Manfred 2023: Künstliche Intelligenz. Dem Menschen überlegen – wie KI uns rettet und bedroht, München
Transhumanismus, https://www.sein.de/transhumanismus-die-groesste-gefahr-fuer-die-menschheit
Weisbuch, Gérard 1989: Dynamique des systèmes complexes, Paris
Wikipedia 2016: „Das Geheimnis des menschlichen Denkens“
Wilde, Oscar 1970: Der Sozialismus und die Seele des Menschen, Zürich
Zimbrich, Fritz 1980: Die Erfahrung der Sprache. Zu Bruno Liebrucks‘ „Sprache und Bewußtsein“, in: https://www.bruno-liebrucks.de/mediapool/113/1135270/data/Microsoft_Word_-_Zimrich_DIE_ERFAHRUNG_DER_SPRACHE.pdf
[...]
1 Hierzu auch: Schwartländer 1968, Robra 2003
2 In: https://www.ethikrat.org/publikationen/stellungnahmen/mensch-und-maschine/
3 In: studyflix.de>informatik>algorithmus-4244
4 In der Pflanze sieht Schelling einen „verschlungenen Zug der Seele“.
5 Vgl. Rainer E. Zimmermann: Räume sind Schäume. Über Substanz und Materie im richtigen Verhältnis, in: VorSchein Nr. 31, Nürnberg 2011, S. 117 ff.
6 Vgl. Robra 2019
7 In: https://www.leifichemie.de/einfuehrung-die-chemie/teilchenmodell/grundwissen/diffusion-teilchen-bewegung
8 So in seiner Logik, S. 27; auch in: www.textlog.de/kant-logik-philosophie-0.html
9 Vgl. Robra 2018, S. 173 ff.
10 In: Studie: Unser Wille ist freier als gedacht (2015), https://www.derstandard.at/story 2000011387060/studie-unser-wille…
11 Vgl. Robra 2024
12 In: Lothar Wendt: Das physikalisch-teleologische Weltbild, Bd. II, Heidelberg 1988
13 Gadamer 1965
14 Vgl. Gadamer a.a.O. S. 289 f. bzw. 356 f.
15 Vgl. Zimbrich 1980, S. 1
16 Dies in weitgehender Übereinstimmung mit Heidegger, der (in Sein und Zeit, S 161) erklärte: „Den Bedeutungen wachsen Worte zu. Nicht aber werden Wörterdinge mit Bedeutungen versehen.“
17 Vgl. Robra 2024, S. 67 ff.
18 Notter in: https://www.thats-ai.org/de-CH/units/verstehen-wie-ki-lernt
19 Klatt in: https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/ki-erkennt-sprache-besser-als-menschen-13374259
20 J. König in: https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-was-macht-ki-mit-unserer-sprache/2214041
21 Hierzu gibt es im Internet zahlreiche Einträge unter dem Link „Sprechende Schweine“.
22 Bloch 1977, S. 249
23 Wilde 1970
24 Vgl. Robra 2017, S. 177 ff. Ebd. weitere, anthropologisch relevante Kapitel u.a. zu Personalismus, Kosmologie, Trans- und Posthumanismus, Utopien, Religion, Sinnfrage, Freiheit der Person, Demokratischem Öko-Sozialismus.
25 https://ki-echo.de/die-verbindung-von-kuenstlicher-intelligenz-und-kunst/
26 https://das-wissen.de/kuenstliche-intelligenz-in-der-kunst-kreativitaet-und-kontroverse/
27 In: https://planet-zukunft.com/sex-mit-robotern-ist-das-unsere-zukunft/
28 In: https://www.20min.ch/story/ki-sexpuppen-es-fuehlt-sich-real-an-sexroboter-haben-nun-gefuehle-103132199
29 Vgl. https://www.maschinenethik.net/wp-content/uploads/2016/10/Artikel_Sexroboter.pdf
30 „Hoffnungsbilder gegen den Tod“ hat Ernst Bloch entworfen in Das Prinzip Hoffnung (1959), S. 1297 ff. Andere Philosophen und Philosophinnen sind weniger bis gar nicht optimistisch.
31 Bloch 1970, S. 258 f.
32 René Tichy: Eine Philosophie des Teufels, in: www.pfarre-nepomuk.at › nepweb › nordbahnviertel
33 Tatjana Heidemann, in: https://hph-psychologie.de/es-gibt-keine-negativen-und-positiven-gefuehle-es-gibt-rueckfuehrer-und-voranbringer/
34 Frazzetto 2014, S. 17 f.
35 Uwe Taschow in: https://spirit-online.de/wie-hass-sich-auswirkt.html
36 Corinna Hartmann: Das macht Neid mit dir (2021),in: https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/das-macht-neid-mit-dir/
37 Katharina Domschke: Was ist Angst? In: https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/psychologie/was-ist-angst-und-koennen-aengste-auch-hilfreich-sein/
38 s. u.a. Libet 2005, Kiefer 2015 Zur Erklärung des Begriffs heißt es bei Wikipedia: „Das Metaversum oder englisch Metaverse ist ein Konzept, bei dem ein digitaler Raum durch das Zusammenwirken virtueller, erweiterter und physischer Realität entsteht.[2] Hauptaspekt ist es dabei, die verschiedenen Handlungsräume des Internets zu einer Wirklichkeit zu vereinigen.[3] Das Konzept wird häufig mit einem starken Fokus auf virtuelle Sozialität beschrieben;[4][5][6] eine zukünftige Iteration des Internets, in Form persistenter, gemeinsam genutzter, virtueller 3D-Räume, die zu einem wahrgenommenen virtuellen Universum verbunden sind.[7] Solche sollen Individualisierung und alltägliche Aktivitäten in einem vergleichbaren Maße ermöglichen wie die physische Wirklichkeit.“ In: https://de.wikipedia.org/wiki/Metaversum
39 Und im ‚Handelsblatt‘ vom 23.02.2023 ist zu lesen: „Spätestens seit Mark Zuckerberg den ehemaligen Facebook-Konzern vergangenen Herbst in Meta umbenannt hat, ist der Begriff im Mainstream angekommen. 800 Milliarden US-Dollar soll das Geschäft mit dem Metaversum schon im Jahr 2030 umfassen, prognostiziert der Finanzdienst Bloomberg Intelligence. Und das, obwohl es das Metaverse als ein solches noch gar nicht gibt. Stattdessen wird Metaverse als Sammel-begriff für digitale, dreidimensionale Erlebniswelten verwendet, in der Menschen zusammenkommen, um zu spielen, einzukaufen, sich mit Kollegen zu treffen oder Konzerte zu besuchen. Sie sehen heute noch aus wie Zeichentrickfiguren, später aber sollen die digitalen Avatare optisch echten Menschen gleichen. Zuckerberg spricht von einer „neuen Generation des Internets“, die auch als Web 3.0 bezeichnet wird.“ In: https://www.handelsblatt.com/technik/metaverse-was-hinter-dem-metaverse-hype-steckt/28073180.html
40 Spitzer a.a.O. S. 47
41 In: Jenseits von Gut und Böse, 62
42 A.a.O. ebd.
43 In: Genealogie der Moral, III 13
44 In: Jenseits von Gut und Böse, 62
45 Hierzu: Robra o.J., S. 20 ff.
46 Aust, Stefan / Ammann, Thomas: Digitale Diktatur, Totalüberwachung, Datenmissbrauch, Cyberkrieg. Berlin 2014
47 s. u.a. Arnsburg, René: Maschinen ohne Menschen? Industrie 4.0: Von Schein-Revolutionen und der Krise des Kapitalismus. Berlin 2017, sowie: Schnetker, Max Franz Johann: Transhumanistische Mythologie. Rechte Utopien einer technologischen Erlösung durch künstliche Intelligenz. Münster 2019
48 Vgl. Robra, Klaus: Rettung durch Diktatur? Über Wege und Irrwege zum Reich der Freiheit. München 2019
49 Roger Behrens: Übermensch Superman Cyborg, in: www.fabrikzeitung.ch/übermensch–superman–cyborg/#/, S. 2
50 In: K. Robra: Person und Materie, München 2017, http://www.grin.com/de/e-book/375344/person-und-materie-vom-pragmatismus-zum-demokratischen-oeko-sozialismus, S. 129-133
51 Beierlein 2014, S. 1
52 Transhumanismus S. 8 (s. Literaturverzeichnis!)
53 Beuth 2013, S. 1
54 Vgl. Wikipedia 2016, S. 1-2, sowie Kurzweil 2014, S. 35-74
55 Kurzweil 2005, S. 487
56 vgl. Weisbuch 1989, S. 193
57 Vgl. Robra 2017 b), S. 129 ff.
58 In: https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/kuenstliche-intelligenz-wird-den-mens.
59 Klatt 2022, S. 2
60 Vgl. KI-Historie: Die Geschichte der künstlichen Intelligenz, https://www.cio.de/a/die-geschichte-der-kuenstlichen-intelligenz,3..., S. 7 f.
61 Podbregar 2023, S. 1
62 J. W. Moore in: https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/planetarische-gerechtigkeit-im-kapitalozaen/
63 Näheres hierzu in: Robra o.J. (2020), S. 304 f.
64 Dierks 2023, S. 4
65 In: https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_k%C3%BCnstl...
66 UNO-Generalsekretär Guterres für Regulierungsbehörde zu KI (2023) , https://www.deutschlandfunk.de/generalsekretaer-guterres-fuer-regu...
67 UNO-Menschenrechtsrat-Resolution zu Kontrolle von KI angenommen (2023), https://www.deutschlandfunk.de/resolution-zu-kontrolle-von-ki-an...
68 KI und Grundrechte (2019), https://www2.deloitte.com/de/de/pages/public-sector/articles/ki-un..., S. 3 ff.
69 Näheres hierzu: Robra o.J. (2021), S. 144 ff. sowie Robra 2023 (darin auch mit „ethisch fundierten Folgerungen“ und mit Hinweisen auf KI-Gesetze in USA und China)
70 Morozov 2024, S. 64
- Citation du texte
- Klaus Robra (Auteur), 2024, Was ist der Mensch im KI-Zeitalter? Philosophische Anthropologie im 21. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1525673