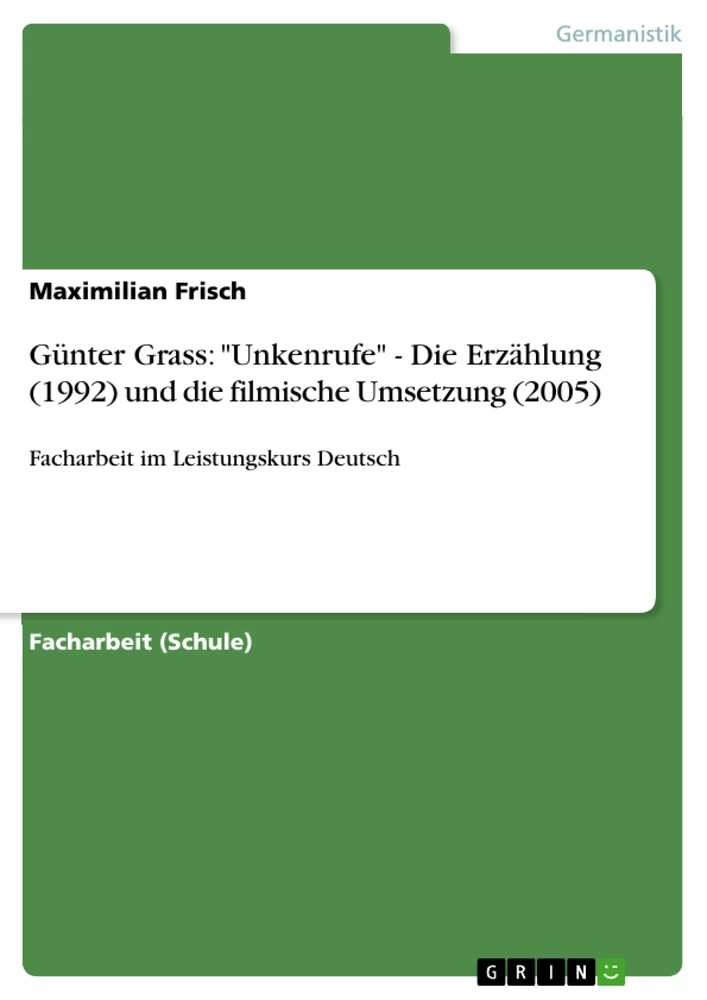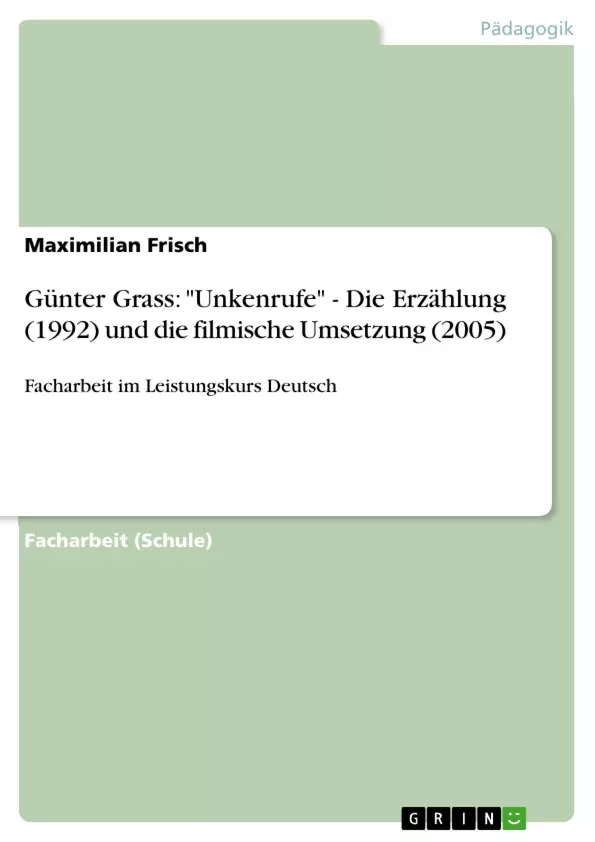Die Facharbeit ist wohl abgesehen vom Abitur die größte Leistung, die ein Schüler erbringen soll. Diese „vorwissenschaftliche“ Abhandlung, wie diese Arbeit auch genannt wird, war für mich immer mit einer träumerischen Vorstellung verbunden: Ich würde die Facharbeit sicherlich im Fach Geschichte schreiben und höchstwahrscheinlich über ein Thema mit Bezug zum Nationalsozialismus. Dieser Wunschtraum, der die problematischen Fragen der Facharbeit mangels besseren Wissens freilich völlig außer Acht lies, hielt sich von der zehnten bis zur 12. Klasse, in der ich dann erfuhr was „Facharbeit“ wirklich heißt, nämlich: dass man nicht einfach über etwas Beliebiges schreiben kann und schon gar nicht einfach so drauf los. Das man Themengebiete frühzeitig eingrenzen und auf ihre Machbarkeit überprüfen muss. Und schließlich das Ganze nicht zuletzt mit einer gewissen Anstrengung verbunden ist. Die Facharbeit schreibt sich eben nicht im Traum. Nach anfänglicher Frustration ob dieser Erkenntnis (schließlich war meine utopische Beinahe-Doktorarbeit in Geschichte in weite Ferne gerückt), kam alles ganz anders: Ich entschied mich für eines der vorgegebenen Themen im Fach Deutsch. Das Thema hatte mich angesprochen und ich konnte mich von der Problematik erlösen, in Geschichte ein Themengebiet auszuwählen, wo ich mir doch beinahe alle vorstellen konnte. Darüber hinaus bot sich die Möglichkeit, sich einmal mit dem Medium Film auseinanderzusetzen. Doch schon bald wich auch diese vorübergehende Euphorie der Ernüchterung: Einen Film versteht man noch lange nicht, wenn man ihn einmal ansieht. Und die Analyse eines Films nimmt, wie ich es der Sekundärliteratur entnehmen konnte, „mehrere Wochen“ in Anspruch. Bald erkannte ich, dass ich vielleicht einmal beginnen sollte, meine Themenstellung genau zu erfassen. Und genau dort setzt meiner Ansicht nach der eigentliche Sinn und Zweck der Facharbeit an: genau zu wissen, was man will und soll. Und, dass vor allem, genau zu wissen, was eigentlich machbar ist. Denn bevor man das Ziel nicht kennt, kann man den Weg dorthin lange suchen.
Im Folgenden werde ich mich also mit dem Vergleich ausgewählter und relevanter Gesichtspunkte hinsichtlich der Erzählung und des Films beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
1. Die Facharbeit als Chance
2. Inhalt und Aufbau
2.1. Inhalt und Aufbau der Erzählung von Günter Grass
2.2. Unterschiede in Inhalt und Aufbau des Spielfilms „Unkenrufe – Zeit der Versöhnung“
3. Charakteristik der Figuren
3.1. Charakteristik der Protagonisten in Günter Grass’ Erzählung
3.1.1.Charakteristik des Alexander Reschke
3.1.2. Charakteristik der Alexandra Piatkowska
3.2. Unterschiede der Charaktere im Film „Unkenrufe – Zeit der Versöhnung“
3.2.1. Charakteristik des Alexander Reschke
3.2.2. Charakteristik der Alexandra Piatkowska
4. Die narrative Gestaltung der Erzählung
5. Die narrativen Elemente im Film
6. Die Sprache Grass’
7. Die Sprache des Films
8. Intention
8.1. Intention des Autors der Erzählung
8.2. Intention des Regisseurs
9. Rezeption
10. Schlusswort
11. Anhang
12. Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
13. Quellenverzeichnis
1. Die Facharbeit als Chance
Die Facharbeit ist wohl abgesehen vom Abitur die größte Leistung, die ein Schüler erbringen soll. Diese „vorwissenschaftliche“ Abhandlung, wie diese Arbeit auch genannt wird, war für mich immer mit einer träumerischen Vorstellung verbunden: Ich würde die Facharbeit sicherlich im Fach Geschichte schreiben und höchstwahrscheinlich über ein Thema mit Bezug zum Nationalsozialismus. Dieser Wunschtraum, der die problematischen Fragen der Facharbeit mangels besseren Wissens freilich völlig außer Acht lies, hielt sich von der zehnten bis zur 12. Klasse, in der ich dann erfuhr was „Facharbeit“ wirklich heißt, nämlich: dass man nicht einfach über etwas Beliebiges schreiben kann und schon gar nicht einfach so drauf los. Das man Themengebiete frühzeitig eingrenzen und auf ihre Machbarkeit überprüfen muss. Und schließlich das Ganze nicht zuletzt mit einer gewissen Anstrengung verbunden ist. Die Facharbeit schreibt sich eben nicht im Traum. Nach anfänglicher Frustration ob dieser Erkenntnis (schließlich war meine utopische Beinahe-Doktorarbeit in Geschichte in weite Ferne gerückt), kam alles ganz anders: Ich entschied mich für eines der vorgegebenen Themen im Fach Deutsch. Das Thema hatte mich angesprochen und ich konnte mich von der Problematik erlösen, in Geschichte ein Themengebiet auszuwählen, wo ich mir doch beinahe alle vorstellen konnte. Darüber hinaus bot sich die Möglichkeit, sich einmal mit dem Medium Film auseinanderzusetzen. Doch schon bald wich auch diese vorübergehende Euphorie der Ernüchterung: Einen Film versteht man noch lange nicht, wenn man ihn einmal ansieht. Und die Analyse eines Films nimmt, wie ich es der Sekundärliteratur entnehmen konnte, „mehrere Wochen“ in Anspruch. Bald erkannte ich, dass ich vielleicht einmal beginnen sollte, meine Themenstellung genau zu erfassen. Und genau dort setzt meiner Ansicht nach der eigentliche Sinn und Zweck der Facharbeit an: genau zu wissen, was man will und soll. Und, dass vor allem, genau zu wissen, was eigentlich machbar ist. Denn bevor man das Ziel nicht kennt, kann man den Weg dorthin lange suchen.
Im Folgenden werde ich mich also mit dem Vergleich ausgewählter und relevanter Gesichtspunkte hinsichtlich der Erzählung und des Films beschäftigen.
2. Inhalt und Aufbau
2.1. Inhalt und Aufbau der Erzählung von Günter Grass
Günter Grass’ Erzählung „Unkenrufe“ behandelt die Liebesgeschichte zwischen dem deutschen Witwer Alexander Reschke und der verwitweten Polin Alexandra Piatkowska, die ungewöhnliche Früchte trägt: Das Paar begründet zur Zeit des fallenden Eisernen Vorhangs eine „Polnisch-Deutsch-Litauische Friedhofsgesellschaft“ (s. S. 35, Grass), deren Aufgabe es ist, verstorbene Vertriebene in Heimaterde zu bestatten. In sieben Kapiteln schildert der Autor, wie die Liebe zwischen den beiden Hauptpersonen stetig wächst und ihr Versöhnungswerk sich nach einer kurzen Erfolgsphase in eine ungewollte Richtung verändert. Wirtschaftliche Interessen treten in den Vordergrund und das Paar nimmt Abstand von seiner entfremdeten Idee.
Zu Beginn treffen die beiden Protagonisten Alexander Reschke, ein Bochumer Professor für Grabinschriften, und Alexandra Piatkowska, eine polnische Restauratorin, an Allerseelen 1989 in Danzig aufeinander (vgl. S. 7f und S.14, ebd.) Die Polin hilft dem Deutschen auf, als dieser vor der Dominiksmarkthalle stürzt. Trotz des anfänglichen Widerwillens dem ungeschickten Deutschen gegenüber zeigt Alexandra ihm die Hundegasse, in der das Geburtshaus Reschkes steht. Beide kommen miteinander ins Gespräch und schließlich lädt Frau Piatkowska Herrn Reschke zu sich nach Hause ein. Nach einem gemeinsamen Abendessen entsteht die „Schnapsidee“ der Friedhofsgesellschaft, die den vertriebenen Deutschen, Polen und Litauern eine letzte Ruhestätte in Heimaterde garantieren soll (vgl. S. 34ff, ebd.). Im zweiten Kapitel wird aus der anfänglichen Weinlaune Ernst: Gemeinsam suchen Witwe und Witwer nach einem geeignetem Terrain in Danzig und diskutieren über die zu gründende Gesellschaft. Bevor Reschke nach einer gemeinsamen Nacht wieder nach Deutschland abreist, offenbaren sich beide ihre Liebe zueinander. Die Beziehung des Witwers und der Witwe bestimmt auch das dritte Kapitel: Durch Briefwechsel und Telefonate schildern sich die Verliebten nicht nur ihre Empfindungen füreinander sondern auch die Fortschritte in ihren Bemühungen um die Gesellschaft (vgl. S. 70ff, Grass). Nachdem Geschäftskontakte auf Deutscher und Polnischer Seite angebahnt sind, kommt es zur Gründung der Gesellschaft im Danziger Hotel Hevelius durch Geschäftsleute beider Nationen, das Liebespaar fungiert als Geschäftsführer. In Kapitel vier schließlich können die ersten Bestattungen stattfinden (vgl. S. 112ff, ebd.). Doch das Gleichgewicht der deutschen und polnischen Interessen innerhalb der Gesellschaft ist zerbrechlich und wird bereits durch auseinander gehende Vorstellungen über die Zukunft der Friedhofsgesellschaft auf die Probe gestellt. Die Umzäunung des Friedhofsgeländes löst Streitigkeiten aus. Den Eklat, der Kapitel fünf bestimmt, löst schließlich der Vorschlag eines deutschen Mitglieds im Aufsichtsrat aus: Bereits Verstorbene sollen umgebettet werden (vgl. S. 160ff, ebd.). Langsam aber sicher entfernen sich Witwe und Witwer von ihrer Idee, die immer mehr entfremdet wird. Der Aufsichtsrat verfolgt zunehmend wirtschaftliche Interessen und nimmt keine Rücksicht auf den zündenden Versöhnungsgedanken, den Alexandra Piatkowska und Alexander Reschke hatten. Bald sollen Golfanlagen und Altenheime den Senioren schon vor der Bestattung den Danziger Versöhnungsfriedhof schmackhaft machen. Dem wollen die Gründer nicht mehr zusehen und treten in Kapitel sechs von ihrem Amt als Geschäftsführer zurück, und sie bekleiden lediglich noch einen Ehrenvorsitz als Gründer der Gesellschaft. Nicht mehr über Entscheidungsgewalt verfügend, kümmern sie sich vermehrt um ihre Beziehung, anstatt dem kapitalistischen Treiben länger zuzusehen. Die Liebe rückt in den Mittelpunkt und finalisiert schließlich in der gemeinsamen Hochzeitsreise nach Neapel in Kapitel sieben. Dort sterben die Protagonisten bei einem Autounfall (vgl. S.245, Grass.).
Die Handlung wird in ihrem linearen Verlauf oft durchbrochen. Der Erzähler schildert in Rückblenden die Vergangenheit der Hauptfigur Reschke und kommentiert voraus schauend das Handeln der Protagonisten. Die eigentliche Handlung wird dadurch aber nicht beeinflusst.
2.2. Unterschiede in Inhalt und Aufbau des Spielfilms „Unkenrufe – Zeit der Versöhnung“
Betrachtet man den Plot von „Unkenrufe“, so ergeben sich in der filmischen Umsetzung keine nennenswerten Unterschiede zu der Erzählung. Jedoch gibt es einige Besonderheiten in Aufbau und Gewichtung des Inhalts. Der Inhalt der Buchvorlage, welcher mehrere Stunden Lesezeit erfordert, findet sich hier notwendigerweise verdichtet auf ca. 90 Minuten. So ist auch die Kapiteleinteilung eine andere: Die DVD weißt 14 Kapitel, genauer: „Sequenzen“ (Faulstich, S. 73f und Hickethier, S. 38f) auf. In der folgenden Untersuchung des Aufbaus beziehe ich mich auf das Sequenzenprotokoll, das im Anhang beiliegt. Während Günter Grass’ Werk damit beginnt, dass „(…)der Witwer anstößt [anstieß], stolpert [stolperte], doch nicht zu Fall kommt [kam]“ (S. 7, Grass, Änderungen durch den Verfasser) weil die Witwe bereits zur Stelle ist, setzt Robert Glińskis Spielfilm früher an: Der Zuschauer erhält bereits erste Eindrücke zu den Figuren bevor die Haupthandlung beginnt, zum Beispiel als Alexander Reschke auf dem Weg nach Danzig einen Autounfall erlebt. In zwei weiteren Parallelsequenzen treten Alexandra Piatkowska sowie Erna Brakup bereits auf und werden dabei in ihrem für den Film wichtigen Umfeld und Verhalten gezeigt (siehe Sequenzprotokoll, Sequenz 1, Anhang 1). Erfährt der Leser nähere Informationen zu Aussehen, Beruf und Verhalten erst durch spätere Kommentare und Einfügungen des Erzählers, hat der Zuschauer schon die „energische Restauratorin“, die „alte Danzigerin“ und den „älteren, etwas verwirrten Professor“ kennen gelernt. (So etwa könnte ein Zuschauer die Figuren nach den Eindrücken aus Sequenz eins beschreiben.) Während das Buch die Charakterisierung der Personen nachholen kann, muss der Film dem Zuschauer freilich zu Beginn die handelnden Figuren zeigen – ein Rückwärtserzählen ist zumindest in diesem Bezug noch nicht möglich (vgl. S. 136, Hickethier). Der nur im Film enthaltene Autounfall zu Beginn bildet zusammen mit dem Unfall in Italien am Ende der Story (vgl. Sequenz 14, 1:28:30 – 1:28:50, Film), eine Art Rahmen – mit dem Unterschied das der zweite Unfall den Tod der Protagonisten zur Folge hat. Er schließt also in gewisser Weise ab, was in der ersten Sequenz nicht beendet wurde.
Die bereits angesprochene Figur der Erna Brakup stellt ebenfalls eine weitere Änderung gegenüber der Erzählung dar. Während sie dort erst in Kapitel vier auftritt, nimmt sie im Film eine wesentlich wichtigere Position wahr: Brakup ist es, die den Unfall Reschkes indirekt auslöst, indem sie eine Unke vom Grab ihres Mannes verscheucht und diese auf die Straße hüpft, wo Reschke beim Versuch, ihr auszuweichen, verunglückt (vgl. Sequenz 1, 0:02:25 – 0:03:10, ebd.). Der Erzähler im Buch berichtet von einer Bäuerin, die bei der Begegnung der Protagonisten passiv im Hintergrund bleibt. Im Spielfilm ist es eindeutig Erna Brakup, die anstelle des literarischen Vorbilds Alexandra Piatkowska Pilze verkauft. Als diese aus dem Einkaufsnetz fallen, rutscht Reschke aus – die Begegnung wird so erst möglich. Und Erna Brakup dient auch weiterhin als eine Art Motor der Handlung in den ersten Sequenzen, wenn sie Reschke auffordert ihr [Alexandra Piatkowska, Anm. des V.] hinterher zu rennen (vgl. Sequenz 2, 0:09:40 – 0:10:15, ebd.). Der allwissende und allmächtige Erzähler als „Puppenspieler“, der er ja in der Erzählung ist, fehlt. Aufgrund dessen benötigt der Film stellenweise eine andere Instanz, die die Handlung antreibt. Und Erna Brakup ähnelt dabei in mancherlei Hinsicht dem Erzähler doch recht stark: Sie kommentiert die Handlung und blickt auch voraus, was an ihren Aussprüchen sichtbar wird. So äußert sie sich auch in Sequenz sechs zum Mauerfall.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Die Facharbeit als Chance, Inhalt und Aufbau (der Erzählung von Günter Grass und des Spielfilms „Unkenrufe – Zeit der Versöhnung“), Charakteristik der Figuren (in Erzählung und Film, einschließlich Alexander Reschke und Alexandra Piatkowska), die narrative Gestaltung der Erzählung, die narrativen Elemente im Film, die Sprache Grass’, die Sprache des Films, Intention (des Autors und des Regisseurs), Rezeption, Schlusswort, Anhang, Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen und Quellenverzeichnis.
Was sind die zentralen Themen der Facharbeit?
Die Facharbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Vergleich der Erzählung „Unkenrufe“ von Günter Grass und ihrer Verfilmung „Unkenrufe – Zeit der Versöhnung“. Dabei werden inhaltliche und strukturelle Unterschiede sowie die Charakterisierung der Figuren und die Intentionen des Autors und des Regisseurs analysiert. Die Arbeit betrachtet auch die sprachliche Gestaltung und die narrative Umsetzung in beiden Medien.
Wie wird die Liebesgeschichte von Alexander Reschke und Alexandra Piatkowska in der Erzählung dargestellt?
Die Erzählung schildert, wie Alexander Reschke, ein deutscher Witwer, und Alexandra Piatkowska, eine polnische Witwe, sich in Danzig kennenlernen und eine „Polnisch-Deutsch-Litauische Friedhofsgesellschaft“ gründen. Ihre Liebe wächst im Laufe der Geschichte, doch die anfängliche Versöhnungsidee wird durch wirtschaftliche Interessen entfremdet. Am Ende sterben beide bei einem Autounfall.
Welche Unterschiede gibt es in Inhalt und Aufbau zwischen der Erzählung und dem Film?
Der Film verdichtet den Inhalt der Erzählung auf ca. 90 Minuten. Während die Erzählung mit dem Stolpern Reschkes beginnt, zeigt der Film bereits vorher Szenen mit den Hauptfiguren. Die Figur der Erna Brakup spielt im Film eine größere Rolle als in der Erzählung. Der Film verzichtet auf einen allwissenden Erzähler und lässt die Figuren implizit erzählen.
Welche Rolle spielt Erna Brakup im Film „Unkenrufe – Zeit der Versöhnung“?
Erna Brakup löst indirekt den Autounfall Reschkes aus und dient als eine Art Motor der Handlung in den ersten Sequenzen. Sie kommentiert die Handlung und blickt voraus, ähnlich wie der Erzähler in der Buchvorlage. Sie ist anstelle von Alexandra Piatkowska diejenige, die Pilze verkauft und somit die erste Begegnung zwischen Reschke und Alexandra ermöglicht.
Wie werden Rückblenden in der Erzählung und im Film dargestellt?
In der Erzählung werden Rückblenden durch den Erzähler eingeführt, der die Vergangenheit Reschkes schildert. Im Film schwelgt Reschke selbst in Erinnerungen, wenn er durch Danzig streift oder sich an seine Jugend erinnert. Es wird auch angedeutet, dass Reschke und Alexandra sich möglicherweise in ihrer Jugend begegnet sind.
- Quote paper
- Maximilian Frisch (Author), 2007, Günter Grass: "Unkenrufe" - Die Erzählung (1992) und die filmische Umsetzung (2005), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152614